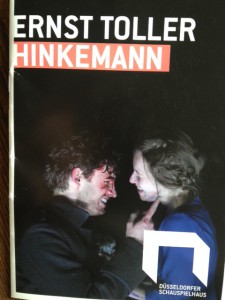Um die nordrhein-westfälische Theaterlandschaft steht es nicht gut. In Köln und Dortmund werden die Gebäude saniert, und in beiden Städten dauert das länger als geplant. Doch wenigstens stellt hier noch keiner die Häuser als solche in Frage. In Düsseldorf hingegen, der Landeshauptstadt, ist nichts mehr sicher. Ebenfalls wird hier das Haus saniert, die Kosten der Sanierung laufen davon, und ein „kunstsinniger“ Oberbürgermeister stellt sich und seinen Genossen laut die Frage, ob das denn wirklich alles sein müsse.

Auch nicht mehr die Allerjüngsten, doch ab 2018 für die RuhrTriennale verantwortlich: Stefanie Carp und Christoph Marthaler. (Foto: Bernd Berke)
Man könne das Filetgrundstück, auf dem das Theater derzeit noch die Stirn zu stehen hat, doch viel besser vermarkten. Und wenn man die alte Bude aus der Nachkriegszeit wegen Denkmalschutz schon stehenlassen müsse, könne man dort doch wenigstens etwas Interessanteres machen als ausgerechnet Theater. Kongresse abhalten zum Beispiel. „Eventbude“ wäre der passende Kampfbegriff, auf den, wie bekannt, Claus Peymann das Copyright hat.
Düsseldorfer Misere
Immerhin würden Abriß oder Umwidmung des Theaters in der Stadt, in der einst Gustaf Gründgens wirkte, keinen Intendanten arbeitslos machen, denn Wilfried Schulz, der aus Dresden an den Rhein kam, ist Jahrgang 1952 und könnte wahrscheinlich mit geringen Abzügen vorzeitig in Rente gehen (bitterer Scherz!). Allerdings hatte er wohl andere Vorstellungen von Theaterarbeit, als er aus Dresden in den tiefen Westen wechselte, hatte Ideen, wie er in Düsseldorf die Karre aus dem Dreck ziehen würde, die dort seit dem Abgang Amélie Niermeyers 2011 und dem „Burnout“ ihres Nachfolgers Staffan Valdemar Holm steckt.
Ein tapferer Senior hatte zwischenzeitlich die Stellung gehalten: Günther Beelitz (75), der das Haus schon einmal von 1974 bis 1986 geleitet hatte. Doch nun? Nun befindet OB Thomas Geisel (und mit ihm fraglos etliche weitere kunstsinnige Lokalpolitiker), daß das Schauspiel im „Central“, der Ausweichspielstätte in Bahnhofsnähe, sehr gut aufgehoben sei.
Das Land schweigt
Irgendwie fragt man sich da schon, welche Vorstellung die Düsseldorfer Lokalpatrioten von Urbanität haben, von städtischem Leben und städtischer Kultur. In der Antwort, fürchte ich, wäre viel weißes Rauschen. Und eine zweite Frage drängt sich auf: Würden kulturlose Lokalpolitiker wie die in Düsseldorf auch so dreist auftreten, wenn sie es mit selbstbewußten, erfolgreichen Theaterleuten zu tun hätten statt mit personellen Notnägeln? Wilfried Schulz ist damit ausdrücklich nicht gemeint. Zwischen Niermeyers Abgang und Schulz‘ Dienstantritt sind fünf Jahre verstrichen, in denen das Düsseldorfer Schauspielhaus langsam aber sicher in den Bedeutungsverlust trieb.
Hat in diesem Zusammenhang übrigens jemand etwas von der Landesregierung gehört? Das Theater der Landeshauptstadt wird nämlich von Land NRW mitfinanziert, ist somit auch ein Staatstheater, und eigentlich müßte das Land ein vehementes Interesse an diesem kulturellen Aushängeschild haben. Hat es aber wohl nicht. Kulturelle Präferenzen dieser Landesregierung sind ja eh kaum auszumachen, und wenn doch, dann liegen sie eher im pädagogischen Bereich, dann hat man es in der Kunst lieber breit als hoch. Mit etwas Wehmut denkt man da an alte Zeiten, in denen ein Ministerpräsident Jürgen Rüttgers die Verdoppelung der Kulturausgaben verkündete und ein Kulturstaatssekretär mit Namen Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff in den Spielstätten des Landes fast allgegenwärtig war.
Den Namen der amtierenden Kultusministerin mußte ich googeln: Christina Kampmann heißt sie, Jahrgang 1980, seit 2015 im Amt und außer für Kultur auch für Familie, Kinder, Jugend und Sport zuständig. Ihre Vorgängerin (wieder gegoogelt) war Ute Schäfer, Jahrgang 1954, die jetzt ihren (Vor-) Ruhestand genießt. Beide keine politischen Schwergewichte. Ob von Frau Kampmann noch was kommt? (Detaillierte Bemerkungen über eine glanzlose Landesregierung, ihre skandalösen Kunst-Verkäufe und ihre Neigung zum Wegducken bei ungeliebten Themen spare ich mir an dieser Stelle.)
Intendantin und „Chef-Regisseur“
Falsche Personalentscheidungen standen am Anfang der Düsseldorfer Schauspielkrise, und nachher ist man immer klüger. Blicken wir nun auf die Ruhrtriennale, die ebenfalls zu einem wesentlichen Teil vom Land finanziert wird und alle drei Jahre einen neuen Intendanten bekommt. Offensichtlich wollte und will man hier in Fragen der Intendanz kein Risiko eingehen. Hier sollen es die alten Männer richten. Dem Niederländer Johan Simons (70) folgt 2018 Christoph Marthaler (Jahrgang 1951) nach, der dann also, wir rechnen mal kurz, 67 Jahre alt sein wird.
Doch halt, in Wirklichkeit ist es ja ganz anders! Intendant wird eine Intendantin, eine Frau im Amt war überfällig! Stefanie Carp, fünf Jahre jünger als Marthaler und, nebenbei bemerkt, Schwester des Oberhausener Theaterleiters Peter Carp. Schaut man sich ihren beruflichen Werdegang an, könnte man sie, und das ist nicht despektierlich gemeint, eine „ewige Dramaturgin“ nennen, war sie doch in Sonderheit für Christoph Marthaler viele Jahre lang das, was beispielsweise Hermann Beil für Claus Peymann ist. Auch hat sie wiederholt die Wiener Festwochen geleitet.
Nun ist sie also Intendantin der Ruhrtriennale; Marthaler ist ihr „Chef-Regisseur“, fraglos eine interessante Position, die man am Theaterbetrieb bisher kaum kannte. Da sich die beiden von der Berliner Volksbühne her gut kennen, mag das das Werk wohl gelingen. Besonders gespannt muß man auf das Musikprogramm dieses traditionell musikorientierten Festivals sein, bei so viel Sprechtheater-Kompetenz. Aber in Marthalers Inszenierungen wird ja meistens sehr schön gesungen.
Wo sind die Jungen?
Simons ist Holländer, Marthaler Schweizer, Frank Hoffmann, der Intendant der Ruhrfestspiele, ist Luxemburger, der designierte neue Chef im Dortmunder Kulturzentrum „U“, Edwin Jacobs, wiederum Holländer. Zum gelassenen Ruhrgebiets-Internationalismus paßt das durchaus. Doch stimmt es auch nachdenklich, daß große Teile des kulturellen Spitzenpersonals a.) im Land nicht zu finden waren und b.) selten unter 60 Jahre alt sind, oft deutlich älter.
Bitte nicht mißverstehen: Nichts spricht dagegen, Leitungspositionen in Theatern und Museen mit Ausländern zu besetzen, das ist weltweit gang und gäbe. Hartwig Fischer beispielsweise, der so gut mit Berthold Beitz konnte und durchaus seinen Anteil an der Verwirklichung des neuen Folkwang-Museums in Essen hat, leitet jetzt (als erster Ausländer) das British Museum in London. Zum British Museum gehört die Tate Gallery of Modern Art, deren Chef Chris Dercon wiederum Nachfolger Frank Castorfs als Intendant der Berliner Volksbühne wird, was indes von vielen als Skandalon empfunden wird… (Vielleicht kein so gutes Beispiel.).
Besorgniserregend aber ist, wenn wir auf NRW blicken, daß nirgendwo im ganzen großen Kulturbetrieb jemand zu entdecken ist, Mann oder Frau und idealerweise noch nicht kurz vor der Rente, den oder die man als kulturellen Hoffnungsträger bezeichnen könnte. Sicherlich kann niemand einen Künstler vom Range des verstorbenen Christoph Schlingensief aus dem Zylinder ziehen, auch kleinere Talente schon stimmten ermutigend. Doch wenn Anselm Weber, noch Intendant in Bochum, in der nächsten Spielzeit nach Frankfurt wechselt, räumt er seinen Platz für den, wie schon erwähnt, 70jährigen Johan Simons. Aufbruch sieht anders aus.
Vielleicht ist es ja so, daß kleinmütige Findungskommissionen es Mal um Mal vermieden haben, mit Jüngeren ein experimentelles Tänzchen zu wagen. Man hat ja nicht dabeigesessen. Das Resultät bleibt das gleiche, und die Parole lautet „Alte Säcke an die Macht“.
Dortmunder Spezialisten
Hat da jemand „Aber Dortmund!“ gerufen? Nun gut: Auch die Dortmunder haben Streß mit ihrer Theatersanierung. Wie bekannt spielt man im „Megastore“, einem Lagerhallenkomplex im Gewerbegebiet, die Sanierung des Schauspielhauses verzögert sich, wird überdies teurer als geplant. Aber wer hätte auch anderes erwartet? Die Tatkraft und die Kreativität, mit denen sich das Dortmunder Theater diese (Anti-) Spielstätte erobert hat, sind auf jeden Fall beeindruckend.
Hier können zukünftige Ruhrtriennale-Intendanten noch etwas lernen, wenn sie wieder eine alte Industriehalle bespielen sollen, die anscheinend für alles besser geeignet ist als für Theater. Doch muß man Zweifel haben, ob dieses sehr sportliche, sehr dem theatralischen Jugendbereich zugewandte und in diesem Sinne hochspezialisierte Dortmunder Theater wegweisend für die Entwicklung in der Region ist. Trotzdem bin ich jetzt schon sehr gespannt auf das, was Kay Voges und die Seinen demnächst im renovierten Schauspielhaus zustande bringen werden.