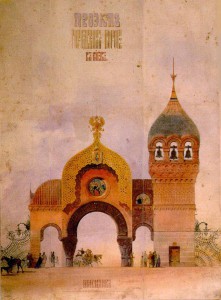Mit Brahms in den Kosmos der Liebe: Magdalena Kožená in der Philharmonie Essen
Die Liebe, die von Johannes Brahms besungen wird, ist selten so jauchzend-berauscht wie in „Meine Liebe ist grün“. Oft hängt sie einer still schmerzlichen Sehnsucht nach, beschwört verzweifelt Festigkeit und Ewigkeit, schwimmt ratlos in Tränen. Wer also Brahms‘ Liebeslieder singt, wird sich dieser Ambivalenz stellen müssen – im Wort und im Klang der Stimme.
Magdalena Kožená hat für ihren Liederabend in der Essener Philharmonie vierzehn der gewichtigen Miniaturen zusammengestellt, die ein Spektrum der Liebe auffächern – Widerhall des Schwärmens in der Natur („Nachtigall“), resignierte Trostlosigkeit („Verzagen“), Ahnungsvolles und Geisterhaftes („Meerfahrt“), Sehnsuchtsvolles und auch ein wenig Schnippisches („Vergebliches Ständchen“). Diesen Kosmos durchschreitet sie mit kühlem Ton. Sie spielt kaum mit dem Wort, meidet es, Schlüsselbegriffe tonmalerisch hervorzuheben, trägt lyrische Farben nur sehr verhalten auf.
Aber sie spielt die Vorzüge ihres Mezzo aus, der von Natur aus nicht für Glut und Farbe zu haben ist, wohl aber in der Dynamik sich wandlungsfähig und flexibel erweist. Verhalten schimmerndes Piano führt über leider manchmal matte Zwischenstufen zu einer konzentriert fokussierten, aber nicht immer frei strömenden vollen Stimme.
Kožená trifft in Joseph von Eichendorffs „Anklänge“ den ruhig enthobenen Ton, korrespondiert auch in „Der Schmied“ (Ludwig Uhland) mit dem Klavier im malerischen Rhythmus. Aber ob das „Vergebliche Ständchen“ nur neckisch oder eigentlich grausam ist, vermag sie nicht zu klären. Dazu bleiben die Stimmfarben zu neutral. In „Von ewiger Liebe“ fehlt der selbstbewussten Zuversicht des Mägdeleins die Spur eines Beharrens, das der unterbewusst mitschwingenden Gefährdung die trotziges Behauptung der Liebe entgegensetzt: So dürfte „Unsere Liebe muss ewig bestehn!“ nicht nur schwärmerisch, sondern auch eine Spur verunsichert klingen.
Viel beredter gelingen Magdalena Kožená die „Kinderstuben“-Lieder Modest Mussorgskys, die gleich nach der Uraufführung 1960 verbotenen fünf Satiren op. 109 Dmitri Schostakowitschs und die veredelte Folklore der „Dorfszenen“ Béla Bartóks. Die kindlichen Dialoge mit der „Njanjuschka“ verniedlicht sie nicht, aber gibt ihnen einen charakteristischen Tonfall – ob es das weinerliche, verschmitzt argumentierende Kind oder die zeternde Njanja („V uglu“), das Entsetzen über den großen Käfer oder das vielsagend artikulierte Abendgebet ist. Auch bei Schostakowitsch spürt man den überlegten Umgang mit dem Wort, die Ironie („Kreutzer-Sonate“) und den augenzwinkernden Abstand zwischen Fiktion und Realität, der zu einer komischen Katastrophe führt („Missverständnis“).
Koženás Klavierpartner Yefim Bronfman lässt in nahezu jedem Moment spüren, wie tief er in die Musik eintaucht: Bei Brahms bringt er die Farben zum Leuchten, die man bei der Sängerin vermisst. So erzählen die letzten Töne von „Nachtigall“ von anklingender Wehmut, legt das dunkle Register in „Von ewiger Liebe“ einen Schleier des Zweifels aus, beschwört das Klavier das Visionäre in der „Meerfahrt“.
Mussorgsky beleuchtet Bronfman delikat und idiomatisch vielfältig. Bartóks kunstvolle Begleitungen spielt er, als seien sie selbständige Klavierstücke. Doch da liegt auch ein Problem: In den Brahms-Liedern konzentriert sich Bronfman bisweilen zu selbstverliebt auf seinen Part und vergisst, mit der Sängerin zu atmen. Bei Schostakowitsch trifft er sich mit Kožená kongenial beim Ausleuchten des Hintersinns, und in Béla Bartóks holt er frisch und farbenverliebt die berückenden Melodien aus der Folkloristik in den Himmel großer Kunst. Wenn’s so weitergeht, verspricht die Kammermusik in der anbrechenden Saison der Philharmonie noch viele anregende Abende.
Am 10. September erscheint beim Label Pentatone eine CD mit Liedern von Brahms, Mussorgsky und Bartók mit Magdalena Kožená und Yefim Bronfman. Das Album ist auch über Streamingdienste abrufbar.
 Wer sich mit der Moderne befasst, kommt um Dessau nicht herum. Das Bekenntnis zur klassischen Moderne in der mitteldeutschen Stadt singt Michael Kaufmann, Intendant des
Wer sich mit der Moderne befasst, kommt um Dessau nicht herum. Das Bekenntnis zur klassischen Moderne in der mitteldeutschen Stadt singt Michael Kaufmann, Intendant des