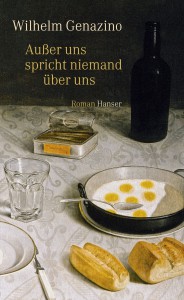Wie ein Fluss ohne Ufer: Ulrike Anna Bleiers Roman „Spukhafte Fernwirkung“
Ulrike Anna Bleiers Roman Spukhafte Fernwirkung entfaltet ein Panorama der gegenwärtigen Gesellschaft. Es können zweihundert Personen sein, von denen wir etwas erfahren, vielleicht sind es mehr, vielleicht weniger. Ungeheuerliches wird erzählt, ein Amoklauf in einem Einkaufszentrum, eine fragwürdige, aber medienwirksame Geiselnahme in einer Zeitungsredaktion, es werden Pistolen und MPs herumgetragen und benutzt, eine Frau begegnet ihrem Stalker wieder, der ihr die Karriere als Schauspielerin versaut hat, eine Schiffskatastrophe mit Todesopfern wird geschildert, Auto- und Bahnunfälle und anderes von großer Tragweite.
Menschen in alltäglichen Berufen und ohne Beruf, Menschen am Rande der Gesellschaft wie Silvana, die keine Beine hat, auf der Straße sitzt und hyperbolische Räume häkelt; ein Mensch wie Erika, die beim Fernsehen kluge Gedanken zum Verhältnis von Dingen und Menschen in Werbespots und Vorabendfilmen anstellt; oder Irma, die um ihre Weiterbeschäftigung in der Redaktion einer Lokalzeitung bangt und Angst vor Konferenzen hat. Aber manchmal geht es auch um eine Katze, einen Hund mit gelben Augen, zwei Esel oder einen Fuchs.
Unhierarchisches Nebeneinander
Ein Roman des Nebeneinander; es sind Einzelschicksale, aus denen sich unsere Gesellschaft zusammensetzt, deutlich mehr als die wenigen exemplarischen Protagonisten, mit denen Romane normalerweise aufwarten. In Spukhafte Fernwirkung gibt es keine Heldinnen und Helden; es ist ein Anspruch der Autorin, so zu erzählen, dass keine Hierarchien entstehen, keine Person, keine Handlung wichtiger als eine andere ist. So erscheint das Außerordentliche unspektakulär, während andererseits Alltägliches zu einem staunenswerten Ereignis werden kann. Mathildas Interesse an Kernphysik nimmt ihren Ausgang in einer Shopping Mall, durch den eher zufälligen und etwas ratlosen Kauf einer Tasse, deren Dekor ein Atommodell aufweist. Die mit einem Gutschein erworbene „Thementasse“ wird Mathilda später zum Anlass nehmen, nach Genf zu fahren, um das CERN zu besichtigen.
Nicht-Orte und das Dazwischen
Mit der Figur der Mathilda, aber nicht nur durch sie, kommen zwei der bevorzugten Schauplatzarten des Romans zusammen, Einkaufszentren und Verkehrswege – „Nicht-Orte“ und das Dazwischen. In ihrem Blog WHEREAMiNOW hat sich die Autorin mit dem kanadischen Geographen Edward Relph beschäftigt, der in seinem 1976 erschienenen Buch Place and Placelessness die Frage erörtert, was Orte (places) und Räume (spaces) sind, und was Ortlosigkeit (placelessness) bedeutet; ebenso mit Marc Augés Begriff der Nicht-Orte (non-lieux; 1992), der auf die bereits von Michel Foucault formulierte „Heterotopie“ zurückgreifen konnte. Shopping Malls, Autobahnen, Busbahnhöfe oder Krankenhäuser sind auch bevorzugte Schauplätze und Themen in Ulrike Bleiers Roman.
Rätselhafte Verschränkungen
In Jim Jarmuschs Film Only Lovers Left Alive (2013) sagt die von Tilda Swinton verkörperte Vampirin zu ihrem Mit-Vampir Adam: „Erzähl mir von der Verschränkung und von Einsteins spukhafter Fernwirkung.“ Ulrike Anna Bleier kommt diesem Wunsch auf ihre Weise nach. Freilich kann auch sie das von Albert Einstein entdeckte Rätsel der „Spukhaften Fernwirkung“, der Verschränkung von nicht kausal erklärbaren und somit wissenschaftlich überhaupt unerklärlichen Phänomenen, nicht begründen. Einstein, der den Begriff prägte, schrieb in einem Brief an Max Born vom 3. März 1947, er könne an eine solche spukhafte Fernwirkung nicht ernsthaft glauben. Immerhin wurde für Experimente mit verschränkten Photonen in diesem Jahr (2022) der Nobelpreis vergeben – für Physik, nicht für Literatur. Ohne esoterisch daherzukommen, gibt es in Ulrike Bleiers Roman immer wieder Momente, die eine solch spukhafte Fernwirkung nahelegen. Wird in Bleiers Roman aber Physik verhandelt, Teilchenphysik, Astrophysik, ist sie stets so geerdet wie Mathilda mit ihrer Teetasse oder Silvana mit den gehäkelten hyperbolischen Räumen.
Raum und Zeit
Der Roman ist in acht Teile gegliedert, deren Namen wie „Mit der Zeit“, „Bahnen“, „Gegen den Raum“, „Weltlinien“ oder „Freie Weglängen“ andeuten, dass Raum und Zeit hier große Themen sind. Im ersten Teil („Mit der Zeit“) ist die Angabe der Uhrzeit über die einzelnen, meist kurzen Texte gesetzt, sie sind jedoch nicht streng chronologisch angeordnet. In einem Liveticker aus der Zeitungsredaktion, in der Irma arbeitet, lesen wir – dem Gesetz solch eines Tickers gemäß – die neueste Meldung zuerst und erfahren dann erst nach und nach ihre Vorgeschichte.
Im Kapitel „Bahnen“ befinden sich Kilometerangaben über den einzelnen Texten, aber auch diese Zahlen sind nicht fortschreitend angeordnet. Als bildete die gegen die „Lokalität“ – der Grundannahme der klassischen Physik, nach der Vorgänge unmittelbare Auswirkungen nur auf ihre direkte räumliche Umgebung haben – verstoßende Quantenmechanik eine Art Hintergrundstrahlung. Im Umgang mit der Zeit könnte die Autorin ein anderes bekanntes Zitat Albert Einsteins illustrieren wollen: „Der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist für uns Wissenschaftler eine Illusion, wenn auch eine hartnäckige.“
Ohne äußeres Ordnungsgerüst
Mit dem äußeren Gerüst der Einteilung des Romans in Kapitel (oder Teile) und Überschriften zu den kurzen Texten scheint die Autorin mit dem Bedürfnis der Welt nach Ordnung ihr Spiel zu treiben. So sind beispielsweise im Teil 2 („Reset“) über die Texte mathematische oder physikalische Formeln und kryptische Zeichen gesetzt, die teilweise dem Nicht-Experten unmittelbar einleuchten, zum Teil aber auch physikalische Kenntnisse oder aber eine Liebe zu pataphysischen Scheinlösungen voraussetzen. Wie zum Beweis, dass sie auch ohne ein äußeres Ordnungsgerüst auskommt, fügt die Autorin zwei Teile ohne Zwischenüberschriften ein, die ebenfalls sehr gut funktionieren: Teil 4, der „Gegen den Raum“ bezeichnet ist, und den achten Teil, dem das mathematische Unendlichzeichen, die „liegenden Acht“ voransteht.
Doch alle acht Teile – ob mit oder ohne Überschriften – beweisen die innere Harmonie des gesamten Romans, wunderbare Wechselspiele, verblüffende Korrespondenzen; sie zeigen, wie sehr die Autorin ihren Figuren und der Kraft ihrer eigenen Sprache vertrauen darf. Erscheint die Anordnung der einzelnen Geschichten mitunter willkürlich – sie gehören doch zusammen wie die Wörter auf einem Zettel, der in einem Einkaufswagen im Supermarkt liegen geblieben ist. Mögen die Leserinnen oder Leser ein Kochrezept daraus ableiten. Bei Spukhafte Fernwirkung lohnt sich detektivisches Lesen ganz besonders; es gibt in dem Buch viel zu entdecken.
Einordnung
Auch wenn der Roman den Wunsch nach Festlegung immer wieder lustvoll zu hintertreiben scheint, soll hier eine kurze Einordnung versucht werden, mit was für einer Art Roman wir es zu tun haben. Vorweggenommen: Das Buch ist unvergleichlich und ihre Autorin sehr erfinderisch. Andere Romane mögen ihre Wirkung daraus beziehen, dass die Lesenden einer Romanfigur über eine längere Strecke folgen, Empathie empfinden oder sich gar teilweise mit ihr identifizieren. Bei U. A. Bleiers Figuren ist Identifikation gar nicht nötig, um das Interesse über 410 Seiten wachzuhalten. Das schafft die Autorin mit ihrer Sprache. Die Figuren werden von außen betrachtet; es gibt keine Erzählerin, die sich in ihre Gedanken einschleichen würde, es wird nicht personal erzählt. Zeitweise nimmt die Erzählerin eine geradezu olympische Position ein, etwa wenn sie in die Zukunft blickt und weiß, wie lang eine Person eine andere überleben wird. Die Figuren sind kaum durch eigene Sprechweisen unterschieden – außer vielleicht Irma.
Es ist kein psychologisierender Roman; ist es ein soziologischer Roman, ein Gesellschaftsroman? Vielleicht, jedoch fern des Naturalismus; keine Studien prekärer Lebensverhältnisse, wenngleich manche der Figuren sich in solchen befinden. Wo hätten wir in der Literaturgeschichte schon einmal Vergleichbares gelesen? In John Dos Passos‘ Manhattan Transfer (1925) vielleicht, der ebenfalls ein breites gesellschaftliches Panorama entwickelt – in diesem Fall der Großstadt New York? Ulrike Anna Bleier hat im Vergleich dazu die Figurenvielfalt bei weitem gesteigert und fokussiert weniger einzelne Schicksale; außerdem lässt sie sich keineswegs auf ein Generalthema festlegen – wie bei Dos Passos etwa das Leiden seiner Figuren unter dem Moloch Manhattan. Bleiers Ort Lasslingen ist universell, und das Dazwischen, die Wegstrecken, die „Nicht-Orte“, sind mindestens ebenso wichtig.
Keine bekannten Muster
Was andere Autorinnen und Autoren als dramatische Höhepunkte präsentiert hätten, passiert bei U. A. Bleier fast nebenbei, als ginge es weniger um die Geschichten als um das Universum, in dem sie spielen. Keine Romanhandlung, die zielgerichtet wäre, keine Spannungsbögen, keine plot points wie in einem Drehbuch; man kann die Stories weder als „character driven“ noch als „plot driven“ bezeichnen; sie sind so ganz ohne die gängigen Konstruktionsanleitungen für einen „verdammt guten“ Roman geschrieben und fügen sich dabei doch zu einem verdammt guten Roman zusammen, ja, zu einem Ausnahmewerk. In der Epoche des Sturm und Drang hielt man für Autoren, die sich über jegliche Regelpoetik hinwegsetzten und dabei Außerordentliches zustande brachten, den Begriff des Originalgenies bereit. Den dürfte die Autorin Ulrike Anna Bleier allerdings nicht auf sich beziehen wollen, schon aus Skepsis gegenüber (meist maskulin konnotierter) Selbstherrlichkeit. Überhaupt müsste man auf Pathos verzichten, um der Autorin gerecht zu werden, denn Pathos passt nicht zur Sprache ihrer bisher erschienenen drei Romane. Der Modus, in dem hier erzählt wird, ist nüchtern, ohne langweilig, lakonisch, ohne zynisch zu sein, und erzeugt dabei einen Sog, der die Lesenden in das Buch hineinzieht.
Kühne Sätze klingen nach Freiheit
Aber lassen wir doch die Autorin endlich selbst zu Wort kommen. Welches der zahlreichen Beispiele ihres Stils sollte man da wählen? Vielleicht gleich eines aus den ersten Seiten: Einmal sagt Marius, was wolltest du eigentlich sagen heute Morgen, wieso was, sagt Irma, und Marius, vorhin in der Konfi, meine ich, ich meine, hattest du einen Vorschlag, war nicht, sagt Irma dann, so wichtig, und Marius schaut sie komisch an, von der Seite her, und Irma registriert es, aber tut so, als habe sie es nicht, auch für sich selber hakt sie es ab, und auch das registriert sie. (S. 19/20)
Bei Ulrike Bleier klingen grammatisch kühne Sätze nach Freiheit und nach Emanzipation von vorgegebenen Ausdrucksmitteln. Missachtung guter Ratschläge zum Verfassen verdammt guter Romane, wie sie die Schreibschulen im Dutzendpack liefern, ist aber noch lange kein Garant für ein außergewöhnliches Werk. Etwas Wesentliches muss hinzukommen. Aber was? „Wenn manche mystische Kunstliebhaber, welche jede Kritik für Zergliederung, und jede Zergliederung für Zerstörung des Genusses halten, konsequent dächten: so wäre Potztausend das beste Kunsturteil über das würdigste Werk. Auch gibts Kritiken, die nichts mehr sagen, nur viel weitläuftiger“, schrieb Friedrich Schlegel im 57. seiner Kritischen Fragmente.
Über einen Platz in der Literaturgeschichte entscheiden weder Kritiker noch hohe Verkaufszahlen (die der Autorin und dem mutigen lichtung verlag aus Viechtach allerdings zu wünschen wären). Literaturwissenschaftler erkennen den Rang eines Werkes meistens erst mit jahrzehntelanger Verspätung. Sollte Spukhafte Fernwirkung aber vergessen oder übersehen werden – umso bedauerlicher für die Literaturgeschichte.
Der Roman ist ein Fluss ohne Ufer, der in alle Richtungen weiterlaufen könnte; ein Anschreiben gegen jede Festlegung und eine Feier des fließenden Lebens. Die Texte könnten ohne die Buchdeckel (Hardcover), die es begrenzen, fortgesetzt werden. Ein offenes, endloses Schreiben. Potztausend ist so überhaupt kein Wort, das auf Ulrike Anna Bleiers Roman passen würde. Aber mit einem modischen „Wow!“ möchte man ihn ebenso wenig abspeisen. In ihrer Sprache ist Ulrike Anna Bleier auf der Höhe der Zeit. Wäre doch nur unsere Zeit auch auf ihrer Höhe.
Ulrike Anna Bleier: Spukhafte Fernwirkung. Roman, lichtung Verlag, Viechtach, 2022, Hardcover, 416 S., 24 Euro.