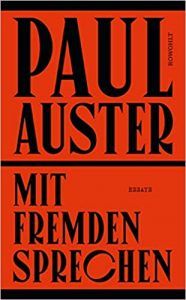„…weil man keine Wahl hat“ – ausgewählte Essays von Paul Auster aus 50 Jahren
„New-York-Trilogie“, „Brooklyn-Revue“, „Buch der Illusionen“, „Nacht des Orakels“: Die Liste der Romane, mit denen der amerikanische Schriftsteller Paul Auster seit Jahrzehnten ein großes Publikum erreicht, ist lang. Zuletzt veröffentlichte Auster unter dem Titel „4,3,2,1“ sein 1200-seitiges Opus Magnum. Jetzt hat er „Ausgewählte Essays und andere Schriften aus 50 Jahren“ zusammengestellt. Titel: „Mit Fremdem sprechen“.
Zwar sind einige Texte bereits im Band „Die Kunst der Hungers“ (2000) hierzulande veröffentlicht worden, aber die Hälfte (22 von 44) sind „Deutsche Erstveröffentlichungen“. Mit dem Begriff „Essay“ sollte man großzügig sein, denn eigentlich versucht Auster in den meisten kein Problem oder Thema einzukreisen, sondern sich selbst als Leser und Autor in Beziehung zu setzen zu einem anderen Künstler. Er überprüft Leben und Werk dieser Künstler darauf, was sie für ihn und für seine Art des Denkens und Schreibens bedeuten, was er dabei gelernt hat und für sein Werk fruchtbar machen konnte, das ja vor allem auf zwei Grundpfeilern steht: Das Leben besteht aus Zufällen und Literatur spiegelt nicht die Welt und erklärt nicht die Realität, sondern schafft mit Sprache eine eigene Wirklichkeit.
Auster ging nach seinem Literatur-Studium an der Columbia University in New York von 1971 bis 1974 nach Frankreich, versuchte sich als Lyriker und Übersetzer, schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch und entdeckte die europäische Literatur. In den Beiträgen, die er damals für Zeitschriften und Anthologien schrieb, beschäftigt er sich mit Baudelaire und Mallarmé, Apollinaire und Artaud, Samuel Beckett, Franz Kafka, Paul Celan, Hugo Ball, Knut Hamsun. Manchmal auch schaut er auf die amerikanischen Klassiker, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allen Poe, Henry David Thoreau.
Schreiben ist Askese und manchmal Raserei
Leben und Werk von Frauen scheinen ihn nicht zu interessieren, um sich als ein Autor zu definieren, der in der Tradition der europäischen Moderne steht, der mit Postmoderne, Poststrukturalismus und Psychoanalyse bestens bekannt ist und sich im „Hungerkünstler“, wie er bei Hamsun oder Kafka auftaucht, wiedererkennt. Schreiben ist für ihn Ausdruck von Askese und Verzicht, ist schiere Notwendigkeit und trägt Züge des Irreseins, transportiert Momente der Raserei. Kunst ist ein ständiger Kampf mit der Einsamkeit, Schreiben ist ein Überlebensmittel. Sprache ordnet die Erfahrung und schafft eine eigene Wirklichkeit: „Von Sprache entfremdet zu sein“, schreibt er, „ist nichts anderes, als seinen Körper zu verlieren. Wenn dir die Worte versagen, zerfällst du in ein Bild von Nichts. Du verschwindest.“
Politische Beobachtungen nur am Rande
Der politische Beobachter Paul Auster kommt nur am Rande vor. Es gibt nur ein paar kleine Zwischenrufe. Einmal betet er für Salman Rushdie und ruft zur Solidarität mit dem damals von islamischen Fundamentalisten mit dem Tode bedrohten Autor auf; ein anderes Mal beobachtet er einen Mann, der durchs soziale Raster gefallen ist, der alles verloren hat und in einem Pappkarton haust; einmal erinnert er sich an den damaligen New Yorker Bürgermeister Giuliani, der eine provokative Ausstellung britischer Kunst verbieten lassen will, daran, dass Amerika eine Demokratie ist, in der Meinungs- und Kunstfreiheit herrscht.
Am Tage der Terroranschläge vom 11. September sitzt Auster nachmittags wie betäubt in Brooklyn am Schreibtisch und notiert: „Der Wind weht heute Richtung Brooklyn, und der Brandgeruch hat sich in allen Zimmern des Hauses festgesetzt. Ein entsetzlicher, beißender Gestank: brennende Kunststoffe, Stromkabel, Baumaterialien, eingeäscherte Leichen. (…) Es gibt kein Beispiel für das, was heute geschehen ist, und die Folgen dieses Anschlags werden zweifellos furchtbar sein. Mehr Gewalt, mehr Tod, mehr Schmerz und Leid für alle.“ Auster sollte recht behalten.
„Zweifellos eine seltsame Art, sein Leben zu verbringen“
„Mit Fremden sprechen“ hat Auster seine Rede überschrieben, die er zur Verleihung des Prinz-von-Asturien-Preises 2006 in Oviedo gehalten hat. Er versucht zu ergründen, was ihn um- und antreibt, warum er mit den Lesern, die er meistens gar nicht kennt und ihm völlig fremd sind, meint sprechen zu müssen: „Ich weiß nicht“, schreibt Auster, „warum ich tue, was ich tue. (…) Zweifellos eine seltsame Art, sein Leben zu verbringen: Allein in einem Zimmer sitzen, einen Stift in der Hand, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr, mühsam Worte zu Papier bringen, um etwas entstehen zu lassen, das es nicht gibt – außer im eigenen Kopf. Warum nur sollte jemand so etwas tun wollen? Die einzige Antwort, die ich darauf gefunden habe, lautet: weil man muss, weil man keine Wahl hat.“
Wir aber haben die Wahl: Wir können, indem wir seine Bücher lesen, ein Zwiegespräch mit ihm beginnen. Wir sollten es tun. Denn es gibt kaum einen anderen Autor, der uns so viel zu sagen hat und uns auf so viele neue Ideen bringt.
Paul Auster: „Mit Fremden sprechen.“ Ausgewählte Essays und andere Schriften aus 50 Jahren. Aus dem Englischen von Werner Schmitz, Robert Habeck, Andrea Paluch, Alexander Pechmann und Marion Sattler Charnitzky. Rowohlt Verlag, 412 Seiten, 26 Euro.