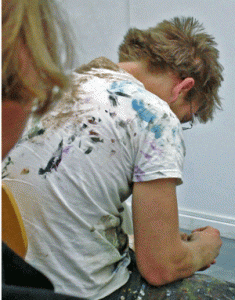Die Lecture-Performance (oder so)
Mein Fehler. Ich habe mir den falschen Platz gesucht: Damit sich die später Eintreffenden nicht an mir vorbei schieben müssen, hatte ich mich in die Mitte einer Stuhlreihe gesetzt statt an den Rand. Und weil der Sprecher so prominent ist und ich ihn aus nächster Nähe bestaunen wollte, auch noch ganz vorne. Da sitze ich nun und kann nicht anders. Könnte ich anders, hätte ich mich nach ca. zwanzig Minuten geschlichen, und zwar in der Überzeugung, dass der Vortrag später sicher gut geworden wäre, ich aber mal wieder zu ungeduldig war. Aufgrund dieses Schuldbewussteins wäre der prominente Dozent in meiner Achtung gestiegen. Eingeklemmt aber zwischen LeidensgenossInnen bleib ich sitzen, hauptsächlich, um keinen Massenexodus loszutreten. Also erleide ich die ungekürzte Fassung eines Dramas. Und zwar in Großaufnahme – mit allen mimischen und gestischen Feinheiten.
Ihr braucht übrigens gar nicht runter zu scrollen, um herauszufinden, um wen es geht: Ich sag’s nicht. Weniger um ihn nicht zu blamieren, als vielmehr mich selbst, die ich eine brillante Performance nicht als solche erkannt habe. Schließlich hat der Mann Ausstellungen in namhaften Institutionen, und Texte in namhaften Publikationen. Im Kontrast zum analytischen Umfeld, in dem seine Prosa erscheint, wirken seine Beiträge immer so anekdotisch und assoziativ, dass ich diesen Mut zur Abweichung für Konzept gehalten und daher die Gelegenheit ergriffen hatte, den als Autor und Künstler gehandelten Verfasser leibhaftig zu sehen.
Der Abend fängt vielversprechend an, nämlich mit der Erzählung eines GaUs: Kurz vor Fertigstellung eines Katalogtextes war sein Computer eines Morgens nicht mehr aufgewacht und auch durch hartnäckige Wiederbelebungsversuche nicht wiederherzustellen. Der Mann wird meines ungebremsten Mitgefühls teilhaftig und durch Tränen umflorte Augen sehe ich ihn mit DIN A-1 großen Bögen zusammengeklebter Seiten wedeln, von denen er Passagen vorliest. Ich kann nicht ganz folgen, habe ständig den Eindruck, zentrale Erläuterungen zu verpassen und ärgere mich über meine Unkonzentriertheit. Der Zusammenhang der thematisch abwechslungsreichen Textauszüge will sich mir nicht erschließen, zumal jede Episode nach wenigen Sätzen durch ein abruptes „whatever“ endet.
Ja, er spricht Englisch, wir befinden uns schließlich in einer international renommierten Kunsthochschule, und daher wäre mir das nicht weiter aufgefallen.
Wenn er denn Englisch spräche. Sein derzeitiger Lebensmittelpunkt („lives and works in NY“ – of course) scheint ohne nennenswerte Folgen für seine Sprachkompetenz geblieben zu sein. Wahrscheinlich wünschen die englischsprachigen Studierenden ebenfalls, er möge Deutsch sprechen – das wäre auch für sie einfacher.
Ein konsequent auf die imposanten Collagen gerichteter Blick und eine Art selbstversunkener Sprachmelodie vereinfachen die Rezeption nicht.
Spätestens seit der Schilderung irgendeines Morgens danach, da er beabsichtigte, sich vom Boden zu erheben, infolge erhöhter Alkoholzufuhr aber schließlich davon absah und stattdessen Katzenfutter verzehrte, dämmert mir, dass ich wohl besser meine Erwartung korrigieren und vom Vortrags- in den Performance-Modus umschalten sollte.
Darin bestätigen mich die mit bewundernswerter Konsequenz eingehaltenen Sprechpausen, während der er die Bögen nach weiteren lesenswerten Passagen durchsucht. Auf DIN A-1 kann das dauern. Aber nicht erst seit Cage wissen wir um die bewusstseinserweiternden Folgen des auf die eigenen akustischen Hervorbringungen verwiesenen Publikums. Diszipliniert bemühe ich mich also um die Überwindung der Trennung von Subjekt und Objekt, indem ich Performer und Performte, äußeres Geschehen (überschaubar) und inneres (zunehmende Unruhe) als Werk begreife und beflissen meine passive Erwartung warenförmigen Kunstkonsums reflektiere.
Die anderen Insassen verfahren ähnlich. Zwar verzeichne ich ein leichtes Ansteigen des Verbrauchs alkoholischer Getränke (Biertrinken bei Lectures ist hier normal. In diesem Ateliergebäude kommen die Zuhörenden schließlich direkt von der Arbeit und machen es sich daher erst mal gemütlich), aber anders als bei theorielastigen Events wie Symposien und dergleichen ist die dort unablässige Pflege sozialer Netze per Telefon zumindest nicht sichtbar.
Der einzige, der bereits nach zehn Minuten mit dem Sortieren des Posteingangs beginnt, ist der Rektor der Schule. Der zweite anwesende Professor hingegen hat im gleichen Zeitraum die erste Flasche Bier beendet und unterbricht anschließend, eine der choreografisch wirkungsvollen Schweigephasen mit der Frage, ob er vielleicht eine Frage stellen solle. Hält er etwa die konsequente Brechung unserer Wahrnehmungsgewohnheiten für ein Zeichen mangelnder Vorbereitung? Aber gern dürfe er das, freut sich der Redner, geht dann aber auf die ihm angebotenen Stichworte offenbar nicht zur vollsten Zufriedenheit des Professors ein, der daraufhin voll Adrenalin induzierter Dynamik hochschnellt und den Raum verlässt.
Nee, Jungs, so geht’s nicht, denke ich. Überlegt euch besser vorher, und vorher besser, wen ihr einladet, und sitzt es dann aus. Meine Polemik war voreilig, denn schnell kommt die Koryphäe wieder rein, in der Hand eine zweite Bierflasche, offenbar entschlossen, sich den Vortrag schön zu trinken.
Die StudentInnen sehen das entspannter. Zustimmendes Lachen erklingt, als der Referent von seiner Ambition berichtet, wissenschaftliche Texte in dafür vorgesehenen Magazinen zu unterzubringen, seinen diesbezüglichen unwissenschaftlichen Bemühungen und der daraus abgeleiteten Erkenntnis, gewisse US-amerikanische Kunstfreunde hätten doch irgendwie Recht: Texte haben in „Kunst“ nichts verloren, und wenn doch, komme es nicht so sehr drauf an, was drin stehe, solang das Layout stimmt. The medium sei nämlich the message.
Während die kunstschaffende Fraktion Nachsicht übt, hat der vor mir platzierte Rektor inzwischen bemerkt, dass sein diskretes Texten den Vortragenden nicht direkt anfeuert. Er lässt das Telefon verschwinden und versteinert fortan zusehends. Als ihm unwillkürlich missbilligende Laute entweichen, sieht sich seine Begleiterin zu de-eskalierendem Tätscheln veranlasst.
Dieweil ich noch immer die konzeptuelle Stringenz dieses Erwartungen unterminierenden Auftritts bewundere, steigert sich der Redner zum Finale. Nachdem er mit Blick auf die Uhr („by the way, what time is it?“) feststellt, dass das Ende naht („oh, seven, that’s good“ – es war acht, aber wer stellt schon gern zweimal jährlich die Uhr um?), woraufhin die chronisch zitternden Finger beim Umklammern einer Zigarettenpackung zur Ruhe kommen, endet er mit einer längeren Erklärung hinsichtlich der Gründe seiner leichten Desorientierung, wobei er das interpunktierende „whatever“ durch rhythmisches „sorry“ ersetzt. Viel gereist, viel Partys nebst der damit einhergehenden Belastungen – und dann die Sache mit dem entschlafenen Computer … Mein oben beschriebene Mitgefühl weicht der gehässigen Überlegung, der Schaden der verlorenen Dateien sei eventuell geringer als befürchtet.
Der Applaus ist lang – fast zu lang, bekommt er doch etwas Tröstendes, geradezu Therapeutisches. Aber lieb, finde ich. Und kaum jemand ist gegangen. Denn trotz lebhaften Verkehrs zwischen Vortrag innen und Bierautomat außen kamen fast alle wieder rein. Nette Studierende.
Ziemlich unverzeihlich hingegen die zwei Hochschullehrer, die den Referenten nach Redeschluss allein erst sitzen, dann stehen und schließlich rausgehen ließen. Sowas macht man nicht. Ich glaub, die müssen an ihrem Kunstbegriff arbeiten.