„Ich träume davon, dass die Sache gut ausgeht“ – zum 25. Todestag des Publizisten Walter Dirks
Walter Dirks, geboren 1901 in Hörde (seit 1928 Stadtteil von Dortmund), ist vor 25 Jahren, am 30. Mai 1991, in Wittnau bei Freiburg gestorben. Er war ein Querdenker, ein wichtiger Publizist der zweiten Hälfte des vergangen Jahrhunderts. Er verzagte nicht, obwohl seine Utopien als „christlicher Sozialist“, der nach 1945 die hessische CDU mitgründete, nie eine Chance hatten, verwirklicht zu werden.
Unserem Gastautor Horst Delkus gab Walter Dirks, der spätere Ehrenbürger der Stadt Dortmund, am 13. Marz 1988 eines seiner letzten Interviews. Wir veröffentlichen es hier in Auszügen:
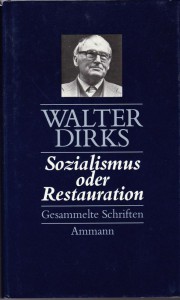
Die gesammelten Schriften von Walter Dirks sind im Zürcher Ammann Verlag erschienen. (Bild: Ammann Verlag/ZVAB)
Herr Dirks, Sie sind jetzt 87 Jahre alt. Was ist Ihre vorherrschende Gemütsbewegung?
Ich muss leider gestehen, dass meine Grundempfindlichkeit Dank ist. Das ist sehr schwer zu verantworten vor den vielen Opfern der Geschichte, vor den vielen Leidenden in aller Welt und vor den ungelösten Problemen. Ich müsste also eigentlich entweder resigniert oder verzweifelt sein. Aber ich habe so viel Gutes erfahren in meinem Leben, von Menschen und vom lieben Gott, dass ich bekennen muss, dass das Grundgefühl Dankbarkeit ist.
Woher rührt dieses Grundgefühl?
Aus den guten Erfahrungen, die ich mit dem Leben gemacht habe. Trotz der großen Schwierigkeiten, die es manchmal gab. Ich habe einen großartigen Start gehabt durch meine Eltern und meinen Großvater. Ich habe einen etwas komplizierten Jugendweg gemacht, aber das ging dann durch die Jugendbewegung gut aus, diese kritische Jugendzeit. Und ich habe beruflich Erfolg gehabt und niemals ernsthafte Schwierigkeiten.
Ein Sonderkapitel ist das Dritte Reich. Das war natürlich eine sehr schwierige Zeit, aber sie ist ja überwunden worden. Ich kann da nicht gegen an, gegen diese Dankbarkeit. Sie überfällt mich stufenweise. Dazwischen habe ich auch Perioden, in denen ich auch deprimiert bin.
Wie sah ihr Lebensweg aus?
Zunächst die Kindheit in Hörde selbst. Mein Großvater war ein „Bauerndemokrat“, ein Bäcker-Bauernsohn, der uns beibringen wollte, dass der 1868 Krieg zwischen Österreich und Preußen falsch verlaufen sei, weil leider nicht die Österreicher gewonnen hätten sondern die militaristischen Preußen in Berlin. Meine Mutter war eine Sozialarbeiterin, eine der ersten Fürsorgerinnen der Stadt Dortmund. Sie hat mich sehr in die sozialen und sozialpolitischen Aspekte des Lebens eingeführt und mich auch in Verbindung gebracht mit der Arbeiterschaft in Hörde. Das hat mich mein ganzes Leben lang geprägt.
Bildung gegen die Schule
Es war eine schöne Jugendzeit, obgleich die Penne eine Last für mich gewesen ist. Ich war dort auf dem Königlichen Gymnasium an der Lindemannstraße. Mein Schulfreund und ich haben uns eigentlich gegen die Schule gebildet. Das war auch eine großartige Erfahrung, dass wir in der Musik, in der Literatur unsere eigenen Wege gegangen sind. Die Schule war gleichsam so die Wand, gegen die wir unsere Bälle warfen. Wir fingen sie wieder auf und so kamen wir weiter.
Schwierig war es mit der Sexualmoral der römisch-katholischen Kirche. Die hat mich sehr geplagt. Und ich nehme an, dass die Tatsache, dass ich gestottert habe, mit diesem Problem zu tun hatte. Ich war ein sehr frommer Junge und wurde mit den Sexualproblemen nicht fertig. Das hat mich sehr irritiert.
Dann war die Jugendbewegung selbst für mich entscheidend. Die hat auch bewirkt, dass das Stottern aufhörte, dass ich ein anderes Lebensgefühl bekam. Die hat mich also aufgewühlt bis dort hinaus. Das war ja ein Umbruch, vor allem die antibürgerliche Komponente. Nach dem Krieg gab es auch eine katholische Jugendbewegung. Das war ein Reifungsprozess und ein großer Wandlungsprozess. Der hat mich auch in meinen Beruf geführt: Während ich vorher ein Stotterer war, wurde ich ein Journalist, das heisst, einer der sich einmischt, der mit seiner Rede und mit seinem Wort die Welt verändern will.
Mein erster Beitrag in dieser jugendlichen Presse hieß „Vom Westen“, um den Bayern und Hessen und den Schlesiern klar zu machen, dass wir im Ruhrgebiet ein anderes Lebensgefühl hatten als die Süddeutschen und die Ostdeutschen, durch die Industrielandschaft und das, was sie uns zumutete.
„Grüne vor den Grünen“
Gab es damals eine Aufbruchstimmung?
Unbedingt! Schon dass sich die Jugendbewegung entschieden als Bewegung verstand und nicht als Organisation. In gewisser Hinsicht sind wir sozusagen Grüne vor den Grünen gewesen. Das fing ganz bescheiden an, dass wir eben auf Wanderungen sorgfältig unser Butterbrotpapier versteckten im Waldboden, um den Wald nicht zu entweihen. Dann eben die Naturnähe zu den Pflanzen und zu den Tieren. Sodann eine Verhalten, das auf Änderungen zielt, auf Reformen. Eine Orientierung weniger auf die Vergangenheit als auf die Zukunft.
Wir waren geneigt, den Kapitalismus sehr gründlich zu kritisieren. Und wir dachten schon damals in Richtung auf einen freien Sozialismus, einen demokratischen Sozialismus, auf eine Überwindung des Klassenkampfes durch eine radikale Reform der Gesellschaft. Und der Gedanke des Friedens hat uns sehr beschäftigt. Es ging ja auch damals darum, den Ersten Weltkrieg zu „verdauen“.
Die Endlichkeit der Nazizeit
Wie haben Sie als Journalist in der Nazizeit mit Anstand überwintern können?
Ich war überzeugt, dass das Regime zwar einige Zeit dauern würde, aber dass es sich nicht auf Dauer halten könne. Das hatte drei Ursachen. Einmal das Stück Naturrecht: Der liebe Gott hat die Menschen nicht zu Katastrophen bestimmt. Die menschliche Natur ist nicht so, dass sie so eine verrückte Diktatur so auf die Dauer aushält. Das war zweitens mein christlicher Glaube an den Heiligen Geist, der die Menschheit auch nicht endgültig verlassen werde und drittens das, was ich vom Marxismus gelernt habe, dessen Geschichtstheorien, dessen politische Theorie. Diese Dinge haben sich sehr verbündet miteinander und deswegen war ich immer sicher, dass es zu Ende gehen würde.
Gerade diese Haltung hat mir auch eine gewisse Bewegungsfreiheit gegeben, denn es würde ja zu Ende gehen. Deswegen war meine Formel, wir müssen versuchen mit Anstand zu überleben. Das ist mir in weitgehendem Maße, aber doch nicht völlig gelungen. Ich meine, dass es meine Aufgabe wäre, auch meine Fehler und meine Schwächen von damals aufzudecken. Es gehört sich, dass man die Karten auf den Tisch legt.
Da ist auf der einen Seite die Periode bei der „Frankfurter Zeitung“. Die glaube ich rechtfertigen zu können. Die Nazis verlangten nicht von uns, dass wir Nazis waren. Aber riskiert haben wir im Feuilleton auch nicht allzu viel. Als die Zeitung geschlossen wurde, gehörte ich zu den elf Leuten, die Berufsverbot bekamen, während die anderen an andere Zeitungen vermittelt wurden.
Journalismus ist im Kern Kritik
Zurückblicken können Sie auf eine jahrzehntelange journalistische Tätigkeit. Wie würden Sie Ihr journalistisches Selbstverständnis beschreiben?
Ich hab dafür einmal eine Formel gefunden: Das Geld der Macht, der Reiz der Macht, der Erfolg der Macht, die Macht der Macht u n d `ne gute Presse – das ist zu viel verlangt. Der Kern des Journalismus ist für meinen Begriff „Kritik“. Kritik an der ersten, zweiten und dritten Gewalt. Vielleicht noch mit einem anderen zusammen: „Vermittlung“. Das dämpft ein wenig die Einseitigkeit der Kritik. Diese zweite Funktion erscheint mir, darin zu bestehen, dass sie dem Publikum, dem einzelnen Menschen, dem Staatsbürger helfen soll, unabhängig machen soll von dem Fachmann, sie schützen soll vor der Übermacht der Experten.
Journalisten sind Vermittler zwischen der Wissenschaft, zwischen dem, was auf anderen Gebieten Experten sagen und dem kleinen Mann. Das ist so eine produktive Funktion neben der kritischen, wobei es natürlich eine Arbeitsteilung geben kann: Der eine Journalist hat mehr die eine Funktion auf sich genommen, der andere die andere.
Sie haben viele Niederlagen erlebt. Warum hat sie das nicht völlig entmutigt?
Wir sind mehrere Male gescheitert: 1933, 1945, mit der Währungsreform, wir haben Adenauer nicht verhindern können. Die Versuchung ist, dann zu sagen: Es war alles für die Katz! Das bringe ich aber nicht fertig, dieser Versuchung Raum zu geben. Ich habe immer mit dem Bösen und den negativen Möglichkeiten gerechnet. Das hab ich aber in der Schule schon gelernt, dass man kämpfen muss für das Gute gegen das Böse. Ein elementare Grundmoral. Und die möchte ich durchhalten bis zum Schluss. Optimismus hat eine Menge von Gefahren in sich: Gleichgültigkeit, Tatenlosigkeit, falsche Zufriedenheit und so weiter. Aber ich bin einer, der auf die gute Karte setzt. Und dabei möchte ich bleiben. Ich träume davon, dass die Sache gut ausgeht!