Die Masse als politischer Akteur: Zum 100. Geburtstag Gottfried von Einems zeigt Magdeburg seine Oper „Dantons Tod“
Am 24. Januar 1918, vor 100 Jahren, erblickte in Bern einer der bekanntesten Komponisten der fünfziger und sechziger Jahre das Licht der Welt: Heute nur noch Insidern der Operngeschichte ein Begriff, entfaltete Gottfried von Einem nach der Uraufführung seiner Oper „Dantons Tod“ in Salzburg das musikalische Nachkriegs-Leben in Deutschland und Österreich entscheidend mit. Magdeburg würdigt nun als bisher einziges deutsches Opernhaus von Einem mit einer Premiere seines erfolgreichen Opern-Erstlings von 1947.
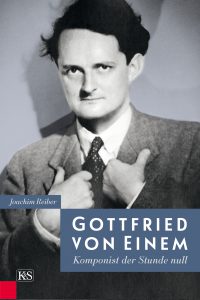
Beim Wiener Verlag Kremayr und Scheriau erschienen: Joachim Reibers Biografie des Komponisten Gottfried von Einem. Coverabbildung: Verlag
Von 1948 an hatte Gottfried von Einem als Mitglied des Direktoriums der Salzburger Festspiele – mit Unterbrechung bis 1964 – weitreichenden Einfluss, gestützt durch seine hervorragende Vernetzung, unter anderem mit der Familie Wagner, den Komponistenkollegen Boris Blacher und Werner Egk oder dem in vielen Bereichen aktiven Rolf Liebermann.
Die Opern „Der Prozess“ nach Franz Kafka (1953) und „Der Besuch der alten Dame“ nach Friedrich Dürrenmatt (1971) sicherten dem eher konservativ eingestellten, der neuen Musik der Schönberg-Schule und der Darmstädter Kreise abholden „Componist“ – so die Selbstbezeichnung – einen festen Platz auf den Spielplänen der Opernhäuser, den er erst nach seinem Tod 1996 langsam einbüßte.
Mit „Jesu Hochzeit“ auf ein mystisch-esoterisches Libretto seiner zweiten Frau, der Schriftstellerin Lotte Ingrisch, verursachte von Einem 1980 in Wien einen veritablen Opernskandal. Gottfried von Einem verstand es, sich einerseits mit den Verhältnissen während des Dritten Reiches äußerlich zu arrangieren, half aber auch, Juden zu schützen und wurde daher 2002 posthum als „Gerechter unter den Völkern“ ausgezeichnet. In Deutschland und Österreich galt von Einem dank seiner Oper „Dantons Tod“ als „Komponist der Stunde Null“ – eine Bezeichnung, die heute angezweifelt wird, etwa in der neuesten Biografie von Joachim Reiber.
Bogen von der Französischen Revolution bis zur NS-Diktatur
Die Vorlage zu von Einems Oper, Georg Büchners „Dantons Tod“ lässt sich von vielschichtigen Zeitebenen aus lesen: Da ist das Stück über die Französische Revolution, zugespitzt auf ein paar Wochen des Jahres 1794. Da ist der Blick des jungen, unruhevollen Geistes auf Danton, Robespierre, Saint-Just, Desmoulins und ihre Gefolgschaften aus der Perspektive der restaurativen Gesellschaft der 1830er Jahre in Deutschland, eingespannt zwischen brutaler Unterdrückung des politischen Lebens und gärendem Freiheitswillen. Da ist die illusionslose Realität des Polizeistaats Hessen-Darmstadt, in dem Büchner ein System von Bespitzelung, Willkür und Gewalt am eigenen Leibe erfährt. Und da ist, unvermeidlich, der Blick der eigenen Gegenwart auf den historischen Stoff.

Noa Danon als Lucile in „Dantons Tod“ von Gottfried von Einem in Magdeburg. Foto: Kirsten Nijhof
Gottfried von Einem zieht noch einmal eine Ebene ein: Unverkennbar reflektieren er und sein Librettist Boris Blacher – selbst ein begabter Komponist – die zwölf Jahre der braunen Diktatur. Das geschieht nicht direkt, sondern wirkt subtil, dem schnellen Blick kaum bemerkbar. Aber die Masse als politischer Akteur und gleichzeitig Material in den Händen weniger Demagogen, das „Volk“ als Faktor der ideologischen Auseinandersetzung führt über Büchner hinaus.
Gottfried von Einem hat mit dem Werk kurz nach dem Attentat auf Hitler 1944 begonnen. Er selbst beschreibt die Situation als „unerträglichen Druck“, unter dem wie er Millionen Menschen standen: „Ständige Spannung, Schrei nach Erlösung von ihr.“ Wie gebannt sei er unter dem Zwang des Stoffes gestanden: „Das Werk brannte ab mit mir, mit meiner Musik.“
In Magdeburg tut Intendantin Karen Stone gut daran, die Handlung nicht eindeutig zu verorten, weder im Paris des 18. Jahrhunderts noch im Ambiente einer der Diktaturen der Gegenwart oder jüngeren Vergangenheit. Die Szene von Ulrich Schulz, eine Brücke aus kaltem Metall, flankiert von zwei Treppen, öffnet oder schließt je nach Bedarf einen flexiblen Spielraum, der sich mit einer Tapete mit französischen Lilien in einen Wohnraum oder mit einem hochgefahrenen Lichtkäfig in ein Gefängnis verwandeln lässt. Auch Requisiten und Kostüme spielen mit den Zeitebenen, lassen an Barock, 68er oder die uniformierten Einheitsschnitte östlicher Diktaturen denken.
Inszenierung rückt Rolle der Massen in den Mittelpunkt
Stone rückt in ihrer Inszenierung die Rolle der Massen in den Mittelpunkt. Unterstützt von Choreograph David Williams sucht sie den Weg zu stilisierter Aktion, die der Falle des so gut wie immer unglaubwürdigen Bühnen-„Realismus“ entgeht. Das gelingt nicht durchweg: Die zweite Szene, in der ein junger Adliger (Peter Diebschlag) gelyncht werden soll, sieht ein wenig aus wie eine schlechte Victor-Hugo-Verfilmung.
Aber wenn Stone bei den großen Reden Robespierres und Dantons das Volk wie in Trance wandeln lässt, wenn sie in der Gerichtsszene des zweiten Teils den unheimlichen Sog zeigt, der jede Individualität von den Einzelnen abzieht, machen die gleichgeschalteten Bewegungen dieser Marionetten und ihre mechanischen Reaktionen auf den Bann der Macht deutlich, wie wenig sich der Einzelne, und sei er ein mutiger Revolutionär wie Danton, der Wucht der Masse entziehen kann.
„Wir sind das Volk und wir wollen, dass kein Gesetz sei …“ skandiert eine zwielichtige Menge. Robespierre schafft es, die ungeordnete Menschenschar in Reih‘ und Glied hinter sich zu bringen. „Égalité“ prangt in blutigen Lettern im Hintergrund – und Gottfried von Einems Musik spiegelt das emotional wirksame Pathos, das wir aus den Aufmärschen aller Diktatoren der Welt nur zu gut kennen. Die Statisterie und der von Martin Wagner höchst sicher einstudierte Chor haben diese Szenen bravourös bewältigt und die Faktur der für viele wohl völlig unbekannten Musik bis hin zum „Brüllen“ der Menge anstandslos umgesetzt.
Der „Blutrichter“ zeigt die unheimliche Einsamkeit der Macht
Sobald es um die Rolle von Einzelnen im Getriebe der Revolution geht, wird Stones Regieansatz unschärfer, zeichnet am ehesten noch Robespierre als einsamen Gesinnungstäter durch: Stephen Chaundy färbt seinen Tenor schneidend-gequält, um die eisige Tugend-Ideologie eines Mannes darzulegen, der eine Welt zurücklässt, die er mit den Worten der Bibel für das Chaos vor der Schöpfung beschreibt: wüst und leer. Die unheimliche Einsamkeit der Macht, die glaubt, sie mache sich nicht die Hände schmutzig: Während der Vorhang langsam fällt, zieht sich der „Blutrichter“ der Revolution Handschuhe über.

Szene aus dem zweiten Teil von „Dantons Tod“ im Bühnenbild von Ulrich Schulz. Foto: Kirsten Nijhof
Danton wird im puffigen Pink eines Vergnügungsetablissements als Epikureer eingeführt, für den „liberté“ wohl eher in Richtung eines Libertinismus zu lesen sei: Jeder möge seine Natur ausleben und auf diesem Wege selig werden. Zu wenig, um die markigen Ansprachen zu erklären, mit denen sich Peter Bording später mit beeindruckender deklamatorisch gefasster Stimmwucht zu verteidigen sucht. Johannes Stermann gibt als Saint-Just den „Mann aus dem Volk“, dessen todbringenden Einfluss auf Robespierre und das Tribunal er mit der Gelassenheit des Siegers ausspielt.
Auch Simon (Paul Sketris) ist eine zwielichtige Figur, die mit roter Mütze als Einpeitscher oder williges Echo durch die Szene geistert. Amar Muchhala bemüht sich nach Kräften, mit seinem schlank-klaren Tenor den Alpträumen des traumatisierten Camille Desmoulins im Gefängnis Ausdruck zu geben, wird aber szenisch von der Regie eher allein gelassen.
Eine Oper für Frauen ist „Dantons Tod“ wirklich nicht; dennoch war die Rolle der Lucile bei der Uraufführung in Salzburg mit Maria Cebotari prominent besetzt. In Magdeburg tritt Noa Danon in die Fußstapfen ihrer großen Vorgängerin und erfüllt die entscheidenden Szenen am Ende des dritten und des sechsten Bildes mit Stimmglanz und Gestaltungskraft. Wenn sie über den Leichen das alte Volkslied „Es ist ein Schnitter, der heißt Tod“ anstimmt, fasst sie das Elend des einzelnen Menschen angesichts des grässlichen Fatalismus der Geschichte in einem anrührenden Moment zusammen. Über ihr glänzen die Schlagworte der Revolution auf der Schneide einer riesigen Guillotine im Blut.
Handwerklich sattelfeste Musik
Gottfried von Einems Musik lässt hören, dass sich da jemand mit dem Studium des „strengen Kontrapunkts“ handwerklich sattelfest gemacht hat, bevor er dem Genius der Inspiration freien Flug zugestand. Die hochdifferenziert ausgearbeitete Partitur gebraucht die Mittel des Orchesters sich souverän beschränkend, kammermusikalisch filigran, aber auch mit Gewicht und Klangpracht, wenn es auf (falsches) Pathos oder aufgewühlte Massenszenen ankommt.
Kimbo Ishii und das Magdeburger Orchester widmen sich der Musik mit Klangsinn und Präzision, lassen hören, wie sich von Einem der tonalen Tradition zugehörig fühlt, aber sich auch die Freiheit zu einer Moderne nimmt, die sich nicht an den damals tonangebenden Richtungen zeitgenössischer Musik orientiert.
Schöne Melodie für zwei Henker
Die schönste Melodie erfindet von Einem für die beiden Henker (Frank Heinrich und Alejandro Muñoz Castillo), die nach getaner Arbeit nach Hause gehen: Ganz „normale Männer“, die den schönen Mond besingen – so wie die Hunderttausende von Tätern des Dritten Reiches. Ein Hinweis auf die Gefährlichkeit des deutschen romantischen Gefühls, der schaudern lässt.
Von Einems Oper ist ein Werk kultivierter Autoren für ein gebildetes Publikum, ein kaum dramatisch motiviertes Philosophieren in Musik. Der Hunger nach Geist hat im Jahr 1947 dieses Werk sicher mit Sehnsucht begrüßt. Dass diese Reflektion über die Bedingungen und Grenzen der Freiheit und der an Büchner angelehnte fatalistische Blick auf den Lauf der Geschichte in den achtziger und neunziger Jahren aus der Zeit gefallen schien, ist verständlich. Heute, mit dem Plärren des „Volks“ im Hintergrund, blitzt in „Dantons Tod“ wieder eine Zeit-Aktualität auf, die es lohnend macht, sich jenseits einer Gedenkveranstaltung zum 100. Geburtstag eines verdienten Autors mit dem Stück zu beschäftigen.
Magdeburg war der mutige Vorreiter – die bisher einzige deutsche Bühne, die sich in dieser Spielzeit an von Einem gewagt hat. Es folgt noch „Der Besuch der alten Dame“ in Radebeul am 26. Mai. Wien würdigt von Einem mit der Premiere von „Dantons Tod“ an der Staatsoper am 24. März und von „Der Besuch der alten Dame“ im Theater an der Wien am 16. März 2018.