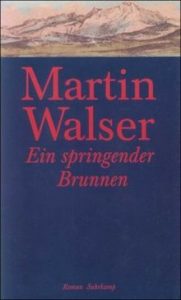Am Quell des Eigensinns – Martin Walsers unverkennbar autobiographischer Roman „Ein springender Brunnen“
Von Bernd Berke
Manche Völker haben gefürchtet, die Fotografie könne den Menschen die Seele rauben. Doch sie vermag vielleicht auch das Gegenteil: Als der fünfjährige Johann – ganz allein, ganz für sich – von einem Wanderfotografen aufgenommen wird und dann dieBilder sieht, erlebt er sich erstmals als abgesondert, aber auch geradezu königlich abgehoben von allen anderen Wesen – kurz: als beseeltes Individuum.
Martin Walser schildert Johanns Wachsen und Werden in seinem neuen, unverkennbar autobiographisch bestimmten Roman „Ein springender Brunnen“.
Wie der Autor selbst, so ist jener Johann 1927 in Wasserburg/Bodensee geboren. Noch bevor der Junge in die Schule kommt, haben die Nazis die Macht an sich gerissen. In drei subtil durchkomponierten Kapitel-Schritten breitet Walser Szenen aus den Jahren 1933, 1938 und 1945 aus.
Hier haben wir einen großen Entwicklungsroman, einen mit prallen Lebensdingen und sinnlichem Dialekt gesättigten Dorfroman – und einen politischen Roman aus provinziellen Bezirken des „Dritten Reiches“.
Walser, der gleichsam zu den Ursprüngen seines Schreibens vordringt, läßt sich nie dazu hinreißen, seine Figuren zu denunzieren, aber er umreißt ihr Tun und Treiben sehr deutlich. Das ist ungleich triftiger, als wenn uns jemand ein wohlmeinendes Heldenepos vorgesetzt hätte. Derlei hätten wir nicht so sehr gebraucht, dies aber ist ein notwendiges Buch.
Streckenweise könnte man argwöhnen, Walser wolle uns ein ländliches Idyll ausmalen, mit Genre-Szenen aus dem Bilderbuch. Ein bißchen „Waldbauernbub“ wie von Rosegger, ein wenig „Lausbubengeschichten“ wie von Thoma? Gewiß nicht! Der Autor läßt zwar ahnen, was „Heimat“ im friedlichen Sinne bedeuten könnte, aber er zeigt, daß gerade in solche Sehnsüchte die Nazi-Ideologie einsickern konnte wie schleichendes Gift. Das trügerische Gefühl wohliger Nähe und des Aufgehobenseins im Dorfe wird immerzu gebrochen.
Als im allzeit verschuldeten Gasthof der Eltern die NS-Versammlungen jede andere Geselligkeit polternd verdrängt haben, erträumt sich der inzwischen zehnjährige Johann eine Gegenwelt im Zirkus, der gerade im Dorf gastiert. Er verguckt sich in die kleine Artistin Anita (eine wundervoll zarte Kinder-Liebesgeschichte!) und beginnt Gedichte zu schreiben. Doch dann wird der Clown, der sich in der Manege ein paar zeitkritische Witze erlaubt hat, von braunen Horden halbtot geprügelt.
Aus sprachlichen Differenzen erwächst dichterischer Drang
Dieselbe Verstörung erfaßt Johann, als ein jüdischer Mitschüler aus dem NS-Jungvolk“ ausgestoßen wird. Doch Johann leistet nicht, was denn auch wenig glaubhaft wäre, heroischen Widerstand, sondern hegt statt dessen seine Eigenheiten, um sich innerlich abzusetzen. Gleichzeitig tut er mit bei der Hitlerjugend, und kann es später kaum erwarten, an die Kriegsfront zu kommen. Gerade sein an sich edler Wunsch, sich hilfreich zu bewähren, macht ihn anfällig für Mißbrauch.
Walsers Roman handelt zuinnerst auch von den Bewegungskräften der Sprache. Schon früh hat Johann vom Vater gelernt, kostbare Ausdrücke zu sammeln und anschaulich „in den Wörterbaum“ zu stecken. Für sexuelle Nöte steht zwar in der katholisch-prüden Gegend kein taugliches Vokabular zur Verfügung, eigentlich nur ein onanistisches Stammeln.
Doch auf Dauer erweist sich, daß Johann eben doch ganz andere Wortfelder durchstreift als etwa sein Freund Adolf, Sohn der lokalen NS-Größe Brugger. Bei den Bruggers wird fordernd und kernig gesprochen, niemals sanft und klingend. Aus solchen Differenzen erwächst Johanns im Keim schon dichterischer Drang, landläufige Redensarten überhaupt abzuwehren und solche zu finden, die wahrhaft für ihn selbst gelten – endlich ein Quell des Eigensinns, der Widersetzlichkeit. Schlußsatz des Romans: „Die Sprache, dachte Johann, ist ein springender Brunnen“. Er möge weiterhin reichlich sprudeln.
Martin Walser: „Ein springender Brunnen“. Roman. Suhrkamp-Verlag. 413 Seiten, 49.80 DM.