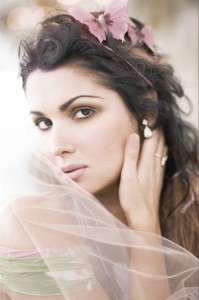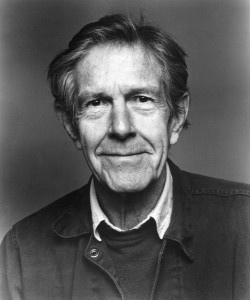Weltgeschichte auf Schilfgras: Für den "Zeitstrahl" von Geoffrey Farmer bilden sich auf der dOCUMENTA Warteschlangen (Copyright: Anders Sune Berg)
Spottet nur, ihr Daheimgebliebenen. Fragt ruhig ironisch, ob schon ein paar selbstbestimmte Erdbeeren oder herrschaftsfreie Hunde aufgetaucht seien, die von der dOCUMENTA-Chefin Carolyn Christov-Bakargiev als Beispiele für einen Themenschwerpunkt der diesjährigen Ausstellung genannt wurden – was prompt einen kleinen Medienwirbel verursachte. Eure Häme kümmert mich nicht. Mich treibt das dringende Bedürfnis nach intellektueller Herausforderung nach Kassel.
Den vorgefertigten Meinungen vieler Medien, die ihre Leser zunehmend für dumm verkaufen, will ich mich lustvoll widersetzen. Ich will mich Neuem öffnen, und wenn dies dazu gehört, gerne auch ratlos vor Installationen stehen, deren Bedeutung sich mir nicht erschließt. Ich will mich wehren gegen das feiste Grinsen, mit denen die Feinde von Kunst und Kultur auf die Fettecke von Joseph Beuys deuten, um dann mit perfider Grobheit zu fragen: „Is dat Kunst, oder kann dat wech…?“
Ganz alleine scheine ich mit solchen Wünschen nicht zu stehen. Bereits zur Halbzeit konnte die dOCUMENTA (13), diese 100 Tage währende Weltausstellung der Kunst, einen Besucherrekord vermelden. Genaue Zahlen sollen erst zum Abschluss am 16. September verraten werden. Indes wurde bekannt, dass die Verantwortlichen mit rund 750.000 Kunsthungrigen rechnen.
An diesem ersten Samstag im August, der sich trefflich auch im Freibad oder im heimischen Garten verbringen ließe, schwärmen die Menschen vom gesichtslosen Areal rund um den Hauptbahnhof aus in die Stadt. Bald schon bewege ich mich im Kielwasser kleiner Gruppen. Im Laufe des Tages wird der Besucherstrom anschwellen, wird mich zum Hugenottenhaus, zum Brüder Grimm Museum, zur Neuen Galerie, in die Karlsaue, zur barocken Orangerie, zur Documenta-Halle, zum Fridericianum und zum Hauptbahnhof führen. Er wird mich treppauf und treppab laufen lassen, das Verlangen nach Essen und Trinken auf später verschiebend, weil das Angebot bei 300 Künstlern so verlockend groß und vielfältig ist, mein Besuch aber leider auf diesen einen Tag beschränkt.
Neugierde, Spannung, aber auch einige Zweifel begleiten die erste Kontaktaufnahme. Wie werden wir miteinander zurechtkommen, die zeitgenössische Kunst und ich? Die erste Tuchfühlung erfolgt im Hugenottenhaus, einem kleineren Veranstaltungsort der diesjährigen dOCUMENTA. Das historische Gebäude zeigt sich von einer gewöhnungsbedürftigen Seite, befindet es sich doch in einem stark fortgeschrittenen Stadium des Verfalls. Leitungen liegen frei, vergilbte Tapeten schälen sich von den Wänden. Große Löcher in Decke und Wänden legen Schichten aus Stroh, Lehm und alten Balken frei, die dem Blick sonst verborgen bleiben. Das Haus zeigt seine Eingeweide her. Aber es gibt hier mehr zu sehen als Spuren vergangenen Lebens. Der 1973 in Chicago geborene Theaster Gates hat das Gebäude mit einer Gruppe von Auszubildenden aus Kassel und Chicago in Besitz genommen. Sie haben primitive Möbel geschreinert, eine Küche eingerichtet, in einem Freiraum neben der Diele sogar eine große Hollywoodschaukel aufgehängt. Die Schlafzimmer sind für Besucher nicht begehbar, stehen ihren Blicken aber offen. Wie kann man leben in dieser „sozialen Skulptur“, wie die Künstler diese Begegnungsstätte nennen? Gibt es eine Ästhetik des Schäbigen? Wo mögen sich die Künstler und Künstlerinnen tagsüber aufhalten? Der Zufall will es, dass eine von ihnen gerade auf ihrem Bett sitzt. Sie kehrt den Besuchern den Rücken zu, wird aber trotzdem fotografiert, als sei sie ein seltenes Tier in einem Zoo.

Schlafstatt und Ausstellungsraum: Theaster Gates und eine Gruppe von Auszubildenden machten aus dem Hugenottenhaus eine "soziale Skulptur" (Copyright: Nils Klinger)
Kurz darauf tappe ich ins Dunkel. Der Raum, in dem eine Performance des deutsch-britischen Künstlers Tino Sehgal stattfinden soll, ist aber nur auf den ersten Blick stockfinster. Wer vorsichtig voran geht, bemerkt bald einen schwachen Schein von einer indirekten Deckenbeleuchtung, die ein Minimum an Sicht erlaubt. Staunend und langsam bewegen sich Menschen durch diesen Raum, der von einem leisen Summton erfüllt ist. Er stammt unverkennbar aus menschlichen Kehlen. Sind es vielleicht die anderen Besucher, die hier leise vor sich hin summen? Oder vielmehr: Sind die Menschen um mich herum denn überhaupt Besucher? Kaum taucht der Gedanke auf, da bricht auch schon die Hölle los: Die vermeintlichen „Besucher“ beginnen laut zu singen und rhythmische Texte zu skandieren. Dazu tanzen sie im Dunkeln nach einer ausgefeilte Choreographie. Plötzlich wälzt sich ein Tänzer auf dem Boden. Die anderen stampfen und toben rhythmisch durch den Raum. Ich fürchte eine Kollision, werde aber nicht einmal gestreift. Ein Sprecher sinniert verwundert über die existenzielle Unzufriedenheit vieler wohlhabender Menschen in den westlichen Gesellschaften. Und plötzlich ist der Spuk vorbei. Die Tänzer schwanken leise wie Rohre im Wind. Nichts bleibt als das Dunkel und der geheimnisvolle Summton.
Verzaubert kehre ich zurück ins Tageslicht. Wie Atréju aus Michael Endes „Unendlicher Geschichte“ habe ich ein Orakel besucht, einer geheimnisvollen Stimme gelauscht und eine Botschaft empfangen, die ich nur halb verstehe. Ich fühle mich zurückversetzt in Kindheitstage, erinnere mich an aufregende Spiele im dunklen Flur des Kellers, die zur Abendzeit nur durch ein Machtwort der Erwachsenen beendet werden konnten. Um einen Kindheitstraum dreht sich auch die Ausstellung „Knights (and other dreams)“ im Brüder Grimm Museum. Dort beleuchtet der Bulgare Nedko Solakov seine kindliche Faszination für Ritter von denkbar vielen Seiten. Das ist erwartungsgemäß verspielt und auch hübsch anzusehen. Gleichwohl resümiert der Künstler hellsichtig: „Ich hätte sie in meinem Kopf behalten sollen, diese Träume. Dort hätten sie wohl glücklich bis an das Ende ihrer Tage gelebt. Vielleicht.“
Ein erster Höhepunkt ist die Neue Galerie. Hier bewundere ich die teils fragilen, teils kraftvoll-bewegten Bronzeskulpturen von Maria Martins und die fröhliche Farbintensität der Bilder von Gordon Bennett, die Muster und Zitate aus der Kunst der australischen Ureinwohner (Aborigines) aufgreift. Eine leuchtend bunte Jukebox hat die US-amerikanische Künstlerin Susan Hiller aufgestellt: In 100 verschiedenen Sprachen und Varianten bietet sie das Lied „Die Gedanken sind frei“ zur Auswahl an. Die dazugehörigen Texte zieren die Wände bis unter die Decke. Eine lange Warteschlange bildet sich im zweiten Stock vor dem spektakulären „Zeitstrahl“ des kanadischen Künstlers Geoffrey Farmer. Es handelt sich dabei um eine 44 Meter lange Collage aus Ausschnitten des amerikanischen „Life“ Magazins, die von 90 Mitarbeitern in filigranster Arbeit ausgeschnitten und auf Schilfgras geklebt wurden. Bilder von Figuren, Menschen und Gegenständen, 50 Jahrgängen des Heftes entnommen, erzählen die Geschichte der Jahre 1935 – 1985 auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Skulpturen von Maria Martins sind in der Neuen Galerie zu sehen (Copyright: Anders Sune Berg)
Nur selten stehe ich an diesem Tag vollkommen ratlos vor einem Kunstwerk. Sogar das auf den ersten Blick Lächerliche ergibt bei näherer Betrachtung Sinn, lädt ein zum Nachdenken über die Vergangenheit oder über den Alltag in fernen Kulturen. Zum Beispiel gibt die 1949 in Zagreb geborene Sanja Ivekovic einer Sammlung von Stoff-Eseln in einer Glasvitrine den Titel „The Disobedient“ (Die Ungehorsamen). Namensschilder weisen die Plüschtierchen als berühmte Personen der Zeitgeschichte aus: Rosa Luxemburg, Martin Luther King und die Geschwister Scholl sind hier versammelt. Ein historisches Foto aus Kassel im Jahre 1944 bildet den Schlüssel zu dieser vermeintlich niedlich-belanglosen Installation: Es zeigt einen Esel, den die Nationalsozialisten in der Stadtmitte von Kassel in Stacheldraht eingezäunt haben, verbunden mit einer Warntafel, dies sei „ein KZ für alle widerspenstigen Staatsbürger“, die nach wie vor bei Juden kauften. Die zwei toten Fliegen, die der thailändische Künstler Pratchaya Pinthong in einer Vitrine ausstellt, verweisen auf den erbitterten Kampf, den die Menschen in seiner Heimat gegen die Tsetsefliege und die von ihr übertragene tückische Schlafkrankheit führen.
Kühne und zugleich kühle Visionen von Technik und Fortschritt beherrschen die große Documenta-Halle. Der deutsche Künstler Thomas Bayrle zeigt dort ein acht Meter hohes und über 13 Meter breites Schwarz-Weiß-Bild eines Flugzeugs, das aus unzähligen kleinen Flugzeug-Bildern zusammengesetzt ist. Am Eingang steht die „Monstranz“, ein feingliedriger Sternmotor, der einst ein tschechisches Saatflugzeug antrieb. Er ist längs durchgeschnitten, sein Inneres ist bloßgelegt, zusammen mit Lautsprechern ist er auf einen stählernen Fuß montiert. Die Maschine läuft, wenn das Stromkabel angeschlossen ist: Gleich wird ihr gleichförmig arbeitender Originalton mit einer vielkehligen Rosenkranzandacht aus dem Kölner Dom zusammenklingen. Der Motor „betet“.

Technik als Religion: Arbeiten von Thomas Bayrle in der Documenta-Halle (Copyright: Anders Sune Berg)
Vermutlich in dem Versuch, möglichst viele Orte in die dOCUMENTA einzubeziehen, werden die Künstler in der Orangerie in der Karlsaue recht lieblos präsentiert. Ihre Arbeiten drücken sich schamhaft in eine Ecke, werden von den ständigen Exponaten nachgerade erschlagen. Die Weiten der Karlsaue zu durchmessen, ist an diesem einen Tag natürlich ganz unmöglich. So entgeht mir der Hundespielplatz für vierbeinige Documenta-Besucher. Die Hunde, die ich an diesem Tag zu Gesicht bekomme, sind erkennbar nicht „herrschaftsfrei“. Auch die glücklichen Himbeeren und Tomaten an einem „Fair Trade“-Stand machen keinen sonderlich politischen oder selbstbestimmten Eindruck. Was im Vorfeld so viel Anlass zum Spott gab, kann andererseits als der durchaus ehrbare Versuch gesehen werden, von einem Weltbild abzurücken, das den Menschen als Maß aller Dinge sieht.
Nach neun Stunden dOCUMENTA bin ich müde, glücklich, voller neuer Eindrücke. Ein Versäumnis fällt mir auf der Heimfahrt plötzlich doch noch ein: Ich habe Hitlers Badewanne nicht gesehen! Diese wurde von der Fotografin Lee Miller aufgenommen, die im April 1945 als Kriegsberichterstatterin mit den amerikanischen Truppen in München eingezogen war und einige Tage in Hitlers Wohnung am Prinzregentenplatz wohnte. Am Tag seines Selbstmords badete sie dort. Nun ja, es muss ja nicht immer Hitler sein. Und was die dOCUMENTA betrifft: In fünf Jahren treffen wir uns bestimmt wieder. Ganz selbstbestimmt und herrschaftsfrei.