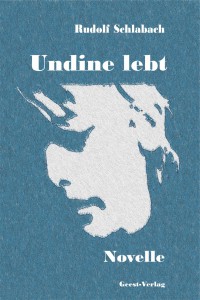Kultur, sie hatte mal mächtige Stimmen in der Stadt. Die Männer und Frauen, die der Kulturarbeit in Unna ihre Stimmen gaben, konnten sicher sein, dass nicht ungehört verhallte, was sie äußerten. Und sie fanden Gehör – auch weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Weil das Modell Unna weithin Aufmerksamkeit erregte. Weithin woben sich auch die Netzwerke, die Unnas Kulturverantwortliche schufen, weil offenbar gern mit modellhaften Kommunen zusammengearbeitet wurde. Und Unna war eine solche.
Ein ebenso stabiles wie inhaltlich definiertes Fundament wurde im Laufe der Jahre geschaffen. Nachhaltig stemmt es sich auch aktuell in die Wellen eines immer inhaltsärmer werdenden Tsunami, der gespeist wird von den siechen Finanzkraft der Kommunen, von neuen medialen Interessen, von der erkennbaren Schwindsucht unter den Rezipienten; aber auch vortrefflich assistiert von zartbegabter Rhetorik seiner auserkorenen Sachwalter.

Das Musical “Oz” der „Freien Wildbahn“ als Beispiel für gelungene kulturelle Nachwuchsarbeit. (Foto: Freie Wildbahn)
Trotzig recken sich da und dort die Zeugen alter Zeiten aus Unnas soziokultureller Vergangenheit in die Landschaft: Lindenbrauerei, ZIB, Lichtkunst, Jugendkunstschule, Travados, die unvergleichlichen Feste in der Stadt sind Beispiele. Die Umwelt, mit der sie leben müssen, ist karger geworden. Die Zeiten sind natürlich auch andere geworden. Die Ideen, was man mit und aus Kultur machen könnte, sind andere geworden. Aber man muss sowohl bereit als auch in der Lage sein, überhaupt Ideen zu haben, sie dann auch noch in ein Konzept zu gießen und dann andere von diesem zu überzeugen.
Kultur ist die Summe aller menschlichen Lebensäußerungen
Nach wie vor hat Unna eine sehr spezifische und erkennbar charakterfeste Stadtkultur. Sie ist tief in Szenen vernetzt, und wer offenen Auges durch die Stadt gehen kann, erkennt, dass Soziokultur personell stark verankert ist, keinerlei schichtenspezische Kleidung umgehängt hat, nahezu alle Instrumente der musischen Lebensäußerungen von ihr bespielt werden. Und es ist auch zu erkennen, dass in der Stadt gern mal der Keim des kulturellen Nachwuchses aus dem Boden lugt und nachhaltig auf sich aufmerksam macht. Das fulminante Musical “Oz” der “Freien Wildbahn” bewies erst kürzlich, wie fruchtbar der großartige Unnaer Kulturhumus sein kann.
Die tragenden Strukturen einer Unnaer Kulturarbeit der Zukunft müssen – so wie das für alle gesellschaftlichen Strukturen gilt – stets an die sich aktuell darstellenden Verhältnisse angepasst werden. Sebastian Laaser, stellvertretender Fachausschuss-Vorsitzender im Rat, hat es getroffen, als er alles mit einen dauernden Prozess beschrieb, was im Zusammenhang mit Kultur steht. Die dahinter liegende Idee aber muss stets die bleiben, dass “der Mensch im Mittelpunkt zu stehen hat” (Hubert Biernat, einst Landrat des Kreises).
Bildung, Schule, Weiterbildung und auch Sport – als basislegend für Teamverständnis, als Erfolgsgarant in der Zusammenarbeit von Individuen –, sie können im Zusammenspiel mit der sich ständig weiterentwickelnden Unnaer Kultur ein zukunftsorientiertes Bindegewebe für eine Stadtgesellschaft bilden, deren gemeinsame Anstrengung im Erhalt einer weltoffenen, (lebenslang) bildungsorientierten und solidarischen Stadtkultur besteht. Einen solchen Chor zu bilden und gekonnt zu dirigieren, das wäre eine Idee.
Wo bleiben die kraftvollen Stimmen?
Wenn Unna, wie geplant, eine gGmbH (gemeinnützige GmbH) ins Leben ruft, um der Zukunft der Kultur ein neues und stabiles Gerüst zu verleihen, dann erfüllt das nur einen Sinn, wenn gleichzeitig der Auftrag dieser Gesellschaft klar definiert wird als Instrument, als Werkzeug eines inhaltlichen Strebens: die Kulturarbeit ständig vom Kopf auf die Füße zu stellen und immer wieder zu erneuern.
Wenn sich aber diese gGmbH kleinmütig bei den Stichwörtern „Steuerersparnis“ und „Mittelverteilung“ festfährt, bleibt der eigentliche Kern der Maßnahme gleich mit in den Startblöcken stehen und wird zum ständig finanzgeschüttelten Spielball der kulturellen Interessenarmut. Das Credo der Kulturpolitik muss hier lauten: Kultur im Mittelpunkt – für Menschen! Und nicht ins Kleinlaute stolpernd die Frage stellen: Wie bewahren wir Krümel einer Vergangenheit, für die wir nicht mehr ausreichend Geld haben?
Die inhaltlichen Zwischentöne einer kraftvollen Stimme in Unnas Kulturpolitik vernehme ich nicht. Jedenfalls nicht, solange sich die Protagonisten darin erschöpfen, im thematischen Zusammenhang mit Kultur verletzungsfrei „Spartenrechnung“ zu buchstabieren oder im Kulturbereich akteneinsichtliche Erkenntnisse zu wittern.
(Der Beitrag erscheint in ähnlicher Form in Rudi Bernhardts Blog dasprojektunna.de)