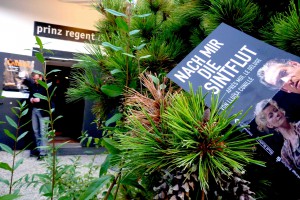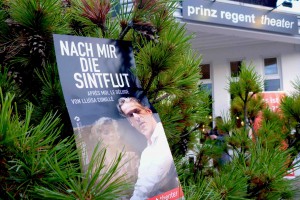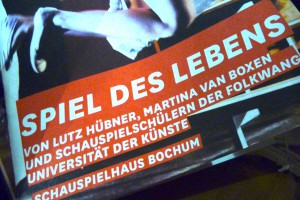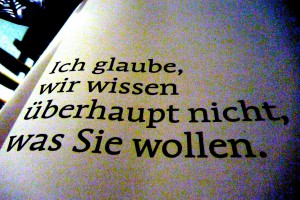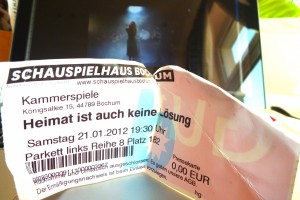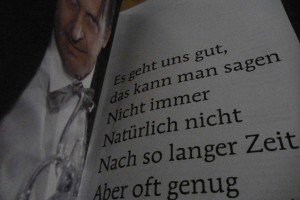Käpt’n Blaubär, dieser behäbig-gutmütige Lügenbär aus der „Sendung mit der Maus“?
Ist von ihm, Walter Moers.
Dann das Kleine Arschloch, diese respektlose Comic-Figur, ein Elfjähriger mit großer Nase und baumelndem Schniedelwutz?
Von ihm, Moers.
„Adolf, die kleine Nazi-Sau“, die scheiternde Witzfigur aus dem Clip „Der Bonker“?
Moers’ Idee.
Der Kontinent Zamonien, ein düster-sagenhafter Schauplatz einer ganzen Roman-Reihe – von Käpt’n Blaubärs Abenteuern für Erwachsene über Rumo bis zu einäugigen Buchlingen, die tief unter der Erde leben?
Eine grafische und wortgewaltige Schöpfung von: Moers.
Endlich darf Moers ins Museum
„7 ½ Leben“ hat Walter Moers schon hinter sich gebraucht – zumindest legt die gleichnamige Ausstellung in der Ludwig Galerie Schloss Oberhausen das nahe.
Zum ersten Mal darf das Gesamtwerk des Zeichners, Grafikers, Autors ins Museum. Skizzen und Vorab-Collagen sind zu sehen, Storyboards und fertige Clips, Tuschezeichnungen, Objekte und Bücher.
Richtig: Bücher. An den Bänken sind Moers’ Romane befestigt. Wer viel Zeit mitbringt, kann so auch in der zamonischen Welt versinken, die Moers seit 1999 erschafft. Aus Text, besonderer Typografie und eingefügten Zeichnungen.
Bedrückend. Und heiter
Für seine Romane schafft Moers mit Tusche Szenen, die beides sind: bedrückend und heiter. Viele Figuren wirken lächerlich und verbreiten doch Angst und Schrecken. Das ist die Kunst seiner Fantasie: Alles kann jederzeit ins Gegenteil umschlagen – in die schrecklichsten Höllenqualen oder in ein rauschendes Fest.
Viele der Original-Zeichnungen sind auch in Oberhausen zu sehen. Und stellen den Betrachter vor eben dieses Rätsel: Sind das nun Endzeit-Visionen wie bei Pieter Bruegel? Angsteinflößende Kreaturen im Stil eines Gustave Doré? Oder spielt Moers nur wieder mit den Vorlagen?
Respektlosigkeit gegenüber da Vinci? Gerne doch!
Moers liebt die Persiflage. Ein paar Respektlosigkeiten gegenüber da Vinci, Rembrandt, Picasso, Munch und Miró? Sind immer drin. Moers imitiert die Werke, kopiert sich durch all die Stile der Kunstgeschichte und setzt immer sein Kleines Arschloch in die Mitte.
Auf die vermeintlich antike Vase, als goldverzierte Ikone, als Mona Lisa, als Schrei, als Warhol’sche Campbell-Dose – selbst als Snoopy-Ersatz auf der Hundehütte. Über dem letzten Bild schwebt die Denkblase: „Hier sollte eine heiter-besinnliche Schlusspointe stehen, aber mir fällt keine ein.“ Treffender und gemeiner kann man Charles M. Schulz’ Comics nicht entlarven.
Ein kotzender „Bürger von Calais“
Andererseits: Selbst bei Werken, die ihrerseits Tabus brachen, dreht Moers die Schraube noch etwas weiter. Bei Jeff Koons „Made in Heaven“ hockt das Kleine Arschloch in eindeutiger Pose vor der Frau, die sich auf dem Gras räkelt. Wenige Meter weiter würgt eine großnasige Steinfigur ihren Magen-Inhalt heraus, Moers‘ Version von Auguste Rodins „Bürger von Calais“.
Nicht umsonst warnt ein Schild: Dieser Teil der Ausstellung ist nur für Besucher ab 16 geeignet.
Harmlose Blaubär- und Hein-Blöd-Puppen
Harmlos dagegen geht es in einem anderen Gebäudeteil zu. Die Puppen von Käpt’n Blaubär und Hein Blöd sind ausgestellt. Ein Film zeigt, wie die Puppenspieler arbeiten, wie es hinter den Kulissen aussieht. So wird ganz nebenbei deutlich, wie Moers’ Ideen eben auch funktionieren: mit dem Kern erfolgreich sein, dann vermarkten – vom Musical bis zur Kuschelpuppe.
Es wäre allerdings unfair, Walter Moers auf den breiten Merchandising-Aspekt zu reduzieren. Zumal der personenscheue Künstler eher das neue Ufer sucht, als am alten Ausverkauf zu betreiben.
Was Moers in den 80ern schon konnte
Die „7 ½ Leben“ zeigen seine Entwicklung. Moers hatte zwar schon immer Talent im Zeichnen, im detaillieren Umsetzen und im textlichen Verdichten. Viele Ideen aus den späteren Romanen hatte Moers schon in den 80ern. Es brauchte allerdings Jahre, bis er den exakten Einsatz von Illustrationen und pseudo-wissenschaftlichen Grafiken dosieren konnte.
Harte Arbeit war das, davon zeugt das Tipp-Ex auf einigen Entwürfen, die in Oberhausen zu sehen sind. Am Ende jedoch kommt so etwas heraus wie das „Tratschwellen-Alphabet“. Das dem Betrachter einfach ein Lächeln abverlangen muss.
Mindestens.
Walter Moers‘ 7 1/2 Leben sind noch bis zum 15. Januar 2012 zu sehen. Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, Konrad-Adenauer-Allee 46, geöffnet Di-So 11-18 Uhr. Katalog 29 Euro.
(Eine ähnliche Version dieses Textes ist im Westfälischen Anzeiger erschienen).