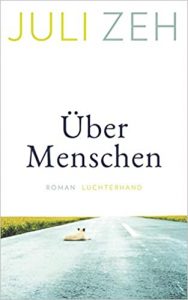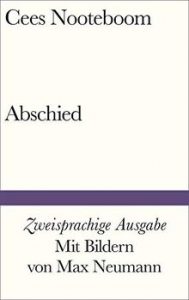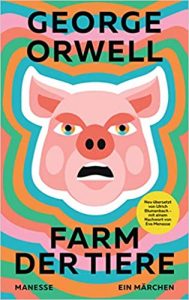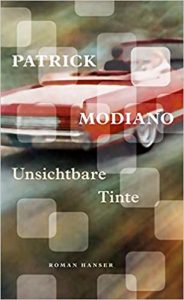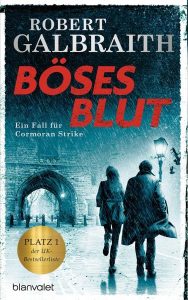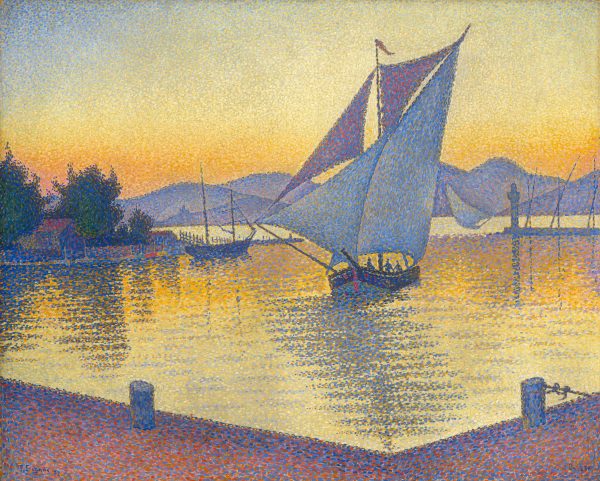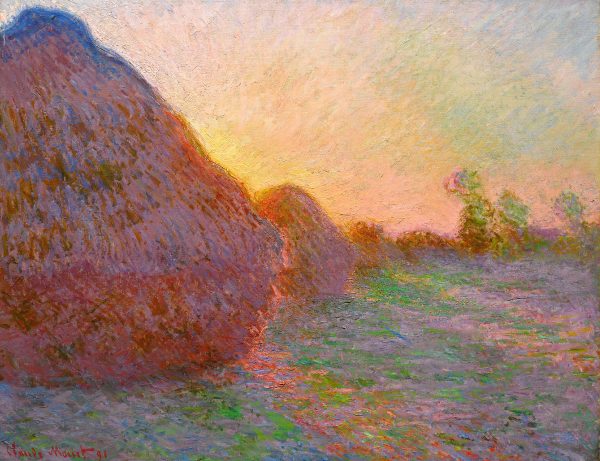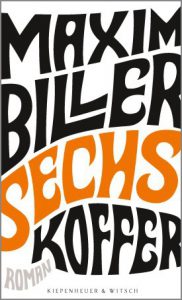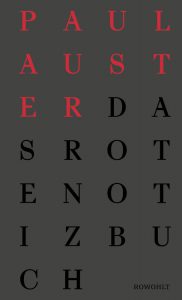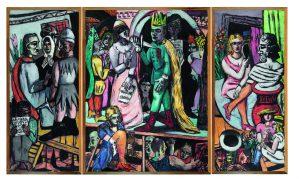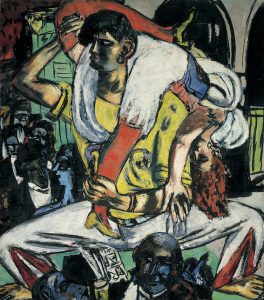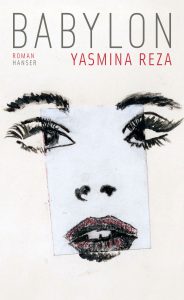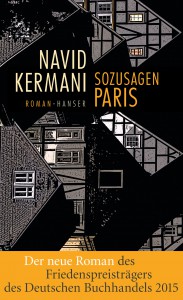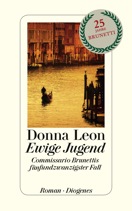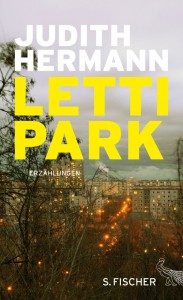Die Leute sind oft anders, als wir meinen – Juli Zehs neuer Roman „Über Menschen“
Dora muss raus. Einfach weg von allem. Irgendwo neu beginnen. Raus aus dem hysterisch überdrehten Berlin, der Endlosschleife immergleicher Gespräche über gesunde Ernährung und korrekte Mülltrennung. Weg von ihrem Freund Robert, der sich vom Klima-Aktivisten zum Corona-Schamanen gewandelt hat und Gefolgschaft erwartet.
Seit die Pandemie da ist und die Menschen Masken tragen, kommt alles ins Rutschen. Beziehungen und Gewissheiten lösen sich auf. Die Werbe-Agentur, in der sie eben noch als Star-Texterin verehrt und gut bezahlt wurde, verdonnert Dora zum Homeoffice und wird ihr später per Mail die Kündigung aussprechen. Da ist Dora aber längst schon abgehauen, hat die Café-Latte-Schickeria, die Cancel-Culture- und Gender-Sternchen-Debatten abgeschüttelt wie lästige Fliegen, hat schnell ein paar Sachen und ihren Hund eingepackt und ist nach Bracken gefahren, einem (fiktiven) Kaff in der Prignitz.
Hier, in diesem Landkreis von Brandenburg, wo die Arbeit ausstirbt sind und die Zukunft keine Perspektive hat, die Fremdenfeindlichkeit zum Alltag gehört und die AfD besonders viele Wählerstimmen einheimst, hat sich Dora vor einiger Zeit ein altes Haus gekauft. Aus einer Laune heraus. Vielleicht auch, weil sie schon vor der Corona-Katastrophe ahnte, dass demnächst alles den Bach runter gehen und ihr bisherigen Leben zerbröseln wird wie ein trockener Keks.
„Ich bin hier der Dorf-Nazi“
Jetzt ist Dora in Bracken, allein mit sich, einem langsam dahin schmelzenden Bankkonto und einem verwilderten Garten, den sie schweißtreibend beackern muss. Und mit einem Nachbarn, Gottfried, genannt Gote, der jetzt, wo sie gerade die Sense schwingt und sich überlegt, wo sie Tomaten pflanzen könnte, seinen stiernackigen Glatzkopf über die Mauer reckt, sie anblafft, er werde ihren Hund platt machen, wenn er noch einmal seine Saatkartoffeln ausgräbt, um dann grinsend hinzuzufügen: „Ich bin hier der Dorf-Nazi.“
In ihrem neuen Roman „Über Menschen“ zerfleddert Juli Zeh genüsslich Vorurteile, kratzt beharrlich an fest getackerten Deutungsmustern, zeigt auf hinterhältig-heitere und kurios-komische Weise, dass es sich lohnt weiterzumachen, trotz Krise und Katastrophe, apokalyptischem Geraune und populistischer Propaganda. Die Welt ist schillernder und vielfältiger, als wir sie uns mit unserem simplen Schubladenken ausmalen, die Menschen widersprüchlicher und liebenswerter, als wir uns eingestehen, wenn wir mit unserem Schwarz-weiß-Denken Freund und Freund von einander scheiden und uns den Kontakt und das Gespräch mit Leuten ersparen, die anders ticken und denken als wir.
Zwei AfD-Typen sind schwul und pflanzen Cannabis
Alle haben Dora vor den dickschädeligen Menschen und dem dumpfen Rechtsradikalismus in der Provinz gewarnt. Aber dann geschehen Dinge, die Doras Weltbild ins Wanken bringen. Gote mag ein Nazi sein, aber er ist auch der fürsorgliche Vater eines kleinen Mädchens, ein sensibler Vogelkundler und ein Nachbar, der zupackt, für Dora Möbel schreinert und Wände streicht, einfach so, ohne irgendeine Gegenleistung zu fordern oder zu erwarten. Und die beiden Typen von gegenüber, die einen AfD-Aufkleber auf ihrem Pick-Up haben und sich über die blöden Politiker und weltfremden Entscheidungen im fernen Berlin aufregen, sind in Wahrheit ein schwules Paar und pflanzen nicht nur Blumen, sondern auch Cannabis.
Juli Zeh, die selbst mit ihrer Familie im Havelland lebt, weiß, wovon sie schreibt. Sie kennt ihre Provinz-Pappenheimer genau. Als sprachgewandte Schriftstellerin, die als Gast im Literarischen Quartett sitzt, durchschaut sie die Eitelkeiten und Einbildungen des intellektuellen Betriebes, als Richterin am Verfassungsgericht im Land Brandenburg weiß sie um Schwächen und Ängste, Befangenheit und Fehlbarkeit von Mensch und Politik.
Im Roman „Unterleuten“ gelang ihr 2016 eine garstige Posse über Berliner Aussteiger und Selbstgerechtigkeit, über Verlierer und Gewinner der Wende, die das Leben dort, wo ländliche Idylle sein könnte, in eine selbst gezimmerte Hölle verwandeln. „Über Menschen“ fokussiert sich noch mehr auf die Nöte und Sorgen der so genannten kleinen Leute, die man heute nicht mehr ungestraft als „normal“ bezeichnen darf, wenn man nicht (wie Wolfgang Thierse) von Sprach-Polizisten als „identitätsfeindlich“ abgekanzelt werden und sich den Vorwurf einhandeln will, man würde andere gesellschaftliche Gruppen diskriminieren.
In der Provinz bleiben, weil es die Heimat ist
Natürlich gibt es bei Juli Zeh auch Nazis, die sich als „Übermenschen“ verstehen (aber keine Ahnung haben, wer Nietzsche war und was er mit dem Begriff meinte). Aber vor allem zeichnet sie satirisch zugespitzt und hart am Rande des Klischees Menschen, die uns berühren und bewegen, weil sie als allein erziehende Mütter (wie Nachbarin Sadie) nachts zur Arbeit ins ferne Berlin pendeln, um ihre Kinder ernähren zu können, oder mal eben (wie Nachbar Heinrich) mit einer Landmaschine vorbeikommen, um Doras verkrauteten Acker in eine blühende Landschaft zu verwandeln.
Es sind Menschen, die in der Provinz ausharren, weil es ihre Heimat ist, die bleiben, auch wenn die Landarzt-Praxen dichtmachen und die nächste Einkaufsmöglichkeit 18 Kilometer entfernt ist. Sie tragen keine Masken und fürchten sich nicht vor Corona. Aber sie sind genauso viel wert wie der sich im Berliner Biotop in Selbstmitleid verzehrende Gutmensch Robert. Oder der kultivierte Vater von Dora, der bei einem Rotwein gern über „Anspruchsdenken“ philosophiert und meint, das sei die wahre Pandemie. Das Gefühl der Leute, ein Anrecht zu besitzen auf mehr Sicherheit und mehr Komfort führe, weil man nie bekommt, was man will, zu Wehleidigkeit, Apokalypse-Ängsten und Verschwörungs-Theorien. Vielleicht hat er recht. Aber hilft das Dora, die jetzt zwar ein Haus auf dem Lande, aber keinen Job mehr hat? Oder Gote, der manchmal wüst herumpöbelt, aber dringend jemanden braucht, wenn sein Tumor aufs Gehirn drückt und er bewusstlos im Gras liegt? Mehr miteinander reden und einander besser zuhören: Das wäre vielleicht ein Anfang.
Juli Zeh: „Über Menschen“. Roman. Luchterhand, München 2021, 416 S., 22 Euro.