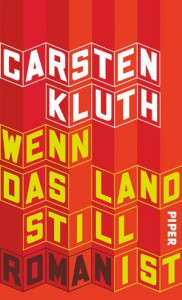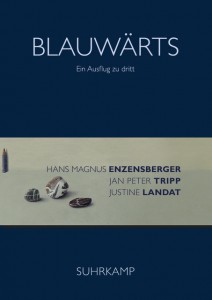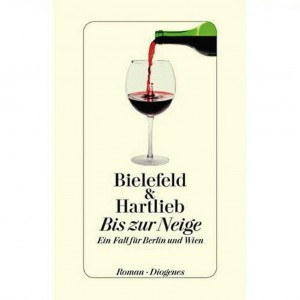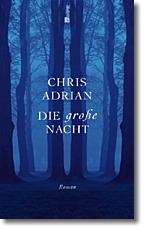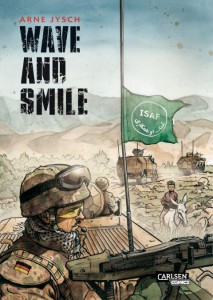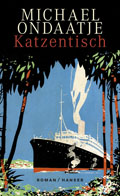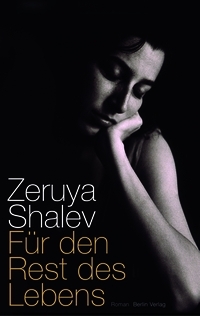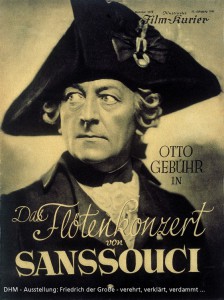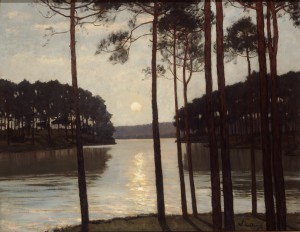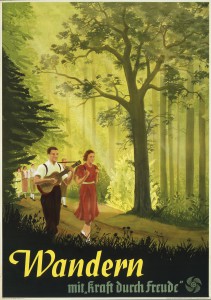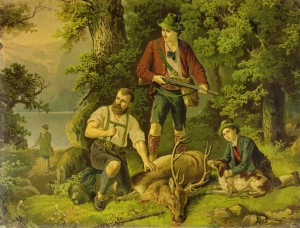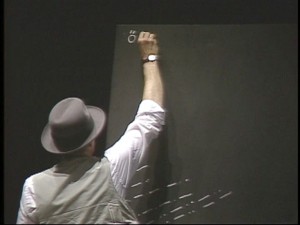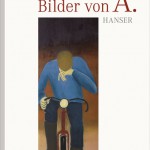Bleibende Verheerungen – Carsten Kluths Roman-Debüt „Wenn das Land still ist“
„Auch dieser Tag geht irgendwann zu Ende – doch die Verheerungen werden bleiben.“ An einem heißen Tag im August setzt ein Mann seine Ehe und das Leben seiner Kinder aufs Spiel.
Der Berliner Richter Harald Kronauer leidet unter dem Desinteresse seiner Frau Johanna, deshalb sucht er Ablenkung und Bestätigung bei seiner Geliebten Martina. Zudem will Kronauer unbedingt politische Karriere machen und lässt sich in riskante Machenschaften verwickeln, bei denen es – unter anderem – um Aufsehen erregende Klima-Manipulationen geht.
Sehr spät begreift Kronauer, der schon mit seinem chaotischen Familien-Alltag und seinem anstrengenden Richteramt überfordert ist, dass er von seinen vermeintlichen politischen Freunden nicht zufällig für seine Rolle auf dem politischen Schlachtfeld ausgesucht wurde: Es ist eine unheilvolle, spannende, überraschende Melange aus Emotion und Intellekt, Politthriller, Familienporträt und Gesellschaftsroman, die Carsten Kluth in seinem zupackenden Roman-Debüt anbietet.
Der 1972 geborene, mit seiner Familie in Berlin lebende Carsten Kluth hat politische Wissenschaften studiert und arbeitet – unter anderem für die Europäische Kommission in Brüssel – als Berater für Politik und Wirtschaft. Mit „Wenn das Land still ist“ ist dem eleganten und vielseitigen Erzähler jetzt ein fintenreiches Spiel über Einfluss und Macht gelungen, die großartige Geschichte eines emotional überforderten Jedermann in unsicheren und unübersichtlichen Zeiten.
Wie immer beginnt der Tag für Harald Kronauer um vier Uhr früh. Es ist ein wolkenloser Tag, der unerträglich heiß zu werden verspricht. Dass der Tag auch unendlich lang und gefährlich werden wird, ahnt der sich noch verschlafen im Bett wälzende, von erotischen Träumen und intellektuellen Verwirrungen gepeinigte Richter da noch nicht. Das wird sich sehr bald ändern. Und so wie die Minuten immer schneller zu verrinnen scheinen, werden auch die Verheerungen immer weiter zunehmen.
Kronauer hetzt von einem Termin zum nächsten, wird im Gericht von einem Kollegen erpresst und wird von seiner konservativen Partei als Nachfolger des soeben zurückgetretenen Staatssekretärs um Umweltministerium gehandelt. Dass hinter dem Rücktritt eine gezielte Intrige steht, ahnt Kronauer nicht.
Es dauert sehr lange, bis der Richter, der wegen eines Urteils zur Ausweisung von Klimaflüchtlingen nicht unumstritten ist, die wahren Ausmaße der politischen Kampagne kapiert und sich darauf besinnt, dass ihm die Familie das Wichtigste im Leben ist. Kronauer schafft es gerade noch rechtzeitig, seine Frau und seine Kinder aus der Schusslinie zu bringen. Doch wer glaubt, damit sei alles wieder gut, könnte sich gründlich irren…
Carsten Kluth: „Wenn das Land still ist“. Roman. Piper Verlag, München. 383 Seiten, 19,99 Euro.