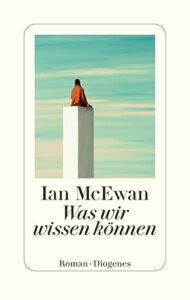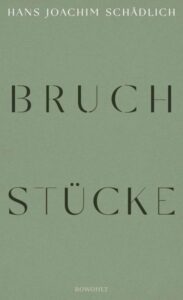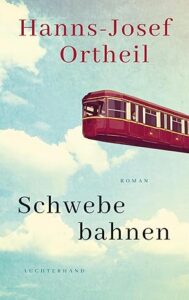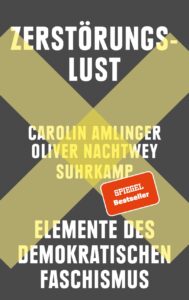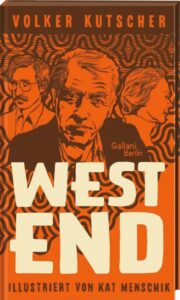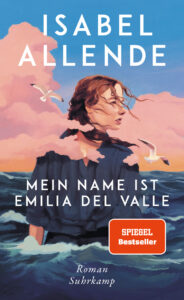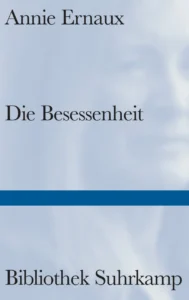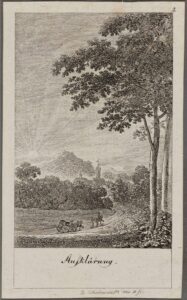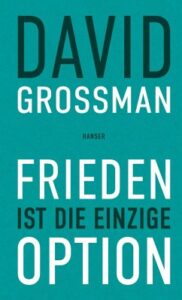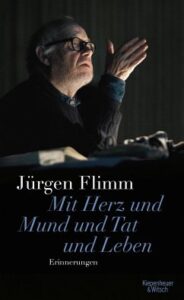Die Hölle als Tingeltangel: Kafka-Drama „K“ am Berliner Ensemble

Szene aus „K.“ mit Kathrin Wehlisch (li.) und Constanze Becker. (Foto: © Jörg Brüggemann/Berliner Ensemble)
„Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.“ Mit diesen berühmten Worten beginnt „Der Prozess“, einer der bedeutendsten und zugleich rätselhaftesten Romane der Weltliteratur. Die von Franz Kafka erfundene Welt anonymer Bedrohungen und das Schicksal eines zu Unrecht Verfolgten wurde zum Inbegriff für das ausweglose Dasein des Individuums in der von politischen und sozialen Widersprüchen geprägten Gesellschaft.
Josef K. ist der moderne Jedermann, der die Verlorenheit des Menschen in der unübersichtlichen Gegenwart spiegelt und ins Räderwerk der totalitären Unterdrückungsapparate gerät: eine prophetische Fabel über die vom allgegenwärtigen Bösen zu Tode gehetzte Kreatur.
In der Fassung, die Regisseur und Autor Barrie Kosky am Berliner Ensemble zeigt, wird aus dem von anonymen Mächten drangsalierten Angestellten, der sich keiner Schuld bewusst ist und vergeblich gegen bürokratische Wände anrennt, ein von antisemitischem Hass Verfolgter und von religiösem Wahn zum Opfer abgestempelter Außenseiter. Kosky, früher Intendant der Komischen Oper Berlin, hat Kafkas Roman unter dem Titel „K.“ eingedampft und zurecht geruckelt, er nennt es „Ein talmudisches Tingeltangel“.
Kosky schmuggelt nicht nur ein paar Ausschnitte aus anderen Werken Kafkas in seine Fassung („Der Hungerkünstler“, „Das Urteil“, „In der Strafkolonie“), sondern versetzt das szenische Spiel mit musikalischen Akzenten und tänzerischen Einlagen. Viele Lieder stammen aus dem jiddischen Theater des beginnenden 20. Jahrhunderts. Kontrastiert werden die oft frechen und zotigen jiddischen Songs, die Kafka gern in Prager, Wiener und Berliner Varietés hörte, mit Johann Sebastian Bachs Kirchen- und Hausmusik des deutschen Barock und mit zärtlichen Liebes-Dichtungen von Robert Schumann.
Symbolfigur für listigen Widerstand
Um Ambivalenz und Außenseitertum des assimilierten Juden zu betonen, muss sich Josef K. bei seinen rhetorischen Finessen und gesanglichen Fehden zwischen jiddischem Singsang und herrischem Deutsch entscheiden. Kathrin Wehlisch verkörpert Josef K. als geschlechtsneutrale, verletzliche Symbolfigur für listigen Widerstand, stolpert mit fröhlicher Naivität durchs politische Kuddelmuddel und labt die geschundene Seele an der Brust von Dora Diamant (Alma Sadé).
Doch dem Kafka-Widergänger Josef K. ist weder mit mütterlicher Zärtlichkeit noch mit innigen Liebesschwüren zu helfen. Er ist ein ewiger Unruhegeist und wunschlos Unglücklicher, der von staatlichen Hierarchien zermalmt wird und keine Chance hat, sich gegen lieblose Vermieterinnen und prügelnde Wärterinnen zu behaupten: Constanze Becker schlüpft gleich in mehrere Rollen und verkörpert dumpf-deutsche Überheblichkeit mit eisiger Sprache und abweisender Miene. Was aus Josef K. wird, ist dieser germanischen Sirene gleichgültig. Mögen doch die Henker ihre Arbeit verrichten.
Aber Kosky, selbst assimilierter Jude mit ambivalenten Gefühlen, gibt Josef K. ein Leben nach dem Tode. Aus dem Off ertönt der Befehl: „Nochmal von vorne!“ Eine großartige Pointe.
Die nächsten Aufführungen: 25. Januar (18 Uhr), 26. Januar (19.30 Uhr), 3. März (19.30 Uhr), 4. März (19.30 Uhr).
https://www.berliner-ensemble.de