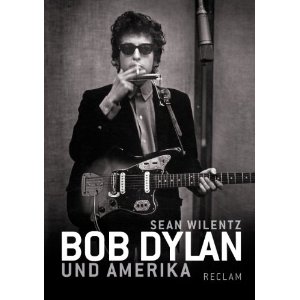Mir wird ja zunehmend klarer, dass es Texte gibt, die nur als Hörbuch wirklich das wiederzugeben in der Lage sind, was ihr Autor aussagen will.
Sie wirken abgestimmt und wohl legiert – vom Verfasser über den Sprecher oder dessen weibliche Entsprechung auf den Hörleser und seine weibliche Entsprechung ein. Sie malen buntfarbige Bilder oder dralldreisten Unfug mit Sprache und Stimme, stellen für mich als ausgewiesen Junkie dieses Genres inzwischen eine eigenständige Kunstgattung dar. Das war schon häufiger der Fall, beispielsweise bei den Eberhofer-Krimis von Rita Falk, deren Würze nicht zuletzt durch das bayerische Idiom des Christian Tramitz schmackhaft wird, oder beim abgedrehten „Er ist wieder da“ von Timur Vermes, in dem Christoph Maria Herbst den „Föhrer“ grandios durch sechs Stunden trompetet, ohne zu albern oder zu ernst dabei zu wirken, so dass die Gratwanderung dieses feinsinnigen Versuches weder plump noch plöd daher kommt.

Und nun nahm mich Frank Goosens „Sommerfest“ gefangen, weil Frank Goosens Stimme es mir vorlas und ich zunehmend felsenfester überzeugt war, dass nur er, genau er dazu in der Lage war, seinen Text zu sprechen. Denn nur er kann „Tüss“ so sagen, dass es zwar seine hochdeutsch gemeinte Anmutung bewahrt, aber voll nach Revier klingt, oder Klümpchen, den Begriff, den man schon in Köln nicht mehr als revierne Schwester der Kamelle erkennt. Nur er kann unsere Sprache so sprechen, als sei sie eben d a s Kommunikationsinstrument einer Kulturregion, der einzigen, die rund 60 Kilometer Autobahn sperren kann, um den längsten Tisch der Welt mit fröhlich palavernden Menschen zu füllen.
Zugegeben, ganz fein anders klingt es, wenn ein Bochumer spricht, in den Ohren eines Nachbarn, der aus Köln vor Jahrzehnten nach Dortmund einwanderte, also in meinen Ohren. Aber es klingt dennoch wie zuhause, es fühlt sich fast so an, als erzähle er meine Geschichte, weil ich so vieles wiedererkenne. Wie den generationsübergreifenden Zusammenhalt in einer Kleingartensiedlung, die Unterhaltung Erwachsener, während die Brut pöhlt und um die Entdeckung für die zweite Liga kämpft. Oder das Erinnerungsgedusel alter Freunde, die sich in unterschiedlichen Schichten des Bochumer Soziotops wiedertreffen und nachts beschließen, wie früher zu sein, als sie noch jung waren. Oder die Geschichte von der goldenen Schraube, aus Adolf Winkelmanns Film „Jede Menge Kohle“, die mir Adolf so um 1967 einmal erzählte. Kea, das konnte der auf zwei lockere Stunden ausdehnen bis der Gag kam: „Und drehte, und drehte … und dann fiel ihm der Arsch ab!“
Schauspieler Stefan, der aus München angereist ist, um das Elternhaus einem Makler zu übergeben, auf dass der es verkaufe, weil kürzlich der letzte Bewohner dahin schied, ein Nennonkel, der es in Schuss gehalten hatte, nachdem die Eltern gestorben waren, Stefan ist der „Local Heroe“. Was soll er mit einem Haus in Bochum, wenn sein Theater den Vertrag nicht verlängert; wenn er am Montag doch an der Isar Vorsprechen hat, für eine Fernsehserie, die er nicht einmal kennt. „Toto“ Starek, der leicht eindimensionale Handlanger von „Diggo“ Decker, dem gar nicht so dusseligen Grobschlachter, Frank Tenholdt, der gebildete Bewahrer des Industriekultur-Erbes seines einst Kohle kratzenden Vaters, Franks schöne Frau Karin, die mal Stefan geküsst hat und natürlich „Charly“, also Charlotte, die Enkelin des Masurischen Hammers, der „Omma“ Luises (Stefans Omma) ewige Liebe war, aber auch deren unerfüllte. „Charly“, die erste Liebe von Stefan, der er den ersten Kuss seines Lebens gab, die ihn, wenn auch ein einziges Mal beischlafenderweise, aber stets als kleinen Bruder betrachtet hatte, oder? Sie und noch viele mehr begleiten ihn, den Schauspieler, aus München angereist („Muss man dich kennen?“), durch ein langes Wochenende, in dessen Verlauf Stefan nichts von dem geregelt kriegt, was er eigentlich tun wollte. Aber alles, das den Willen zur Lebensumkehr bei ihm auslöst.
Anka, die Freundin im fernen München, verliert sich, ebenso wie dieses immer fremder werdende München. Bisweilen tölpelt der ewige Ruhri aus Stefan heraus, bisweilen sehnt er sich selbst angesichts der pöbelnden Ruhris aus seiner wiedererkannten Jugend an die Isar zurück, das aber immer seltener. „Was soll ich denn hier?“ heißt es einmal hilflos aus Stefans Mund. „Was sollst du woanders?“ lautet die Entgegnung der „Charly“-Charlotte. Dafür merkt man ihm und dem Erzähler Frank Goosen an, wie der Held mit jeder Begegnung und jeder Erweckung von Erinnerung immer mehr am Heimweh l e i d e t und die Gegenwehr nachlässt, wenn er wieder einmal innerlich feststellt, dass „Totto“ blöd ist, Frank Tenholdt ein Spinner, „Diggo“ Decker das Urbild des Revier-Prolls und … ach „Charly“.
Da ich noch vielen anderen gönne, die wunderschönen Stücke zu genießen, lasse ich es mal dabei und empfehle jedermensch, sich anzuhören, was Frank Goosen seinen Leuten daheim und Fliehenden – in welche Himmelsrichtung auch immer – an die Hand gibt. Dass jeder und jede dahin gehört, wo er/sie sich am wohlsten fühlt, und das ist bei uns, ist doch klar. Stefans Koffer fährt allein nach München zurück, die Bahn nimmt ihn mit, aus der Stefan im letzten Moment noch springt, um doch noch bei „Charly“ nachzufragen, ob sie gemeinsam was machen, so etwa Theater in der alten Kneipe vom Masurischen Hammer, „Omma Luises“ ewige Liebe. Im Koffer ist auch der Schlüssel zum Elternhaus, das er immer noch nicht verkauft hat. Tja, und wie es ausgeht, das erzählt Frank Goosen noch, aber nicht, wie es weiter geht mit dem Hinterzimmertheater und allen anderen Plänen, mit den „Tottos“, Diggos“, mit Frank und seiner untreuen Karin. Aber das können wir uns ausdenken.
Frank Goosen (Autor und Vorleser): „Sommerfest“. Hörbuch (6 CDs / 425 Minuten) im Verlag Roof Music; Tacheles! Ca. 22 €