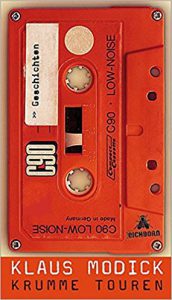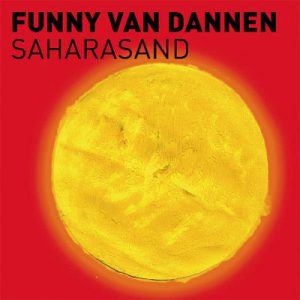Entwurzelter Riese
Einen Elefanten von Lissabon nach Wien bringen? Mit etlichen Mühen und ausgeklügelter Logistik kann es gelingen. Wie aber hat man das im 16. Jahrhundert angestellt, als noch kaum ein Europäer je einen Elefanten zu Gesicht bekommen hatte?
Anno 1551 vollzieht sich ein solcher Haupt- und Staatsakt mit Hintergedanken: Der König von Portugal (Johann III.) schenkt dem Herrscher von Spanien just den Dickhäuter Salomon (später Soliman genannt). Insgeheim will der König mit dieser Zeremonie einen lästig gewordenen, zudem höchst gefräßigen Kostgänger loswerden und ihn dem weitläufigen Verwandten Maximilian (seinerzeit Statthalter in Spanien für Kaiser Karl V.) aufhalsen – mitsamt dem Elefantenführer, dem indischen Mahut namens Subhro. Der ist der einzige, der mit dem exotischen Tier artgerecht umgehen kann. Diese Fähigkeit nutzt er, seiner subalternen Stellung zum Trotz, listig aus.
Auf historischen Vorgaben fußt „Die Reise des Elefanten“, der letzte Roman des im Juni verstorbenen portugiesischen Nobelpreisträgers José Saramago. Doch das geschichtliche Gerüst wird weit überwölbt von literarischer Kunst.
Ein wenig irritierend zunächst, dass Saramago ganze Dialogfolgen nur durch Kommata trennt und somit in langen Satzketten aufzieht. Doch man gewöhnt sich rasch daran. Das Stilmittel fügt sich sogar bestens zu den höfisch ziselierten Umständlichkeiten, die sich hier immer wieder zur Farce verdichten. Groteske Zeremonien und lachhafte Hierarchien machen jedes Unterfangen doppelt schwierig; erst recht eine Herkules-Aufgabe wie den Elefantentransport durch den halben Kontinent. Eigentlich ist das ganze Unterfangen ein Irrwitz, um des schönen Scheins willen verfügt vom Monarchen und zähneknirschend auszuführen von niederen Chargen.
Machtpolitisches Misstrauen und religiöse Konflikte im Spannungsfeld von Reformation, beginnender Gegenreformation (und Inquisition) wirken erschwerend mit hinein. Ach, Europa! Als der Elefant vor der Basilika von Padua niederkniet (dank einer vom Klerus dringlich erwünschten Dressur durch den Mahut), deuten die Katholiken dies nur zu bereitwillig als „Wunder“. Bei den Habsburgern, die bereits dem Protestantismus zuneigen, ist dies hingegen nicht opportun. Auf solch spiegelglattem Gelände hat sich schon die bloße Übergabe des Elefanten im portugiesisch-spanischen Grenzgebiet recht heikel gestaltet. Doch das alles ist noch nichts gegen die lebensgefährliche Überquerung der Alpen im eisigen Winter. Sagt da jemand „Hannibal“? Ja, auch der wird mal kurz als Bezugsgröße erwähnt.
Immer wieder wird das damalige „Hier und Jetzt“ auch aus der Perspektive späterer Epochen betrachtet und damit sanft, aber bestimmt relativiert und in seiner zeitlichen Bedingtheit herausgestellt. Freilich geht es dabei recht diskret zu, als sei man nur heimlich zu Gast in jenen Jahren.
Auch der rigide Deutungsanspruch der christlichen Konfessionen wird durch Vergleiche in Zweifel gezogen, denn da wäre ja auch noch der Hinduismus mit seinen Elefanten-Gottheiten. Überhaupt duldet flagrante Fabulierfreude keine allzu starren Fakten, in ihrem Fluge schert sie sich nicht um „diese verdammte Realität“, wie es an einer Stelle heißt. Als Schreibender muss man wohl wendiger sein als die träge Wirklichkeit.
Der nahezu allwissende Erzähler, der sich allerdings selbst ironisch nimmt, schwebt leichthin über den Dingen, ist ihnen (gemeinsam mit den Lesern) manchmal voraus, stolpert jedoch auch schon mal hinterdrein. Zitat: „Wir werden nicht mehr dabei sein, wenn sie den Rückweg ins Dorf organisieren.“ Oder: „Wir werden laufen müssen, um sie einzuholen.“ Dabei schreitet dieser Roman so langsam voran ein Elefant.
Das mag in etlichen Passagen betulich und behäbig klingen, sorgt aber auch für einen ruhigen Erzählfluss, dem ein unaufgeregtes Alltagswissen entspricht, das eben alle Hierarchien hinter sich lässt. Und so rückt in all den kleinen oder größeren Wirren auf der langen Strecke jener indische Mahut mehr und mehr ins wahre Gravitationszentrum des Geschehens, noch vor allen erlauchten Häuptern, grimmigen Soldaten oder geknechteten Ochsenkarrenziehern. Dieser Mahut ist ein weiser, verschmitzter Narr, der sich stets sein Teil denkt, sich aber nicht gern den Mund verbrennen möchte. Und so lässt er manche Verletzungen seiner Würde stillschweigend über sich ergehen. Denn wer weiß, ob man ihn in Wien noch brauchen oder zum Teufel jagen wird?
Der gleichfalls heimatlose, entwurzelte Elefant scheint sich derweil um nichts zu bekümmern – außer ums Fressen, das man ihm auch unterwegs tonnenweise herbeischaffen muss. Ansonsten weiß er nicht, wie ihm geschieht auf der langen Reise. Dieser Umstand gewinnt bei Saramago existenzielle Bedeutung, wenn er den Mahut sinnieren lässt: „Ich glaube, in Salomons Kopf vermischen sich das Nichtwollen und das Nichtwissen zu einer großen Frage über die Welt, in die man ihn hineinversetzt hat, aber diese Frage betrifft ja uns alle, uns und die Elefanten.“
Ein Satz, bei dem man wie unterm endlos weiten Sternenhimmel steht.
José Saramago: „Die Reise des Elefanten“. Roman. Aus dem Portugiesischen von Marianne Gareis. Verlag Hoffmann und Campe. 236 Seiten. 19,95 Euro.