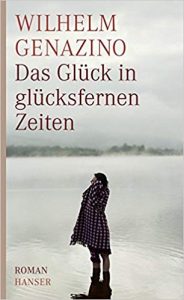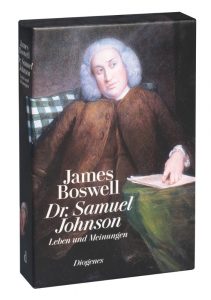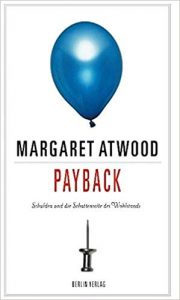Gisbert zu Knyphausen: Gehen, gehen, gehen
Ach, ach, ach. Die Platte, die ich hier nachdrücklich empfehlen möchte, ist schon im April 2008 erschienen und mir erst jetzt aufgefallen. Eine kleine Ewigkeit im hechelnden Pop-Business. Ja, darf man’s denn wagen und darüber noch schreiben?
Nun, ich bin keiner zeilengeilen PR-Abteilung der Plattenbranche verpflichtet (es stört mich schon, dass diese Fuzzis einen immerzu ungefragt duzen), sondern habe mir die CD neulich selbst gekauft. Niemand drängt mich, diese Rezension zu verfassen. Doch hindert mich auch keiner.
Vor einiger Zeit hat Ingo Juknat, wenn ich mich recht entsinne, in diesem Blog (Westropolis) die deutsche Rock-Szene gescholten. Er hat da sicherlich viel öfter und weitaus aktueller ’reingehört als ich (auch eine Altersfrage). Und es stimmt ja: Glamour und Charisma sind in unseren Breiten kaum zu Hause. Es gibt es aber einige rühmliche Ausnahmen, was die musikalische und textliche Qualität betrifft. Manche werden vielleicht Blumfeld, Tomte und Kettcar nennen. In Ordnung.
Zu meinen heimischen Favoriten der letzten zehn bis fünfzehn Jahre zählen beispielsweise: Element of Crime, Tocotronic, die Frauenband Britta um Christiane Rösinger, Erdmöbel – und Funny van Dannen. Jeweils ganz eigene „Hausnummern“ und Kategorien. Darauf kommt’s ja schließlich auch an: auf unbeirrbare Eigenart.
Zu solchen Original-Könnern gesellt sich also neuerdings der aus dem hessischen Rheingau stammende, heute in Hamburg lebende Mann mit dem nicht gerade rockigen Namen Gisbert zu Knyphausen, dessen ursprüngliches Adelsprädikat noch um einiges länger sein soll. Egal. Er ist jedenfalls ein Singer-Songwriter (vulgo: Liedermacher) von einigen Graden und Gnaden, mit gut und gern ausgelebter Neigung zum Indie-Rock. Insgesamt eher eingängig als sperrig. Doch genauer hinhören muss man schon, es fließt nicht einfach so daher.
Sein erstes Album heißt ebenso wie der Urheber und ist gleich famos geraten. Ja, es dürfte auf diesem Felde hierzulande schwerlich übertroffen werden. Zwar lassen sich einzelne Titel durchaus ausgekoppelt hören, jeder beweist Charakter für sich. Doch zeigt sich hier wieder einmal die Stärke eines gereiften Albumkonzeptes (das ja leider längst von diffusen Einzeldateien abgelöst worden ist): Bei Knyphausen gibt es noch eine Dramaturgie des An- und Abschwellens, der sinnreichen Abfolge.
Die Texte gehören wohl zum Besten, was derzeit auf dem Pop-Sektor in deutscher Sprache vorgetragen wird. Die Worte setzen sich zwar zuweilen nonchalant und rauh-charmant über das Reim- und Rhythmus-Schema hinweg, sie trudeln aber nahezu unfehlbar in poetische Bezirke. Fast absichtslos manchmal, in den allerschönsten Momenten. So ehrlich und authentisch klingt das, dass man fast schon wieder geneigt ist, es für Pose zu halten. Aber das wäre nun wirklich eine Hirnschraubenwindung zu weit gegrübelt.
Das Spektrum reicht vom sanfteren Gitarrenlied beinahe à la Hannes Wader (erinnert Knyphausen nicht auch vom Habitus her ein wenig an diesen Altvorderen?) über geerdeten Blues bis zum strubbligen Geradeaus-Rock, der freilich auch seine Finessen hat. Auf Videos im Netz kann man es sehen: Die Band wirkt so, als seien diese Typen direkt aus den frühen 70er Jahren zu uns gekommen. Doch gestrig sind sie beileibe nicht.
Gisbert zu Knyphausen balanciert wie auf schmaler Kante. So manche Verwundungen, Melancholie und Depression auf der einen Seite, plötzlich unversehens wieder erwachende, wilde und unbekümmerte Lebenslust auf der anderen. Auf einmal doch wieder unterwegs zum unversehenen, ungeahnten Glück: Komm ins Offene!
Aus dieser Gefühls- und Gemengelage unsinnigen Unglücks und unfassbaren Glücks beziehen nicht nur die Texte ihre Impulse, auch die Musik holt daraus ihre Energie. Stichwort-Beispiele: Das Lied „Spieglein Spieglein“ ist eine harsche Absage an alle unnötige (Selbst)-Quälerei, auch in „Der Blick aus deinen Augen“ ist der schöne Schwebezustand nach allzu mühsamer Sinnsuche nahezu erreicht. Die „Kleine Ballade“ scheint sich federleicht über erlittene Mühsal erheben zu wollen. „Sommertag“ begräbt furios all den lang gehegten Pessimismus, der nun endlich in Scherben liege. Da möchte man tatsächlich sogleich aufbrechen und gehen, gehen, gehen (was ja ohnehin ein Grundantrieb hörenswerter Rockmusik ist). Und weiter, weiter bis zu den beiden abschließenden Stücken „So seltsam durch die Nacht“ und „Verschwende deine Zeit“. Songs, die man wieder und wieder hören möchte.
Da geht es – aus persönlich getönter Sicht – fast immer auch ums Ganze, ums Leben, wie man es schlecht und recht oder ein kleines bisschen besser lebt. Manchmal ergeht sich Gisbert zu Knyphausen in kämpferischer Metaphorik und nennt sich an einer Stelle sogar „kriegsgeil“. Etwa in diesem Sinne: Erst aus Trümmern kann das Neue und Künftige entstehen. Nun ja. Dieses „Stirb und werde“ gibt es nicht erst seit Goethe. Und es wird auch so bald nicht aufhören.
_______________________
Die CD „Gisbert zu Knyphausen“ ist im April 2008 beim Label „PlayItAgainSam“ erschienen und kostet ca. 17 €.
Zwei Video-Links (Titel „Sommertag“ und „Neues Jahr“) zur Kostprobe:
http://www.youtube.com/watch?v=axWLddS4aUI
und
Die Bandbesetzung: Gisbert zu Knyphausen (Gitarre, Gesang), Gunnar Ennen (Keyboards), Jens Fricke (Gitarre), Sebastian Deufel (Schlagzeug), Frenzy Suhr (Bass).