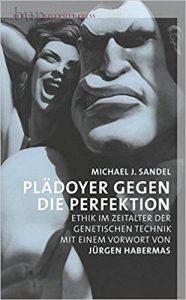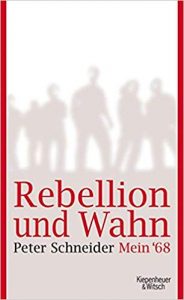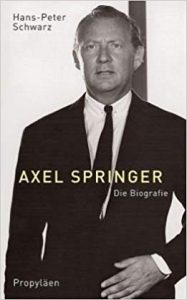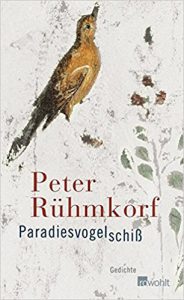Ruhrgebiet: Kurios, kriminell oder mit Kick – einige Neuerscheinungen über die Region
Jede Wette: Schon im Vorfeld der Kulturhauptstadt 2010 schwillt die Zahl der Bücher übers Ruhrgebiet kräftig an. Hier ein kleiner Vorgeschmack mit Neuerscheinungen – vom Krimi bis zum Bildband. Auch ein paar Flops sind dabei.
• Nobert Golluch: „Alles über das Ruhrgebiet“ (Komet-Verlag, 192 S., 4,95 Euro)
Der Titel ist frech gestrunzt. Mit etwas Geschick könnte man sich via Internet-Suche solche mehr oder weniger kuriosen Daten- und Fakten-Listen über die Region rasch selbst zusammenstellen. Revier-Kenner finden zudem auf Anhieb Fehler. Ein etwas schludriges Billigbuch.
• „Ruhrkraft. Eine Region auf dem Weg zur Weltspitze“ (Hoffmann & Campe, 175 S., 12,95 Euro)
Hier geht’s regionalfromm zu – mit vorwiegend zukunftsfrohen Sonntagsreden aus Industrie, Kultur, Sport und Politik. Letztere sind nach üblichem Parteien-Proporz sortiert. Manches ist nur Ghostwriter-Prosa zum Gähnen – und für die Ablage.
• Roland Günter: „Der Traum von der Insel im Ruhrgebiet“ (Klartext Verlag, 220 S., 23,90 Euro)
Zwischen Emscher und Kanal hat der Autor eine riesige, lang gestreckte „Insel“ ausgemacht, die von Castrop-Rauxel bis Oberhausen reicht. In fiktiven Dialogen mit Federico Fellinis Drehbuchautor Tonino Guerra wird dieser Landstrich zum utopischen Gelände. Eine ambitionierte Kopfgeburt.
• „Mord am Hellweg IV“ (Grafit Verlag,.378 S., 9,95 Euro)
Der Sammelband mit Kurzkrimis zum großen, aktuellen Festival führt direkt vor so manche Haustür. Da heißt es beispielsweise „Leben und Sterben in Unna“ oder – kalauernd gereimt – „Sühnen in Lünen“. Natürlich sind nicht alle Stories gleich stark, doch im Schnitt ist das Niveau der einheimischen und auswärtigen Autoren erfreulich.
• Peter Kersken: „Tod an der Ruhr“ (Emons Verlag, 320 S., 11 Euro)
Revierkrimi der etwas anderen Art. Die Handlung spielt 1866, zur Zeit der Industrialisierung. Vor sorgfältig recherchiertem historischem Hintergrund (Stichwort: ungezähmter Frühkapitalismus) entfaltet sich ein zeittypischer, wahrhaft abgründiger Kriminalfall.
• Frank Goosen: „Weil Samstag ist. Fußballgeschichten“ (Eichborn Verlag, 158 S., 12,95 Euro)
Fußball darf im Revier natürlich nicht fehlen. Und wer könnte darüber mit wacherem Witz schreiben als Frank Goosen? Der seit Jahrzehnten leidgeprüfte Hardcore-Fan des VfL Bochum trifft allemal den richtigen Ton und schreibt gut geerdete Prosa mit dem gewissen Kick. Das Buch enthält auch seine Kolumnen zur WM 2006 und zur EM 2008. Treffer!
• „Das Ruhrgebiet. Früher und heute“ (Komet-Verlag, Bildband 160 S., 9,95 Euro)
Starke Kontraste: Ansichten des Reviers aus früheren Jahrzehnten im Vergleich mit der heutigen Lage. Der Blick auf dieselben Schauplätze ergibt im zeitlichen Abstand ein uneinheitliches, aber womöglich lehrreiches Bild: Manche Orte sind verödet, andere haben sich bestens entwickelt. Mal überwiegt Wehmut, mal Zuversicht. Merke: Früher war bestimmt nicht alles besser.
• Boldt/Gelhar: „Das Ruhrgebiet. Landschaft – Industrie – Kultur“ (Primus, 168 S., 39,90 Euro)
Gründliche Untersuchung zum Wandel der Region. Das mit Fotos, Karten und Grafiken reich illustrierte Buch hat das Zeug zum geographischen Standardwerk.