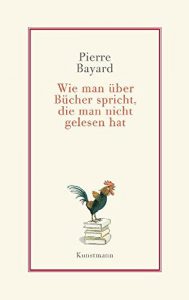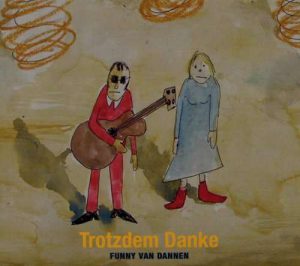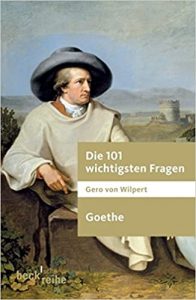„Ein fliehendes Pferd“: Beziehungsstress am Bodensee
Das ist fürwahr ein Alptraum, man stelle sich vor: Alter Schulkollege taucht nach 25 Jahren unverhofft auf – blutjunge Blondine im Schlepptau. Der Kerl gibt sich sturzvital, heftet sich penetrant an deine Fersen und gibt dir immer wieder nassforsch zu verstehen, wie falsch und fade du lebst. Und dann macht er sich flugs an deine Frau heran.
So erleidet’s in Martin Walsers Novelle „Ein fliehendes Pferd“ (1978) der bedauernswerte Studienrat Halm. Rainer Kaufmann („Die Apothekerin“) bringt den behutsam umgemodelten Stoff jetzt mit prominenten Akteuren ins Kino. Sie holen aus der Tragikomödie tatsächlich etliche komische Nuancen heraus.
Klaus heißt die Kanaille. Mit jedem Wort lässt er den Deutsch- und Geschichtslehrer Halm spüren, dass dessen Alltag in blutleerer Routine erstarrt ist. Und er hat damit gar nicht so unrecht. Selbst im Urlaub löst und lockert sich nichts: Helmut Halm (Ulrich Noethen) und seine Frau Sabine (ihre wohl beste Rolle seit langem: Katja Riemann) verbringen seit vielen Jahren rituelle Ferien am Bodensee. Dort kann – anders als im Buch – der behäbige Halm in aller Frühe und Stille die heimische Vogelwelt beobachten. Der Ruf einer Rohrdommel als Höhepunkt des Tages. Nicht sonderlich aufregend. Der virile „Macher“ Klaus Buch (rasant: Ulrich Tukur) belustigt sich drüber und geht lieber auf Segeltörns – am liebsten bei gehöriger Gischt oder gar mitten im Gewittersturm. Heißa!
Jeder Satz ein Gegen-Satz, jede Tat ein Affront. Klaus drängt Sabine zur Untreue, während Halm sich eher verdattert in dessen Gespielin Helene (Petra Schmidt-Schaller) verguckt. So lädt sich die missliche Konstellation auch noch sexuell auf. Halm wahrt eine Zeit lang krampfhaft die Selbstbeherrschung. Aber dann! In dem bisher so stillen Mann schwellen Todeswünsche an. Ulrich Noethen macht den Zwiespalt erschütternd glaubhaft. Da tun sich Risse auf.
Drehbuch und Darsteller mussten die vielen inneren Monologe der Novelle in Handlung, Gestik und Mimik übertragen. Dem Ensemble-Quartett gelingt dies mit Bravour, auch Martin Walser soll’s gefallen haben.
Hinter all dem Dampf-Geplauder lässt der famose Ulrich Tukur Spuren von Verzweiflung durchscheinen, als nehme dieser Klaus gerade seine letzten Chancen wahr. Wie aus dem Nichts ist er aufgetaucht, wie ein Spuk verschwindet er schließlich. Das Ehepaar Halm ist wieder mit seinen (nunmehr aufgewühlten) Enttäuschungen allein. Gehen sie einander an die Gurgel? Beinahe. Doch dann fassen sie einen geradezu heldenhaften Entschluss . . .