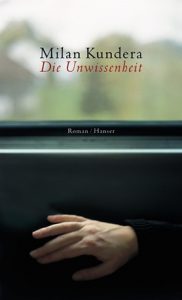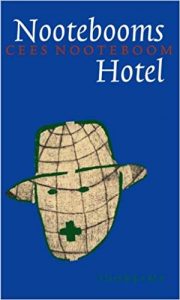Auf dem Wege zum Urbild – Alexej von Jawlensky und einige Zeitgenossen in Duisburg
Von Bernd Berke
Duisburg. Für hiesige Museumsbesucher ist Alexej von Jawlensky (1864-1941) wahrlich kein Unbekannter: 1998 gab es eine reich bestückte Retrospektive am Dortmunder Ostwall, sodann eine (wegen Fälschungs-Verdachtes) höchst strittige Schau im Essener Folkwang-Museum. Nun ist Jawlensky gleichsam noch ein Stück weiter nach Westen gewandert und im Duisburger Lehmbruck-Museum „angekommen“.
Hier hat man einen etwas anderen Ansatz gefunden, um den Meister der Klassischen Moderne zu präsentieren. Unter den 100 Exponaten stammen 48 von Jawlensky. Das ist kein Manko, im Gegenteil. Sinnfällig wird sein Werk auf den künstlerischen Kontext der Zeit bezogen. Dabei konzentriert man sich vornehmlich auf Jawlenskys Schweizer Jahre von 1914 bis 1921. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte der russische Künstler, der bis dahin in München lebte (wo er mit Franz Marc die Gruppe „Blauer Reiter“ gründete), Deutschland verlassen müssen.
Kontrast zur wilden Szene der Dadaisten
Zunächst siedelte er sich in einem Dorf bei Lausanne an, wo er in Isolation verharrte und hauptsächlich wehmutsvolle Einsamkeits-Blicke aus seinem Fenster malte. Dann aber zog es ihn in die äußerst fruchtbare Emigranten-Szene Zürichs. Vor allem die Dadaisten hatten sich dort versammelt und provozierten als eine Art wüster Spaß-Guerilla mit oft grotesken Aktionen das Bürgertum. In Duisburg beschwören u. a. phantasievolle Masken den kreativen Mummenschanz.
Über diesem quirligen Umfeld schwebte der schon etwas ältere Jawlensky als eine Art Vaterfigur, vielleicht nicht so ganz von dieser Welt. Hatte er in München noch farbglühende Landschaften und Porträts geschaffen („Spanierin“, um 1911), so begab er sich nun mit religiöser Inbrunst auf den Weg vom Abbild zum Urbild des menschlichen Antlitzes.
Asketisch schmale Lippen
Immer meditativer und ikonenhafter geraten nun die Serien der frontalen Gesichter, meist in suggestiver Nahansicht. Charakteristisch die strichförmig geschlossenen Augen und asketisch schmallippige Mundlinien. Auf früheren Bildern hatten diese erleuchteten Wesen noch gelegentlich groß geschaut (oder: das Jenseits ins Auge gefasst), doch auch da standen ihre Pupillen schon seltsam senkrecht, von mystischer Entrückung kündend.
Dies alles wäre schon eine Ausstellung wert, doch gibt es zudem erhellende Querbezüge. Bestens trifft es sich, dass der Duisburger „Hausheilige“ Wilhelm Lehmbruck damals gleichfalls eine Zeit lang in der Schweiz weilte und sich Vergleiche mit seinen Skulpturen anbieten; beispielsweise mit jener Plastik, die Lehmbruck nach dem Bilde der aussichtslos vergötterten Schauspielerin Elisabeth Bergner („Betende“, 1918) schuf.
Auch bei Lehmbruck wird ein Drang ins Jenseitige spürbar, der Impulse von Jawlensky bezogen haben mag. Vielleicht war ja unerfüllte Liebe ein beiden Künstlern gemeinsamer Sublimierungs-Quell, denn auch Jawlenskys langjährige Verbindung mit der Malerin Marianne von Werefkin gilt als zwiespältig und erotisch nebulös. Nun aber Schluss mit Spekulation und Tratsch!
Vergeistigung durch Krankheit
Fakt ist, dass die Duisburger auch einige Exponate aus dem dadaistischen Bereich (Hans Arp, Sophie Taeuber-Arp, Marcel Janco, Hans Richter) zeigen – sozusagen als fröhlich-chaotische Kontrapunkte, neben denen Jawlenskys spirituelle Wesensart umso deutlicher hervortritt.
Dem Streben Jawlenskys näher verwandt sind jene wundervoll sanftmütigen Arbeiten von Paul Klee oder die ebenfalls famosen Bilder des Schweizers Ferdinand Hodler, der z. B. immer wieder eine Freundin porträtierte – zunächst in der Blüte ihres Lebens, später von Krankheit gezeichnet. Eine tief betrübliche, vom körperlichen Verfall erzwungene Vergeistigung.
Jawlenskys Schweizer Jahre endeten 1921, als er von Ascona nach Wiesbaden umzog, weil dort seine Förderin Emmy Scheyer wohnte. Bis zu seinem Tod (1941) lebte er dort. Zunehmend von Arthrose (Gelenksteife) geplagt, konnte Jawlenksy in den 30er Jahren nur noch formal einfache Bilder hervorbringen. Keineswegs zynisch gemeint: Vielleicht kam dies seinem Hang zum stillen, frommen Schauen sogar entgegen.
Jawlensky in der Schweiz. Lehmbruck-Museum, Duisburg. Bis 9. September. Di-Sa 11-17, So 10-18 Uhr. Eintritt 6 DM, Katalog 48 DM.