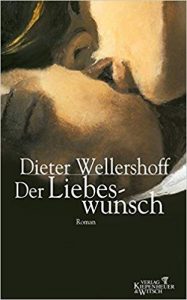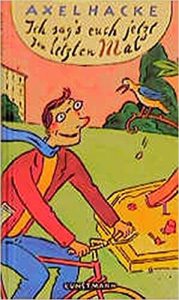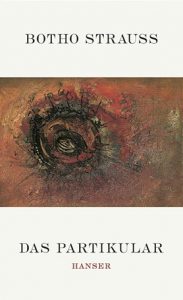„Der Mensch entgleitet sich immerzu“ – ein Gespräch mit dem Schriftsteller Dieter Wellershoff
Von Bernd Berke
Frankfurt. Der in Köln lebende Dieter Wellershoff zählt seit Jahrzehnten zu den am meisten beachteten deutschen Autoren. Er hat nicht nur zahlreiche Romane, Novellen und Hörspiele verfasst, sondern ist auch als gewichtiger Theoretiker der Roman-Gattung hervorgetreten.
Am 3. November wird Wellershoff 75 Jahre alt – auch aus diesem Anlass ein Gespräch über seinen neuen Roman „Der Liebeswunsch“, geführt am Buchmessestand seines Verlages Kiepenheuer & Witsch.:
In ersten Kritiken zu Ihrem Buch ist bemerkt worden, es ähnele in gewisser Weise Goethes „Wahlverwandtschaften“: Zwei miteinander befreundete Paare, zwischen denen zunächst ein labiles Gleichgewicht herrscht, das dann durch Treuebruch aus der erotischen Balance gerät.
Dieter Wellershoff: Solch eine Vierer-Dramaturgie gibt es in der Tat auch in den „Wahlverwandtschaften“. Es ist aber auch eine Grundstruktur des Lebens. Goethe sieht eine anonyme Schicksalshaftigkeit walten, eine Art Chemie. Meine Figuren sind zwar auch Getriebene. es sind aber auch Elemente von Wahlfreiheit und Zufall dabei. Mein Roman hatte einen langen Vorlauf. Über anderthalb Jahrzehnte habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, es hat allmählich immer mehr Stoff aufgesaugt. Es begann damit, dass sich eine Frau aus unserem ferneren Bekanntenkreis aus dem Hochhaus gestürzt hat – so wie meine Romanfigur Anja.
Sie ist das Opfer der Vierer-Konstellation…
Wellershoff: Ja. Ich verstehe den Menschen als Lebewesen, das sich immerzu entgleitet – im Gegensatz zum Tier, das immer dasselbe tut, will und fühlt. Deshalb kann sich der Mensch auch in beliebigen Möglichkeiten verlieren. Oder er kann in falschen Notwendigkeiten feststecken, zum Beispiel in einer unglücklichen Ehe. Während der Leser gleich am Anfang weiß, dass Anja sich umgebracht hat und dann erfährt, wie es dazu gekommen ist, machen die Figuren ihre Erfahrungen schrittweise – im „Dunkel des gelebten Augenblicks“, wie der Philosoph Ernst Bloch einmal gesagt hat.
Sie erzählen abwechselnd aus den Perspektiven Ihrer Figuren. Auf welche Person bezieht sich der Titel „Der Liebeswunsch“? Auf alle?
Wellershoff: So kann man es sehen. Explizit aber nur auf Anja, sie ist abhängig von Emotionen, sie heiratet aus Lebensangst. Sie ist wie eine Leerstelle, Liebe kommt ihr wie die letzte Rettung vor. Von dieser Ausschließlichkeit fühlen sich die anderen bedroht, sie wollen nicht verschlungen werden. Diese anderen haben ja praktischen Lebenserfolg. Anjas Mann Leonhard ist Richter, er wird zum Gerichtspräsidenten befördert. Paul, der ihr Geliebter wird, und seine Frau Marlene sind Ärzte.
Es gab zuvor längere Zeit keinen Roman von Ihnen .
Wellershoff: Der letzte liegt 17 Jahre zurück, ich hatte viele andere Projekte. Mit diesem neuen Roman bin ich übrigens sehr zufrieden. Ich werde in einigen Tagen 75 Jahre alt – und ich glaube nicht, dass man das dem Buch anmerkt. Es ist kein „Alterswerk“ mit den Spuren meines Alters.
Sie kommen bei Ihrem Thema nicht umhin, Sexualität zu schildern.
Wellershoff: Im 19. Jahrhundert hat man diesen Bereich nie dargestellt. Von Henry Miller bis Harold Brodkey ist es dann oft ziemlich rücksichtslos geschildert worden. In Brodkeys Text „Unschuld“ wird über 40 Seiten ein einziger Koitus vorgeführt: Ein Mann bemüht sich, eine frigide Frau zum Orgasmus zu bekommen. Das ist meine Sache nicht. Für mich ist Sexualität kein rein körperlicher Vorgang.