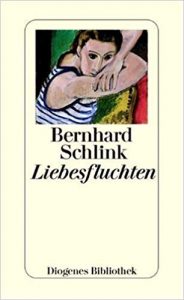Im deutschen Nirgendwo – Frank Castorf besorgt in Hamburg die Uraufführung von „Vaterland“ / Was wäre, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten?
Von Bernd Berke
Hamburg. Das ist ja ein tolles Theater im Hamburger Schauspielhaus: Mitten im Stück springt ein Zuschauer in den vorderen Reihen vom Platz auf und lässt eine Papierschwalbe durch den Raum segeln. Manche spenden dafür Beifall auf offener Szene.
Andere rufen „Aufhören!“ Oder auch, ganz flehentlich: „Gnade!“ Zwischendurch immer wieder demonstrativ lautes Trappeln und Türenschlagen derer, die vorzeitig gehen.
Die teilweise infantilen Regungen im Parkett entsprechen nicht dem Anlass. Auf dem Spielplan steht die Uraufführung des Stückes „Vaterland“ nach dem 1992 erschienenen Roman des britischen Journalisten Robert Harris. Regie bei der hanseatisch-preußischen Koproduktion führt Berlins Volksbühnen-Chef Frank Castorf, berüchtigt als Stücke-Zertrümmerer. Diesmal hatte er – mangels gefestigter Substanz – nichts zu zertrümmern, sondern nur zu collagieren. Dabei scheint er mittendrin aufgehört zu haben, so unfertig wirkt das Resultat dieser fast vierstündigen Zumutung.
Kennedy will Hitler besuchen
Robert Harris hat sich vorgestellt, wie es wäre, wenn der NS-Staat den Krieg gewonnen hätte und sich von Flandern bis zum Ural erstreckte. Schaurige Vision fürs Jahr 1964: Alle monströsen Architekturprojekte des Albert Speer sind verwirklicht, Adolf Hitler herrscht über ganz Europa. Sein 75. Geburtstag steht ebenso bevor wie ein Staatsbesuch des US-Präsidenten John F. Kennedy, der – wie feinfühlig – „die Frage der Menschenrechte anschneiden“ will…
Zudem richtet Harris eine Kriminalgeschichte an: Xaver März (Stephan Bissmeier), Kripofahnder in SS-Diensten, der aber mehr und mehr zum Dissidenten wird, will eine mysteriöse Mordserie aufklären. Wie sich herausstellt, fallen ihr all jene zum Opfer, die zu viel von der (längst verdrängten) „Endlösung der Judenfrage“ wussten, also vom Holocaust. Roman und Stück jonglieren mit dem Schwindel erregenden Gedanken, dass die realen 50er und 60er Jahre nicht weit von solchen Phantasien entfernt waren. Ex-Nazis saßen wieder auf wichtigen Posten, Deutschland errang erneut wirtschaftliche Macht.
Die Szenerie (Bühnenbild: Peter Schubert) bleibt granitstarr, setzt sich aber aus disparaten Elementen zusammen. Links ein schemenhaft sichtbarer Raum, wohl eine Flammenhölle. Dorthin führen Rampen. Zentral flimmern drei Lichtreihen wie auf einer Flug-Landebahn. Ein niedriger Torbogen öffnet sich zur Hinterbühne, rechts befinden sich lauter Türen, als erstrecke sich dort eine kafkaeske Behörde. Der Boden ist mit braunem Granulat bedeckt. All das wirkt wie zufällig addiert und mutwillig verstreut. Kein Ort, nirgends. Wie denn auch – in einer Welt, in der Hitler und die Beatles koexistieren?
Mit Regie-Einfällen und Spielweisen verhält es sich ähnlich. Unentwegt wechseln Tonlagen und Stile ohne ersichtlichen Grund. Zuweilen sehen wir kindische Sandkastenspiele: Figuren hopsen in Fässern oder Kartons über die Bühne. Ri-Ra-Rappelkiste!
Mal schnoddrig, mal hysterisch
Derart beflissen klingt oft der Tonfall des Kommissars März, der naiv und nervös durchs Drama taumelt, dass man sich in einen biederen Wallace-Krimi der 60er versetzt fühlt. Andererseits hält Castorf die Darsteller auch zum schnoddrigen Gestus, zu hysterischen Anfällen oder aggressiven Aufwallungen an – nach Lust und Laune. Vieles gilt als lachtauglich in diesen Comedy-süchtigen Zeiten: Ein Wort wie „Vermissten-Liste“ wird anfangs ausgiebig zerlegt unermüdlich wiederholt. Gewisse Moden werden also, wenn auch lustlos, bedient.
Hin und wieder gelingen allerdings wahrhaft verstörende Sequenzen. Vor allem eine halbstündige Passage fräst sich ins Hirn: Plötzlich geht im Zuschauerraum das Licht an, und es werden originale Beratungs-Protokolle zur Drangsalierung und späteren Vernichtung der Juden mit verteilten Rollen verlesen. Unerträglich schon das Beamtendeutsch, mit dem die materiellen Folgen der Pogrome versicherungstechnisch „geregelt“ wurden Hier konfrontiert uns Castorf mit einer Absurdität, die man schlichtweg nicht aushält.
Buhruf-Orkane für die Regie, unwesentlich gemildert durch lauen Beifall für die Dar- steller. Die Zuschauer, die durchgehalten haben, sind zugleich erschöpft und aufgebracht. Kein gutes Klima zum Nachdenken.
Termine: Hamburg (Schauspielhaus): 2., 4. Mai (Karten: 040/24 87 13) / Berlin (Volksbühne): 27. April.