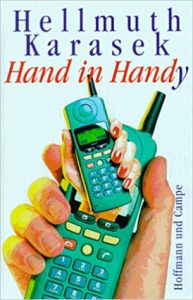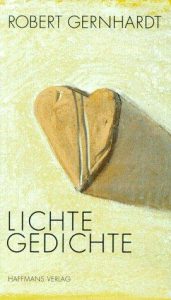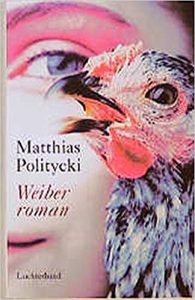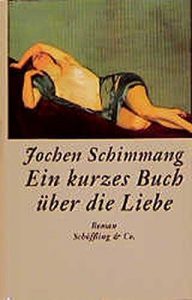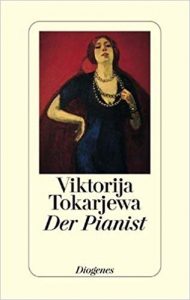Das beruhigende Gefühl in der Dunkelheit – Die asketischen Arbeiten des Rolf-Gunter Dienst in Wuppertal
Von Bernd Berke
Wuppertal. Lauter schwarze Bilder. Gut, daß wenigstens die Wände weiß sind. Denn ansonsten werden Besucher im Bürgersaal des Von der Heydt-Museums ringsum von Finsternis umfangen.
Doch Rolf-Gunter Dienst (55), der diese großformatigen düsteren Tafeln schuf, meint es nicht als Ausdruck der Bedrohung. Im Gegenteil: Er jedenfalls fühle sich im Dunkeln wohl, er fühle sich aufgehoben. Auch habe das Dunkel etwas „Egalitäres“ an sich, es mache alle und alles gleich.
Gedichte des irischen Nobelpreisträgers Seamus Heaney dienten als Inspiration zur dreizehnteiligen „Schwarzen Serie“, die erstmals das Atelier des Künstlers verläßt. In Heaneys Lyrik, so findet Rolf-Gunter Dienst, könne man die Dunkelheit oft mit Händen greifen. Zitat-Probe: „Aus schwarzem Rachen / Des Torfes zieht sich die scharfe Weide / freundlich zurück…“ Auch von „Höhlendunkel“ oder „Dämmersonnen“ ist in jenen Versen die Rede, die die Phantasie des Künstlers angeregt haben und die auch dem Besucher als vage Assoziations-Hilfe dienen könnten.
Bei näherer Betrachtung der Bilder ist die Schwärze vielfach mit verhalten farbigen Streifen durchsetzt, die wiederum aus feinsten Webmustern bestehen. Mal schimmert es violett, mal erdbraun durch. So entstehen nicht nur belebte Farbflächen, sondern auch imaginäre Räume. Ein einziges grünes Bild hängt noch im zentralen Raum der Ausstellung. Es wirkt, nach der Masse von Schwarz besehen, wie ein blitzheller Schock.
Jede Farbe erzeugt ihre eigene Welt
Die etwas ungünstig auf drei Etagen verteilte Schau zeigt ferner, wie der Künstler seine Ideen auch mit anderen Farbwerten durchgespielt hat. Mal hält er sich im „Bleistiftgebiet“ (Reihentitel) auf, und die winzigen Strukturen flimmern Grau in Grau, dann wieder gibt es Zwölfer-Serien von Aquarellen in Rot, Gelb, Blau und Grün. Jede Farbe erzeugt ihre eigene Welt.
All das aus kleinsten „Zellkernen“ bestehende Gewimmel erinnert an dichten Maschendraht oder an Ansichten unter dem Mikroskop. Die zahllosen gleichförmigen Bild-Elemente von Hand aufs Blatt zu bringen, so denkt man, könnte den Künstler bis dicht vor den Rand des Wahnsinns getrieben haben.
Sind es vielleicht Bilder, die auch aus einem Gefühl von Langeweile und Leere entstehen – oder aus unendlicher meditativer Geduld? Jedenfalls steckt in diesen Arbeiten viel mehr Mühe, als man zunächst vermutet. Und der Künstler selbst versichert, daß er keineswegs mit kühlem Herzen zur Sache geht, sondern sich durchaus von Emotionen tragen läßt.
Im Zeitungsfoto lassen sich diese kargen und asketischen Bilder jedenfalls kaum adäquat wiedergeben, man sollte sie sich schon in Wuppertal ansehen. Es ist übrigens nicht egal, in welcher Stimmung man dies unternimmt: Dem Ruhigen werden diese Bilder zusätzliche Ruhe spenden, den Unruhigen werden sie wohl noch nervöser machen.
Rolf-Gunter Dienst. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen. 11. Januar bis 22. Februar im Von der Heydt-Museum, Wuppertal (Elberfeld), Turmhof 8. Geöffnet Di-So 10-17 Uhr, Do 10-21 Uhr. Katalog 30 DM.