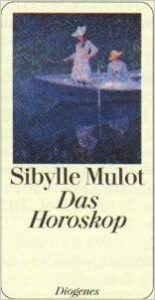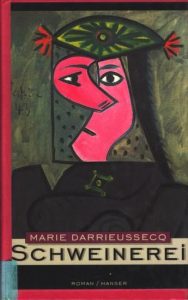Den Fallensteller kann man niemals fangen – Das irrlichternde Werk von Sigmar Polke in der Bonner Bundeskunsthalle
Von Bernd Berke
Bonn. Der Mann ist verknallt in Bilder mit Raster-Pünktchen: „Ich liebe alle Punkte, mit vielen Punkten bin ich verheiratet. Ich möchte, daß alle Punkte glücklich sind. Ich bin auch ein Punkt.“ Hier setzen wir wirklich mal einen Punkt und fragen: Redet da einer, der nicht ganz bei Verstand ist? Oh, nein. Da spricht ein irrlichternder Ironiker. Und einer der wichtigsten deutschen Gegenwartskünstler. Name: Sigmar Polke. Geboren 1941.
Bonns Bundeskunsthalle richtet ihm die bisher größte Retrospektive aus – mit rund 220 Arbeiten aus allen Schaffensphasen seit 1962, noch dazu fast lauter Großformate. Da darf man seine Augen schätzungsweise über etliche tausend Quadratmeter Kunst schweifen lassen.
Auf Polke, der sein Faible für flimmernde Raster listig mit Kurzsichtigkeit „erklärt“, könnte Bert Brechts berühmter Satz zutreffen: „In mir habt ihr einen, auf den könnt ihr nicht bauen.“ Polke selbst hat der Schau den Titel gegeben: „Die drei Lügen der Malerei“. Bereits das dürfte eine Falle sein. Es gibt ja viel mehr Lügen – und Wahrheiten.
Schon als Gerhard Richters Mitstreiter in der losen Gruppierung „Kapitalistischer Realismus“ machte sich Polke in den 60er Jahren sowohl über die Pop-Art als auch über den Sozialistischen Realismus lustig. So ist es bis heute: Geistig rastlos, schlägt er ständig neue Haken, entwischt stets, ist schon wieder ganz woanders.
Wenn nicht einmal die Farben Bestand haben
Manchmal freut sich Polke, wenn seine Bilder allmählich schwinden. Er benutzt Materialien wie Silberjodid oder Ruß auf Glas, deren Spuren sich verwischen. Er verwendet Pigmente, die sich bei wechselnder Temperatur wie das sprichwörtliche Chamäleon verhalten. Nicht einmal der Farbwert hat also Bestand.
Festlegung auf einen Stil ist Polke sowieso ein Greuel. Und er macht keinen Unterschied zwischen erhaben und trivial. Daher kann auch alles der Inspiration dienen. Polke verbindet in ein und demselben Bild naturgetreuen Realismus und Karikatur. Er verknüpft afrikanische Plastik mit niedlichen Bambi-Figuren, er umgibt den Umriß des berühmten Dürer’schen Hasen – als sei s ein einziger Abwasch – mit den Karo-Mustern von Trockentüchern. Wie er denn überhaupt seine Bilder oft mit endlos reproduzierbaren Mustern unterlegt oder überblendet: Tapeten, Kacheln, Stoffbahnen. Und seltsam: Was auch immer er sich anverwandelt, es gerät unter seinen Händen wahrhaftig zur Kunst. Wie bei jenem Midas, dem alles zu Gold wurde, was er berührte.
Der Schamane hat s auch mit der Politik
Zuweilen gebärdet sich Polke, der in den 1970ern gelegentlich rauschhafte Farbschlieren-Bilder unter Drogeneinfluß erzeugt hat, auch schon mal als Schamane. Höhere Wesen hätten ihm befohlen, keine Blumen, sondern Flamingos zu malen, heißt es neben einem Bild, das – Flamingos zeigt. Auf Schautafeln dokumentiert Polke die Resultate „telepathischer Sitzungen“ mit Künstlern früherer Zeiten: „Absender Max Klinger – Empfänger Sigmar Polke“.
Freilich: Auch über solche Anwandlungen mokiert er sich wieder – und malt auf einmal „politische“ Bilder über Flüchtlingslager und Tropenwälder. Doch der hintersinnige Fallensteller ist erneut zugange: Während die Mysterien unterschwellige Ironie enthalten, ist in den Polit-Schinken unversehens Magie am Werk, so etwa, wenn das Raster-Bildnis des früheren US-Präsidenten Reagan dank mehrerer Kopien langsam vergeht, als sei der Mann ein Opfer des nuklearen Schreckens geworden.
Sigmar Polke. Die drei Lügen der Malerei. Bundeskunsthalle Bonn (Museumsmeile). 7. Juni bis 12. Oktober. Di und Mi 10 bis 21 Uhr, Do bis So 10-19 Uhr. Eintritt 8 DM. Katalog 78 DM.