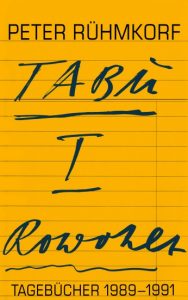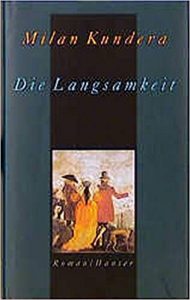Diese besondere Art der Zuneigung – „Nelly & Monsieur Arnaud“ von Claude Sautet
Von Bernd Berke
In den neueren Filmen von Claude Sautet geht es um das knappe Scheitern der Liebe. Das Augenmerk gilt dem Prozeß, in dessen Verlauf Mann und Frau einander um Haaresbreite verfehlen. Unerbittlich ist dabei die Zeit: Eben wäre es vielleicht noch die Liebe gewesen, jetzt ist es ein anderes, ganz eng verwandtes (aber eben verwandeltes) Gefühl. So ging es in „Ein Herz im Winter“, so geht es in „Nelly & Monsieur Arnaud“.
Die beiden Hauptpersonen sind eine junge Frau, die sich gerade von ihrem Mann getrennt hat, und ein älterer Herr, vormals Richter in den französischen Kolonien, der seit längerem allein wohnt und nun biographische Bilanz ziehen, aufs Wesentliche zusteuern will: Er möchte seine Memoiren als Buch herausbringen.
Arnaud ist also drauf und dran, sich an die Welt zu wenden, während Nelly gerade in sich geht und ihr Seelenleben zu ordnen sucht. Zwei Lebensmomente mit Schnitt- und Kreuzungspunkten. Das folgende Spiel aus Näherung und Distanz ist hier schon im Keim angelegt. Nelly (die berückend schöne Emmanuelle Béart) hat Schulden und sucht einen Job, Arnaud (Michel Serrault) ist vermögend und braucht eine Schreibkraft, die seine Erinnerungen tippt. Wie passend! Also gibt er ihr schon mal 30 000 Francs extra und engagiert sie gegen weitere Bezahlung. Ein leiser Hauch von Prostitution umweht diesen Tauschakt im Café, jenem beliebten Ort der Balance zwischen Öffentlichkeit und Intimät.
Zunächst sind es Arbeitstreffen, nachmittags in Arnauds gediegener Wohnung. Aber wer könnte einer Nelly lange widerstehen? Schon ihr Augenaufschlag, wenn sie an Arnauds Computer sitzt – auch Maler wie Vermeer oder Renoir hätten sich wohl in diesen Anblick verliebt.
Nach und nach rinnt also in die tägliche Gewohnheit ein beiderseits anschwellendes Interesse aneinander, untergründige Erotik Inbegriffen. Auch als Zuschauer empfindet man es bald als grob und störend, wenn die anderen Menschen in diese sich mehr und mehr verwebende Zweisamkeit hereinplatzen – ob nun besuchsweise oder am Telefon.
Der noble Herr wird plötzlich richtig eifersüchtig
Als Nelly gar vom Verleger, der Arnauds Erinnerungen herausbringen soll, recht irdisch umworben wird, ziehen Wolken auf: Arnaud mag sich zwar keine Eifersucht eingestehen, er strengt sich an, eine lebenslang eingeübte noble Haltung zu bewahren. Doch dann bricht es – für einige Augenblicke – umso heftiger aus ihm hervor.
Die Beziehung, so mag es scheinen, bleibt ungelebte Möglichkeit. Oder sollte sie sich doch schon kostbar erfüllt haben, auch und gerade ohne sexuelle Vollbringung? Es bleibt in der Schwebe. Am Ende jedenfalls begibt sich Arnaud mit seiner wieder aufgetauchten Frau auf eine jahrelange Weltreise.
Wir sehen noch, wie Nelly und er erstmals wieder verschiedene Wege gehen. Sie tragen ihre „ganze Geschichte“ noch sichtbar als töricht-schöne Verwirrung in den Köpfen, halten noch einmal inne und sind schon bleibender Erinnerung gewiß. Dann schreiten sie zögernd ins „Leben danach“.
Sautet läßt sich völlig auf die Gesichter und Gesten seiner Schauspieler ein, die Kamera erfaßt jede zuckenden Mundwinkel in Großaufnahme. Dabei entsteht ein psychologisch feinstens gesponnener, geradezu zärtlicher Film, der allen Nuancen einer besonderen Zuneigung innig nachspürt.