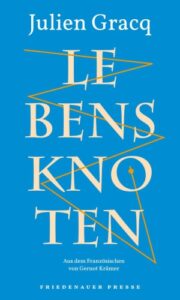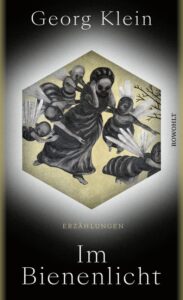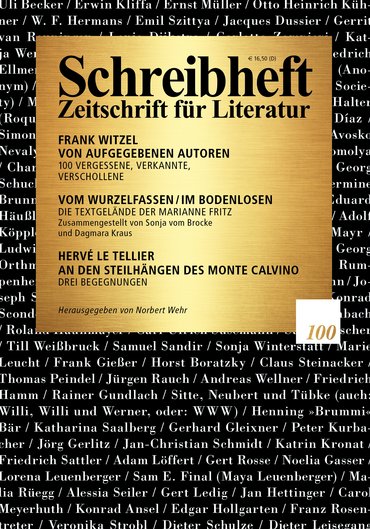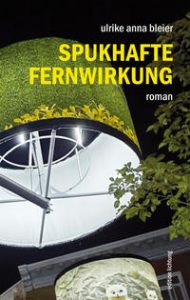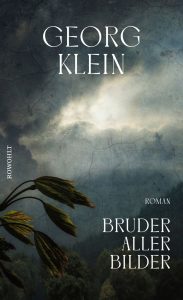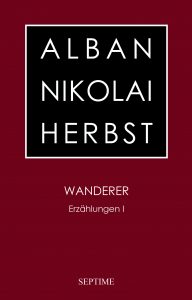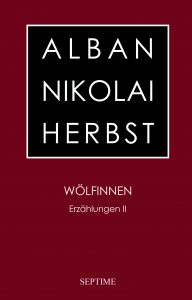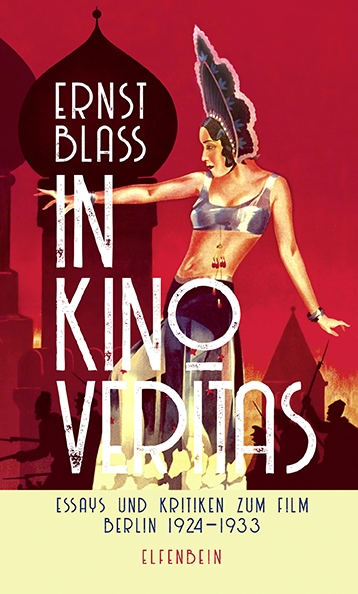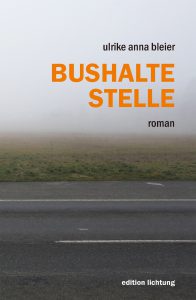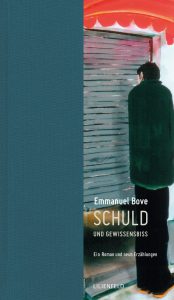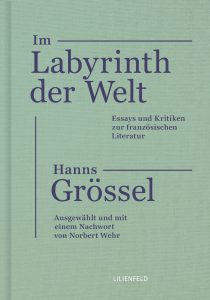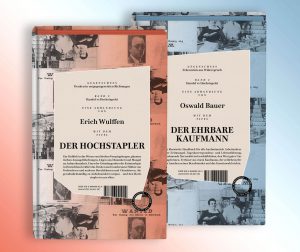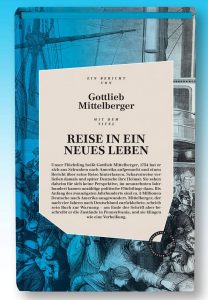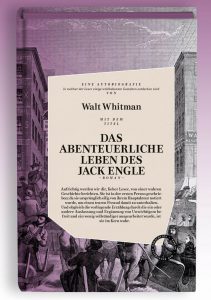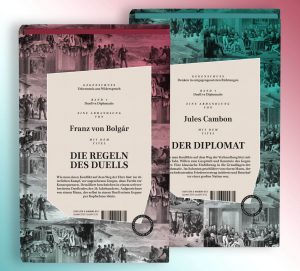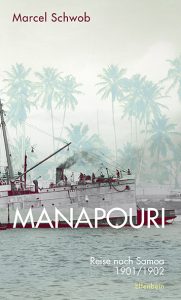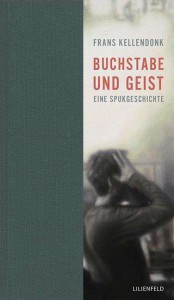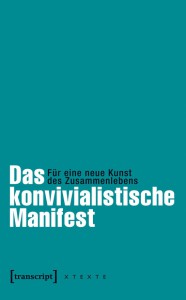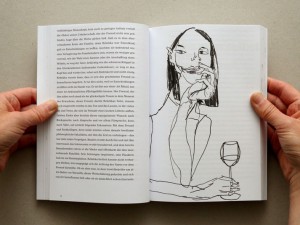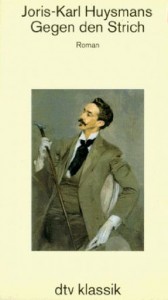„Nie in Mode gewesen“ – Julien Gracq und seine „Lebensknoten“
In der Handschriftenabteilung der „Bibliothèque Nationale de France“ befinden sich neunundzwanzig mit „Notules“ (Randnotizen) betitelte Hefte des Schriftstellers und Dichters Julien Gracq. Ihre Veröffentlichung hat der Autor bis 2027, zwanzig Jahre nach seinem Tod, untersagt. Jedoch hatte Gracq einige Prosastücke ins Reine geschrieben und zum Abtippen gegeben, die 2021 in Frankreich unter dem Titel „Noeuds de vie“ („Lebensknoten“) und jetzt in der Friedenauer Presse auf Deutsch erschienen sind.
Abseits des Literaturbetriebs
Nachdem Julien Gracq mit seinem ersten Roman „Auf Schloss Argon“ (1938) und seinem einzigen Theaterstück „Le Roi pêcheur“ (UA 1949) bei Verlagen und Kritikern nicht die erhoffte Anerkennung fand, wandte er sich enttäuscht vom französischen Literaturbetrieb ab, unterrichtete unter seinem bürgerlichem Namen Louis Poirier bis zu seiner Pensionierung im Alter von sechzig Jahren als Gymnasiallehrer Geografie und Geschichte, schrieb in dieser langen Zeit ununterbrochen weiter, hielt sich aber von der Öffentlichkeit fern. Das änderte sich auch nicht, als ihm 1951 für seinen Roman „Das Ufer der Syrten“ der Prix Goncourt zuerkannt wurde. Die bedeutende Auszeichnung nahm er nicht an – eine solche Ablehnung war beispiellos in der Geschichte des renommierten Preises, was umso mehr für Furore sorgte. „Es ist für einen Schriftsteller heute ein Glücksfall, nie in Mode gewesen zu sein, sondern in einer Zone des Rückzugs und Halbschattens verweilt zu haben“, wird er später in einem seiner Notizbücher festhalten.
In den letzten Lebensjahren zog er sich in seinen Geburtstort Saint-Florent-le-Vieil an der Loire zurück, wo er 2007 im Alter von 97 Jahren starb. „Nie in Mode gewesen“ – das schließt einige bedeutsame Ehrungen und eine große Zahl literaturwissenschaftlicher Studien über den Autor und sein Werk nicht aus. Julien Gracq gehört zu den wenigen Literaten, deren Gesamtwerk bereits zu seinen Lebzeiten in die „Bibliothèque de la Pléiade“ aufgenommen wurde, die in Frankreich gleichsam den Kanon der Literatur bestimmt.
Nähe zum Surrealismus
Anfang der 1930er Jahre entdeckte der Zwanzigjährige das „Manifest des Surrealismus“ und André Bretons 1928 erschienenen Roman „Nadja“, der ihn tief beeindruckte. Umgekehrt schuf er durch die Zusendung seines ersten Romans an André Breton auch die Voraussetzung, um von den Surrealisten entdeckt und als einer der Ihren wahrgenommen zu werden. Seine Nähe zum Surrealismus wird beispielsweise in den frühen Prosagedichten des Bandes „Liberté Grande“ (1946) deutlich, aus dem die Literaturzeitschrift „Sinn und Form“ (Heft 1, 2019) eine Auswahl veröffentlichte, die ebenso wie der vorliegende Band „Lebensknoten“ von Gernot Krämer ins Deutsche übersetzt wurde.
Julien Gracq wird mit Breton bis zu dessen Tod 1966 eine lebenslange Freundschaft verbinden. Gleichwohl blieb er skeptisch gegenüber so manchem, wodurch sich der Surrealismus auszeichnet. Mit dessen Ursprüngen aus der Dada-Bewegung konnte Gracq wenig anfangen. Ebenso wenig sah er in der „Écriture automatique“, dem Schreiben unter Ausschaltung aller inneren Kontrollinstanzen, einen Ansatz, den zu verfolgen sich für ihn gelohnt hätte. Er trat auch nie, wie ein Großteil der Surrealisten, in die Kommunistische Partei ein, und es lag ihm fern, sein Schreiben in den Dienst der Revolution zu stellen.
Gracq betont jedoch wie die Surrealisten die Kraft von Träumen. Bei seinem bevorzugten kleinen Schreibtisch, von dem ein Foto in den Band aufgenommen wurde, ist ihm die Nähe zum Bett wichtig, als „Symbol für Rückzug und nächtlichen Rat“. Wie aus einer anderen Notiz hervorgeht, teilt er jedoch keineswegs die Begeisterung vieler Surrealisten für Traumdeutung und die psychoanalytischen Theorien Sigmund Freuds. „Wie sollte man nicht argwöhnisch sein gegen einen Magier, dessen Zaubertricks die Rätsel weitgehend erst schaffen, die er lösen will?“
Verlockende Fahrten
Für den Band „Lebensknoten“ hat die Herausgeberin Bernhild Boie die literarischen Miniaturen in vier Themenbereiche untergliedert. Im ersten Teil führen uns Notizen unter der Überschrift „Wege und Straßen“ durch verschiedene Landschaften Frankreichs und der Schweiz, etwa von Sancerre aus nordwestlich durch die als finster beschriebene Sologne – „Frankreichs Kuhle, (…), ein stehender, eingekellerter Nabel, den nur selten der Wind besucht und der wie ein Tümpel unter grünem Schaum schläft“; in das winterliche Loire-Tal und durch die rechts und links des Flusses gelegenen Orte.
Die Landschaften der Vendée und der Bretagne stellt Gracq vergleichend gegenüber – in detailreichen sprachlichen Momentaufnahmen, mit denen der Autor Stimmungen evoziert. Vom Boot aus betrachtet er das französische und das Schweizer Ufer des Genfer Sees, das sich mit den Jahren nicht zu seinem Vorteil verändert hat. So beginnt der Band mit mehreren Fahrten, die trotz ihrer stillen Melancholie zum Nachreisen verlocken. Auf seinen Spaziergängen rund um seinen Geburts- und letzten Rückzugsort Saint-Florent-le-Vieil empfindet Gracq auch in der vertrauten Umgebung „keine Ruhe, kein ermutigendes Gefühl der Beständigkeit, sondern eher das sorgenvolle Unbehagen, das uns vor einer zur Fällung markierten Baumgruppe beschleicht, vor einem vertrauten Bauwerk, das abgerissen werden soll (…)“. Im Garten seines Großvaters erinnert er sich an „einen auf Spalier gezogenen Apfelbaum und einen Streifen Wermutsetzlinge“.
Kristallisationspunkte
Während sich der erste Teil den räumlichen Bewegungen widmet, versammelt der zweite Teil, „Augenblicke“, verschiedene Kristallisationspunkte im Längsschnitt der Zeit, historische Momentaufnahmen oder Erlebnisse von subjektiver Wichtigkeit. Für das Jahr 1945 stellt er in Frankreich „in jeder Hinsicht eine Krise des Ausdrucks“ fest; die Zeit schreie „verzweifelt nach einer Form“ – „Ein Verlangen nach Dichtern vielleicht, auf jeder Ebene.“ Eine Ausstellung im Invalidendom zum sogenannten „Sitzkrieg“ (im Französischen bekannt als „Drôle de guerre“), der von September 1939 bis Mai 1940 andauerte und den Gracq als Soldat erlebte, enttäuscht ihn durch ihre, wie er findet, dürftigen, belanglosen Exponate. „Nichts verbindet diese mittelmäßigen Beweisstücke mit dem taghellen Somnambulismus, der sich acht Monate lang einer ganzen Nation bemächtigt hatte.“
Kriegsschilderungen
Gracq weiß, wovon er spricht, hat er doch in zahlreichen Prosaskizzen den Zweiten Weltkrieg in unideologischer, poetischer Sprache eindringlich festgehalten – die Absurdität eines gewaltigen, desorganisierten Militärapparats, surreal und als komische Farce. Julien Gracqs „Manuscrits de guerre“ wurden 2011 posthum aus seinem Nachlass veröffentlicht und sind als „Aufzeichnungen aus dem Krieg“ (2013) im Literaturverlag Droschl erschienen. Aber auch in seinen Romanen wie „Das Ufer der Syrten“ (1951) und „Der Balkon im Wald“ (1958) ist der Krieg präsent. In Besprechungen und literaturgeschichtlichen Arbeiten zu Gracq wurde auf die frühe, ihn prägende Lektüre von Ernst Jüngers „Auf den Marmorklippen“ hingewiesen, einem Autor, mit dem er sich später anfreunden sollte; zwei Schriftsteller der „alten Schule“. Aus manchen seiner Texte spricht eine Haltung, ähnlich wie Gracq sie 1986 im Gespräch mit Jean Carrière geäußert hat (von Bernhild Boie in ihrem Vorwort zitiert): „(…) man kann die Welt sehr wohl als unersetzliches Wunder für den Menschen betrachten und in aller Gelassenheit bar jeder Hoffnung sein.“
Der Autor als Leser
Gracqs frühe Lektüren zeugen von einer Vorliebe für Abenteuer und Phantastik: James Fenimore Cooper, Jules Verne, Robert Louis Stevenson, E. A. Poe, „Die Gesänge des Maldoror“ von Lautréamont. Gracq benennt die Imagination als „eine Vitalfunktion genau wie die Atmung“, ja mehr noch: „sie ist es, die die Luft atembar macht.“ Als handele es sich dabei um eine Selbstverständlichkeit, setzt er solche literarischen Preziosen in die Klammern eines Satzes, der auf Pierre Reverdy und nebenbei auch auf Hegel antwortet. Im dritten Teil der „Lebensknoten“ können wir einige der klugen Beobachtungen des lesenden Autors Julien Gracq goutieren. Etliche Schriftsteller des 19. und 20. Jahrhunderts geraten unter sein Seziermesser und werden entweder für ihre Verdienste gewürdigt, oder aber es werden, oft mit einem von Ironie gewürzten Urteilsvermögen, ihre Schwächen aufgezeigt.
Da ist Stendhal, den er früh schon bewunderte, Arthur Rimbaud, mit dem er sich sehr gut auskennt, Henry de Montherlant, dessen „herrliche Sprache“ darüber hinwegtäuschen könnte, „dass er doch nur das tägliche Brot austeilt.“ Zwei Buchseiten über J. R. R. Tolkien – und damit eine der längsten Notizen dieses Bandes – mögen überraschen. Die Lektüre von „Der Herr der Ringe“ erlebt er als befreiend, nicht zuletzt, weil nach seiner Lesart das dort beschriebene Geschehen unter kompletter Auslassung „geltender und praktizierter Religionen entstanden“ sei. „Hier treffen Mächte aufeinander und nicht Werte; nicht Gut und Böse, sondern weiße Mächte und schwarze Mächte.“ Gracqs Anfang der fünfziger Jahre begonnenes, aber erst posthum veröffentlichtes Romanfragment „Das Abendreich“ wurde von einigen Kritikern mit Tolkiens Großepos verglichen.
Dichterisches Selbstverständnis
Aus seinen scharfsinnigen Analysen und pointierten Kommentaren zu Zeitgenossen und älteren Autoren spricht ein dichterisches Selbstverständnis, das sich, wie selbst die relativ wenigen in „Lebensknoten“ versammelten Notizen erkennen lassen, zu einer eigenen Poetologie erweitert. „Niemand ist wirklich in Kommunion mit der Literatur, der nicht das Gefühl für das Ganze hat, das noch im kleinsten ihrer Teile vorhanden ist.“ Bei einem Roman sei die „Navigation“ entscheidender als „die Häfen und Landstriche, die unterwegs besucht werden.“ Es gelte zunächst, eine „bestimmte Anfangsgeschwindigkeit zu erreichen“, danach dürften Kräfte auf den „vorwärts getriebenen Körper einwirken, die seine Richtung verändern, ihn bremsen, wieder beschleunigen.“ Die Macht der Bewegung müsse stark genug sein, um jeden Gedanken an ein Ziel auszulöschen. Darüber werde das Sujet beinah nebensächlich.
Worauf es beim Romanschreiben ankommt
Einige solcher Statements, die er in der Auseinandersetzung mit schreibenden Zeitgenossen entwickelt, werden im vierten Teil der Textsammlung aufgegriffen, wenn es um Gracqs eigenes Schreiben geht. Eine Formulierung Paul Valérys zum Vorausdenken beim Schach und die Übertragbarkeit dieser Fähigkeit auf das Schreiben von Romanen nimmt er zum Anlass, darzulegen, worauf es ihm beim Schreiben mehr noch ankommt als auf das Durchspielen vieler möglicher Varianten: Auf die „Fähigkeit, blitzschnell, instinktiv zwischen aufscheinenden Kombinationen zu wählen, automatisch, ohne auch nur zehn Sekunden zu verschwenden, acht von zehn Möglichkeiten auszuschließen.“ Ein „Tastsinn für Positionen“, die „Fähigkeit umfassender Ortung“ – „Am Anfang eines Romans steht keineswegs die tatsächliche Richtung des künftigen Werks, sondern das Vorgefühl seiner Autonomie.“ In einer anderen Notiz hält er folgerichtig fest: „Seinen Zauber und seine Würze erhält ein Roman allein durch das Schwänzen der Schreibschule und nicht durch den unfehlbaren Konstruktionsplan.“
Solche Sätze machen neugierig auf Julien Gracqs Romane, die in insgesamt 26 Sprachen und von denen mehrere auch auf Deutsch erschienen sind. Hoffentlich gelingt es dem schönen und handlichen Band aus der Friedenauer Presse, den Autor Julien Gracq auch Leserinnen und Lesern zugänglich zu machen, die bislang noch nicht zu seinen Verehrern zählten. Die Voraussetzungen dafür dürften durch die gelungene Übersetzung geschaffen und der Zeitpunkt für eine (Wieder-)Entdeckung des Autors dürfte mehr als reif sein.
Julien Gracq: „Lebensknoten“. Aus dem Französischen von Gernot Krämer. Friedenauer Presse, 174 Seiten, 20 Euro.