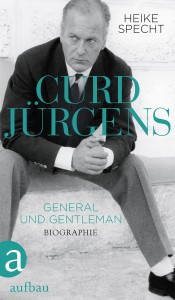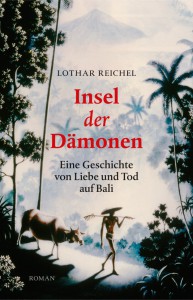Schöner Skandal: Dortmunds Schauspielchef Voges mischt mit „Freischütz“ Hannover auf

Ein „Freischütz“ sorgt für Wirbel in Hannover. Inszeniert hat die umstrittene Produktion der Dortmunder Schauspielintendant Kay Voges. Foto: Werner Häußner
Das ist doch schön! In stumpf gewordenen Zeiten, in denen all die vaginal-anal-erektionale Blut-Sperma-Fäkalmetaphorik des postzeitgenössischen Theaters nur noch Augenrollen oder Schulterzucken hervorruft, schafft die Oper einen Skandal. Richtig befreiend, dass sich sogar die Politik wieder einmal mahnend zu Wort meldet. Wunderbar, dass die CDU-Ratsfraktion in Hannover die Schätze, die uns Dichter und Komponisten hinterlassen haben, „ins Niveaulose und Beliebige“ gezerrt sieht. Inzwischen gibt es sogar eine Anfrage der Landtags-CDU ans niedersächsische Kultusministerium. Und in der Kulturszene Hannovers hält die Debatte an.
Besser hätte es nicht laufen können: Wenn, wie maliziös orakelt, mit einem kleinen Skandal kalkuliert wurde, ist die Rechnung aufgegangen: Mit Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ in der Form, wie sie der Regisseur übriggelassen hat, hat’s die Niedersächsische Staatsoper Hannover wieder einmal übers Feuilleton hinaus auf den Presse-Boulevard geschafft.
Der Mann hinter der Aktion heißt Kay Voges und sorgt als Intendant des Schauspiels in Dortmund seit 2010 für erhöhte Aufmerksamkeitswerte. Nach fünf Jahren hat er es geschafft, seine Bühne in der Kritikerumfrage von „Theater heute“ auf Platz zwei hinter dem Burgtheater Wien zu platzieren und mit Bühnen wie der Berliner Schaubühne gleichzuziehen. Seine erste Opernregie, Wagners „Tannhäuser“ 2013 am Dortmunder Opernhaus, schwankte zwischen Bildkaskaden und Hintersinn.

Kay Voges. Foto: Birgit Hupfeld – Da die Staatsoper Hannover keine honorarfreien Fotos zum „Freischütz“ zur Verfügung stellt, verzichten wir aus finanziellen Gründen auf eine aktuelle Bebilderung der Rezension.
Die deutsche Romantik scheint den aufstrebenden Theatermann nicht loszulassen. Scharfsichtig hat er im „Freischütz“ das Potenzial erkannt, auf das sich virtuos die Stilmittel postdramatischen Theaters übertragen lassen: die offene Heterogenität des Librettos, der aus der französischen Opéra comique herkommende Wechsel zwischen gesprochenem Text und Gesang, der freie, kühne Einsatz der Formen. Und dazu die Reizwörter, die sich seit jeher mit Webers Oper verbinden: national, deutsch, Wald, Volk, Jagd. „Der Freischütz. Die deutsche Nationaloper“ prangt auch auf dem Vorhang, bevor jemand zaghaft um Hilfe ruft.
Das dünne Stimmchen gehört zu einem wunderlichen Gnom: „Okidoki“ sagt der Kleine, halb Gollum, halb Knetmännchen, mit Kartoffelnase, riesigen Segelohren und dicken Wurstfingern. Die Zentralgestalt des Werkganzen steht vor uns. Eine Comic-Figur, allein vor dem Vorhang. Während der Ouvertüre wird sie auf einem Video durch dunkle Gewölbe deutschen Wesens streifen, vorbei an schemenhaft beleuchteten Bildern: Bismarck, die Gebrüder Grimm, Wagner, Adenauer. Später entpuppt sie sich als das schöpferische Prinzip: „Samiel versucht sich an einer deutschen Nationaloper“ heißt es über der Inhaltsangabe im Programmheft.
Peinvolle Kreation einer „Nationalopaa“
Böse ist dieses Wesen nicht, wenn es aus unartikulierten Lauten stockend „national“ und „Nationalopaa“ formt, wenn es in einer der überbordend vielen Projektionen Leinwände bemalt und über Europakarten braune Brühe verschmiert, schwärmerisch Musik mitdirigiert, sich vor Pein am Boden windet, verzückt oder gequält die Augen verdreht oder die Zähnchen fletscht – alles in Großaufnahme und teils von der Live-Cam mitverfolgt. Lustig kann es sein, wenn es die Handlung anhält, mit den Darstellern schimpft und hadert – oder Kaspar aufklärt, er sei „der Selbstbezug des denkenden Subjekts als Möglichkeit einer Rückkehr vom Äußeren zum Eigenen“. Max schreit an dieser Stelle: „Mir reicht’s!“ In der Premiere, Berichten zufolge, tönte aus dem Publikum: „Uns auch.“
Der Schöpfer-Gnom, mit dem die Dortmunder Schauspielerin Eva Verena Müller eine Glanzleistung liefert, ist eine Figur, in der die Aspekte von Komponist, Librettist und Regisseur verschmelzen. Genau wie in der Form von Theater, die Voges im Kopf hat. In der Wolfsschlucht-Szene, deren Beginn mit dem Vollmond ein romantisches Symbol zitiert, trinkt das Wesen blutige Milch und mutiert mit kahlem Schädel und Pimmelchen unterm Hemd zum Samiel, der das Zaubergebräu mischt und am Ende eine braune Partitur gebiert: den „Freischütz“. Am Ende markiert es mit schwarz-rot-goldener Bommelmütze exakt die Bruchstellen, an denen das Finale ganz anders hätte weitergehen können, und führt den Eremiten in weißem Wallegewand mit silbernen Haaren und Bart auf die Bühne. Kein Problemlöser, sondern der Gott der Kitschbilder frommer Andacht. „Fest auf die Lenkung des Ewigen“ gebaut wird hier nicht. Die Vision sieht anders aus: Ein Dunkelhäutiger schwenkt die Deutschlandfahne.
Dazwischen überzieht Voges den „Freischütz“ mit einer Bilderflut, gegen die Christoph Schlingensiefs „Parsifal“ minimalistisches Zeichentheater war. Voxi Bärenklau, 2004 in Bayreuth dabei, liefert Wogen bewegter Bilder, darunter in irrwitzigem Staccato geschnittene Fetzen aus der aktuellen Berichterstattung von den Pariser Anschlägen bis zu Politikerreden, Nazi-Transen oder Capri-Sonne zullenden Zwergen. Was das Repertoire an „deutschen“ Zerrbildern hergibt, flimmert über einen Gazevorhang oder die Projektionsflächen des Bühnenbaus von Daniel Roskamp, der unverkennbar an Aleksandar Denićs Tankstelle aus dem Bayreuther Castorf-Ring erinnert. Live-Kameras (Jan Voges, Vlad Margulis) kehren das Innere des traurigen „Okidoki“-Vergnügungsetablissements nach außen: Die Gleichzeitigkeit der Szenen als Metapher medial überfluteter Wahrnehmung.
Kastrationsangst und Potenzprobleme
Damit’s auch richtig sitzt, verzichtet Voges nicht auf erläuternde Schriftprojektion. Deutsche Freiheit, ist zu lesen, wird am Hindukusch verteidigt. Der Sternschuss zu Beginn ist ein Brandanschlag: Im Hintergrund laufen die entsprechenden Daten über einen Bildschirm, während Max, ein dicklicher Stubenhocker, von Neonazigestalten mit Baseballschlägern bedrängt wird. Kilian, in Fußballtrikot, reißt ihm die Hose runter – am Schirm ist „Kastrationsängste und Potenzprobleme“ zu lesen.
Und dann folgt das Video, das die Staatsoper veranlasst hat, das Besucher-Mindestalter auf 16 festzulegen: Max liegt auf einem Seziertisch und nachdem drei Nazis zu „Wir lassen die Hörner erschallen“ lustvoll steife Glieder bearbeitet hatten, wird der Penis des unglücklichen Jägers Opfer einer Schere. Wie in einer schlecht gemachten Retusche eines Fünfziger-Jahre-Films strömt das Blut – am Ende der Szene wankt dem Sänger sein Double mit blutiger Boxershorts entgegen.
Ohne Zweifel: Kay Voges inszeniert in Hannover seinen „Freischütz“ auf der Höhe des aktuellen Theaters. Er ist freilich nicht der erste. Zu erinnern ist an die Berliner Arbeit Calixto Bieitos, vor allem aber an den „Freischütz“ Sebastian Baumgartens 2013 in Bremen. Der hat bei der Ausleuchtung düsterer Abgründe der deutschen Seele Faschismus und Kolonialismus aufzudecken versucht. Das führte zu fesselnden, beklemmende Bildern, zeigte aber auch, dass Webers Werk nur begrenzt und ziemlich zurechtgebogen dazu taugt, mit der deutschen Geschichte ins Gericht zu gehen.
Vordergründige Eindruckswerte
Ähnliches muss gegen Voges‘ Gegenwartsbefragung auf Hannovers Bühne eingewandt werden. Sicher, wenn die Jäger von ihrem Vergnügen singen, das die Glieder erstarket, wenn sie männlich‘ Verlangen und volle Pokale besingen, dann gibt dieser Hit der Opernmusik, unterlegt mit einem Video von einer Pegida-Demo mit lauter mürrischen Gesichtern – Linksautonome dürften allerdings auch nicht fröhlicher dreinblicken, wenn sie gegen „Faschisten“ marschieren –, ein wirkungsvolles Bild gefährlicher politischer Dumpfheit. Doch über die Ebene eines scheinbar unmittelbaren Einleuchtens kommen solche Regiemittel nicht hinaus.
Das ist das Problem: Voges‘ bilderreiches politisches Statement gegen das „Nationale“ kommt nicht über vordergründige Eindruckswerte hinaus und trägt außer hochemotionalisierter Clips nichts zur Analyse des Phänomens bei. Es kann auch Webers oder Kinds Begriff des „Nationalen“ nicht adäquat einholen oder in die Gegenwart übersetzen. Denn damals ging es – mit der französischen Kriegswalze im Hintergrund – um eine freie deutsche Nation, gegen die Willkürherrschaft der Fürsten in Kleinstaaten, gegen Zensur und Unfreiheit, für die Mitbestimmung des Volkes. Alles andere als eine „allzu simple Heilsbotschaft“, wie sie Voges in einem Interview im Programmheft dem Eremiten unterstellt. Das Werk wird auch derzeit von niemandem als „Zeugnis eines dumpf-aggressiven Nationalgefühls“ missbraucht, wie Voges argwöhnt. Der Schuss geht daneben – und der Eindruck bleibt, hier werde Webers Werk als Vehikel für ein arg durchsichtiges politisches Statement benutzt.
Das „Nationale“ ist einer der Diskurspunkte in einer Regiearbeit, die sich ansonsten der Hermeneutik verweigert. Bewusst – und darin wieder auf der Höhe der Zeit, wie etwa in der bildenden Kunst schon lange – bleibt der Weg offen, den sich der Zuschauer durch den Dschungel der Impressionen bahnt. Wo die Grenze zu Beliebigkeit liegt, ist schwer auszumachen, denn Voges ist, so anfechtbar sein Ansatz auch sein mag, in der Setzung seiner Bildwelten präzis. Ein anderes Thema, das sich unschwer festmachen lässt, ist der Sex: Dazu fällt Voges noch weniger Substanzielles ein. Dass „Leid oder Wonne“ in Maxens „Rohr“ ruhen, darüber feixten die Achtklässler schon lange, die jetzt aus dem Hannoveraner „Freischütz“ ausgeschlossen sind. Und die „Kastrationsangst“ mit den unsichtbar grollenden Mächten zu assoziieren, die Max im ersten Akt fürchtet, hat mit Sigmund Freud oder Jacques Lacan wohl wenig zu tun.
Musik gibt’s dann auch noch
Ach so – Musik gibt’s ja auch noch! Karen Kamensek müht sich mit dem Niedersächsischen Staatsorchester redlich, die Marginalisierung zu vermeiden; von einer gleichwertigen Rolle der Musik zu sprechen, wäre in Anbetracht der Bildfluten vermessen. Sie wird vom Träger des Ausdrucks zur effektsteigernden Untermalung gewandelt. Mehr als eine ordentliche Wiedergabe mit kühlen, spröden Farben war nicht drin. Die Sänger sind zu bewundern: Die Komplettbespielung der Bühne nimmt wenig Rücksicht auf die Stimmen. Häufige Close-ups fordern die Präzision des Minenspiels heraus, lassen – etwa im Falle Eva Verena Müllers – detaillierte dentalmedizinische Studien zu. Eric Laporte bewältigt als Max den Wandel von der Strickweste zur Uniformjacke bewundernswert, kämpft in den Soloszenen mit der leichten Formung der Töne und einem breit schwingenden Vibrato.
Dorothea Maria Marx muss als Agathe profilarm bleiben und singt kühl brillant, Ania Vegry steht als Ännchen am Ende für einen Dreier mit Max bereitwillig zur Verfügung und zeigt lichte, herzige Töne. Tobias Schabel, mit roter Zwergen-, Jakobiner- oder Zipfelmütze, haust in einem Kabuff mit einem Bild Beate Zschäpes an der Wand, singt mit ausgezeichnet positioniertem, lockerem Bassbariton einen Kaspar, der szenisch beinah alle Konturen verloren hat. Byung Kweon Yun übt sich als Kilian in vulgärem Auftreten; Stefan Adam ist als Ottokar ein schmieriger General wie aus einem Südamerika-Krimi, Michael Dries ein glatter Kuno, Shavleg Armasi der harmlose Eremit mit schöner Stimme. Der Chor (Leitung: Dan Ratiu) schmettert mit martialischem Ton das Jägergegröle, dass es nur so schallt: Trefflich bedient!
Weitere Vorstellungen: 31. Januar, 13. Februar, 11., 16. und 19. März 2016. Info: http://www.staatstheater-hannover.de/oper/index.php?m=244&f=03_werkdetail&ID_Vorstellungsart=7&ID_Stueck=395