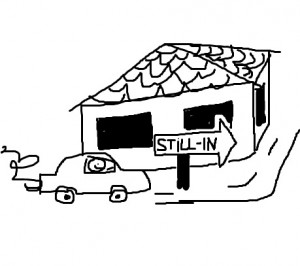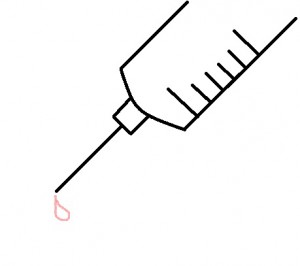Familienfreuden auf Reisen
Jetzt geht es also los. Auf große Reise. Ganz ernsthaft. Was haben wir uns da angetan?
Ok, das war jetzt wieder so ein kurzer Schreckgedanke – aber eigentlich freue ich mich tierisch. Denn: Wir fliegen gleich los, nach San Francisco. Unsern Traum erfüllen. Fünf Wochen wollen wir mit Fi durch die Gegend cruisen, hoch bis nach Seattle, auf dem Weg viele Nationalparks, die nicht so bekannt sind, aber so klingen, als würde man sie nie wieder vergessen. „Schuld“ an diesem Vorhaben ist ein munteres Pärchen, das wir vor Jahren in Australien mit ihrem Baby getroffen haben und das uns vorschwärmte, dass man seine Elternzeit kaum besser verbringen könne als mit so einem Trip. Stimmt eigentlich, dachten wir. Und da war der Floh im Ohr.
Hinter uns liegen jetzt einige Monate der schrägsten Reisevorbereitungen, die ich bisher erlebt habe. Dem Herrn im Reisebüro dürften noch heute die Ohren klingeln von all unseren Fragen. Seinen Vorschlag, ein neun (!) Meter langes Wohnmobil zu nehmen statt des jetzigen, stolzen siebeneinhalb Meter langen – weil günstiger – haben wir trotzdem abgelehnt. Ich sah uns schon kurvenreiche Nationalparks durchfahren, beobachtet von sich Tatzen reibenden Bären, die sich auf den nächsten leckeren Snack in der Dose freuten.
Weitaus weniger einfach war die Frage, ob unser Kindersitz im Flugzeug zugelassen wäre. Der erste Anruf bei der amerikanischen Fluglinie brachte die Bekanntschaft eines jungen Amerikaners, der seine (mäßigen) Deutschkenntnisse strikt an mir ausprobieren wollte und schlussendlich vorschlug, ich könne das sicher googeln. Beim zweiten Versuch, direkt bei der amerikanischen Hotline, wurde mein Mann Normen mit den munteren Worten abgespeist: „If it’s approved by the Germans, it’s ok!“ Na, da scheint der Ruf der Deutschen ja noch gut zu sein…
Letzte Woche habe ich dann eine mir bislang unbekannte Form der „ich muss horten“-Panik erlebt: Mindestens eine halbe Stunde stand ich vor dem Babynahrungs-Regal im Drogeriemarkt meines Vertrauens und überlegte, ob jeweils ein Glas Schinkennudeln und Bio-Kalb mit Karotte reichen würden. Als ich mit einer zum Bersten gefüllten Tasche nach Hause kam, rieb Normen sich die Augen, als wäre er in Alices Wunderland. Behutsam erklärte er mir, dass wir sicher auch in den USA Babynahrung bekämen, was ich ihm nach Vorlage diverser Supermärkte in San Francisco Downtown auf Google Maps auch glaubte (obwohl ich doch im Internet noch einmal recherchiert habe, ob die angebotenen Gläschen auch wirklich ohne Zusatzstoffe auskommen). Tja, als Ma lernt man sich selbst neu kennen…
Jedenfalls sind die Koffer gepackt, der Bauch fliegt jetzt schon – und Fiona erlebt gleich den ersten Flug ihres Lebens!