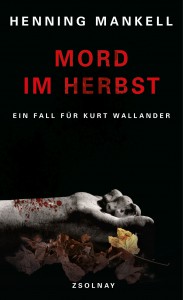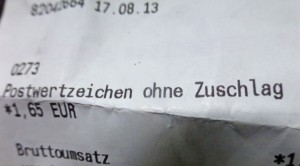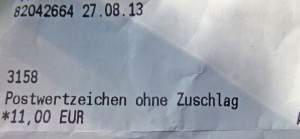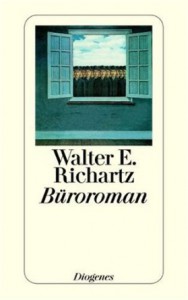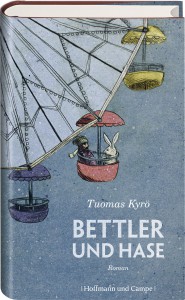Vor einigen Wochen habe ich mich an dieser Stelle von meinem langjährigen Abo der „Westfälischen Rundschau“ verabschiedet, weil diese Geisterzeitung keine eigene Redaktion mehr hat. Im April, der sich nun dem Ende zuneigt, habe ich ein Monats-Probeabo der Ruhrnachrichten (RN) bezogen. Ich werde es nicht in einen regulären Bezug übergehen lassen. Und warum nicht?
Ohne ins Detail einzelner Beiträge gehen zu können, sei eine Begründung gewagt. Vorab noch dies: Es geht hier nicht um Kollegenschelte, sondern um (Auswirkungen von) Strukturen.
 Der Dortmunder Lokalteil (der seit Anfang Februar auch in der „Rundschau“ zu finden ist) mag angehen. Sie versuchen, „nah am Leser“ zu sein, wie es so schön heißt. Freilich bekommt man jetzt über Wochen hinweg den Eindruck, dass dort die tägliche Anspannung nachgelassen hat. Die RN haben am Ort keine Tageszeitungs-Konkurrenz mehr, können also hin und wieder die Zügel schleifen lassen.
Der Dortmunder Lokalteil (der seit Anfang Februar auch in der „Rundschau“ zu finden ist) mag angehen. Sie versuchen, „nah am Leser“ zu sein, wie es so schön heißt. Freilich bekommt man jetzt über Wochen hinweg den Eindruck, dass dort die tägliche Anspannung nachgelassen hat. Die RN haben am Ort keine Tageszeitungs-Konkurrenz mehr, können also hin und wieder die Zügel schleifen lassen.
In dieser Stadt und ihrem Umland muss jetzt jeder, der öffentlich wirken will, sich – noch mehr als vordem – mit den Ruhr Nachrichten gut stellen. Im Gegenzug geht diese eher CDU-geneigte Zeitung aber auch meist nicht allzu kritisch mit jenen um, die das Sagen haben. Niemand, und hätte er noch so ein edles Anliegen, kann ihnen mehr so kommen: „Wenn Sie es nicht bringen, dann gehe ich eben zur Konkurrenz…“
Auch habe ich mir glaubhaft sagen lassen, dass einzelne RN-Redakteure nun auf ziemlich hohem Ross sitzen, was etwa den Umgang mit Veranstaltern angeht. In einer Quasi-Monopolstellung glauben manche wohl, dass sie es sich halt erlauben können.
Die eigentliche Schwäche der Ruhrnachrichten ist allerdings der (über)regionale Haupt- oder Mantelteil. Es gibt Tage, da stammen gefühlte oder auch gezählte 70 bis 80 Prozent der Nachrichten und Berichte von den Agenturen dpa oder AFP. Das heißt, sie werden eben nicht in Dortmund recherchiert und geschrieben, sondern hier nur aufbereitet und zusammengestellt, gelegentlich auch kommentiert. So wirft sich die offenbar unterbesetzte Mantelredaktion nicht gerade häufig mit eigenen Schwerpunkten und Akzenten in die Bresche. Eine Ausnahme bildet die ansonsten allenfalls mittelprächtige Kulturseite. Hier wartet man überwiegend mit Eigenbeiträgen auf.
Nach dem Kraut- und Rüben-Prinzip
Die Verteilung im Blatt scheint – beginnend mit einer oft chaotisch layouteten Titelseite – vielfach dem Kraut-und-Rüben-Prinzip zu folgen. Man hat es versäumt, das Erscheinungsbild behutsam zu modernisieren und zu ordnen. Jetzt verspürt man wohl erst recht keinen Druck mehr, dies kostspielig nachzuholen.
 Bei den Aufmachern auf der Titelseite ist die Redaktion zuweilen nicht allzu wählerisch. Tiefpunkt in den letzten Wochen war in der Ausgabe vom 9. April ein lieblos zusammengeschusterter, höchst redundanter Textaufmacher übers Wetter („Jetzt kommt der Frühling“), in dem gleich mehrfach zeilenschinderisch betont wurde, dass Regen der Preis für höhere Temperaturen sein werde. Zeitungen, die etwas auf sich halten, fangen ein solches Thema vorne lieber mit einem guten Bild auf und bringen einen etwaigen längeren Text im Inneren. Weiteres Beispiel ähnlichen Kalibers: Am 17. April wurden Rangeleien zwischen BVB-Fans um Tickets fürs Heimspiel gegen Madrid zum Aufmacher der ersten Seite.
Bei den Aufmachern auf der Titelseite ist die Redaktion zuweilen nicht allzu wählerisch. Tiefpunkt in den letzten Wochen war in der Ausgabe vom 9. April ein lieblos zusammengeschusterter, höchst redundanter Textaufmacher übers Wetter („Jetzt kommt der Frühling“), in dem gleich mehrfach zeilenschinderisch betont wurde, dass Regen der Preis für höhere Temperaturen sein werde. Zeitungen, die etwas auf sich halten, fangen ein solches Thema vorne lieber mit einem guten Bild auf und bringen einen etwaigen längeren Text im Inneren. Weiteres Beispiel ähnlichen Kalibers: Am 17. April wurden Rangeleien zwischen BVB-Fans um Tickets fürs Heimspiel gegen Madrid zum Aufmacher der ersten Seite.
„Da müssen wir durch – jeden Tag“
Die RN-Redaktion scheint gelegentlich froh zu sein, wenn sie meint, nicht mit Politik oder Wirtschaft „nach oben gehen“ zu müssen. Sie nutzt in diesem Sinne beinahe jede Chance. Politik ist ja auch garstig. Hauptsache, dass die im Schnitt herzlich harmlosen Glossen-Dreispalter am Fuß der Titelseite stehen und arglos milde Laune stiften. Just heute (30. April) steht da, sozusagen in eigener Sache, eine Glosse über die Flut oft bedeutungsloser Informationen, denen Journalisten ausgesetzt seien. Seufzer am Schluss: „Aber wir müssen da durch – jeden Tag“. Ach, die Kollegen tun einem leid.
Apropos BVB. Als Kennzeichen journalistischer Unabhängigkeit gilt es, sich nicht mit einer Sache gemein zu machen – ein Prinzip, gegen das in der Regionalpresse und speziell in Sportteilen häufig verstoßen wird. Die Ruhrnachrichten sind mächtig stolz darauf, als „Medienpartner“ des BVB zu firmieren und auf der Erfolgswelle des Vereins mitzuschwimmen. Ein Signal für die seit jeher enge Verbundenheit war es, dass der ehemalige RN-Sportredakteur Sascha Fligge 2012 als Pressesprecher zur Borussia gegangen ist. Schon sein Vorgänger Josef Schneck war von den Ruhr Nachrichten zum BVB gekommen. Da kann man von einer langjährigen Liaison sprechen.
Die Euphorie gänzlich verfehlt
Umso unverständlicher die RN-Titelseite vom 10. April – nach dem wahnwitzigen 3:2 gegen Málaga, das unbedingt in die Annalen des BVB eingeht. Die stocknüchterne Schlagzeile „3:2 – BVB im Halbfinale“ gibt auch nicht annähernd die euphorische Stimmungslage des Abends wieder – das müssen die Kollegen hinten im Sportteil besorgen („Wahnsinn in Schwarzgelb“). Erst einen Tag später sucht man das Versäumte auf Seite eins mühsam wettzumachen. Doch da passiert gleich der nächste Lapsus: Textaufmacher ist diesmal aus unerfindlichen Gründen die laue Vermutung, dass es eventuell „doch keinen zweiten verkaufsoffenen Adventssonntag geben“ werde. Wohlgemerkt, in der Augabe vom 11. April. Welch ein „Aufreger“…
Nach dem Anschlag beim Boston-Marathon bringt man es am 20. April fertig, das vermutlich nichtssagendste von allen verfügbaren Fotos auf die Titelseite zu stellen; noch dazu in einem unsinnigen Bildzuschnitt. Man vergleiche nur, was andere Zeitungen am selben Tag gebracht haben.
Natürlich gibt es auch gelungene Ausgaben, lesenswerte Texte, ansehnliche Bilder. Doch Tag für Tag finden sich lieblose Überschriften, die oft genug in die Irre führen und vom Text nicht gedeckt sind; Texte, die ihr Thema bei weitem nicht durchdringen und einen ratlos zurücklassen. Und immer mal wieder kommt es zu gravierenden Fehleinschätzungen. So fand sich zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Platzvergabe im NSU-Prozess auf der Titelseite nur eine dürre 11-Zeilen-Meldung.
Dauerhaftes Manko: Eine richtige Fernseh- oder gar Medienseite leisten sich die RN nicht, erst recht nicht mit rezensierenden Bestandteilen. Programmschema und Kurztipps müssen in aller Regel reichen.
Unerfahrene Mitarbeiter gesucht
Als sollte das Niveau noch gesenkt und die Blattproduktion nochmals verbilligt werden, suchten die Ruhrnachrichten am 17. April in einem treuherzigen Zweispalter des Dortmunder Lokalteils freie Mitarbeiter, die keine journalistische Erfahrung haben müssten.
Selbst wenn die WAZ jetzt weitere Stellen kürzt und auch ihren zentralen Essener Newsdesk verkleinert, wird sie doch im Vergleich mit den RN höchstwahrscheinlich immer noch den deutlich besseren Mantelteil vorweisen können. Ich sage das ganz nüchtern, ohne rasende Begeisterung.
Erst recht wird man wehmütig beim weiteren Blick zurück. Vor allem in jener Zeit, als es die „Westfälische Rundschau“ noch in voller Besetzung gab, hat die Konkurrenzlage auch in und um Dortmund das Geschäft belebt. Die WR-Redaktion hat stets einigen Ehrgeiz daran gesetzt, die Ruhr Nachrichten zu übertrumpfen – vielfach mit Erfolg. Mir scheint, dass auch die RN damals besser gewesen sind. Eine vergleichbare Ambition ist den Ruhrnachrichten heute nur noch selten anzumerken.
Andreas Rossmann schrieb denn auch am 28. Januar 2013 im Feuilleton der FAZ: „Die Schließung der Redaktion trifft Dortmund hart. Denn die WR war lange die bessere und, trotz SPD-Nähe und -Beteiligung, gegenüber der von Sozialdemokraten beherrschten Stadtverwaltung kritischere und engagiertere Zeitung.“
Triumph am regionalen Markt
Es ist doppelt betrüblich, dass in Dortmund, Lünen und Schwerte eine Zeitung wie die RN den Marktsieg davonträgt und gleichsam „triumphiert“. Man muss verlegerisch schon ziemlich ungeschickt operieren, um mit einem insgesamt besseren Produkt so zu scheitern.
Seit jeher haben die Ruhrnachrichten in Dortmund eine ungleich höhere Präsenz. Sie liegen in allen nennenswerten Geschäften aus, hatten stets mehr Familienanzeigen und Werbeprospekte als die Mitbewerber. Nur leicht übertrieben gesagt: Die RN scheinen zudem großen Wert darauf zu legen, dass in einem regelmäßigen Turnus alle Dortmunder auf Fotos im Blatt auftauchen. Leider wiegen solche scheinbar läppischen Äußerlichkeiten ziemlich schwer. Es geht nicht immer nur um hehren Journalismus.
Genug. Das war’s. Mit diesem Beitrag. Und mit dem RN-Abo. Und bitte, lieber RN-Verleger Lambert Lensing-Wolff, für dieses bescheidene kleine Consulting berechne ich nur den branchenüblichen Satz.