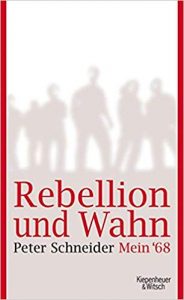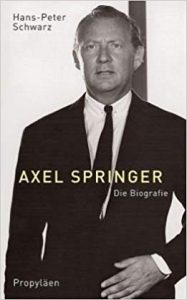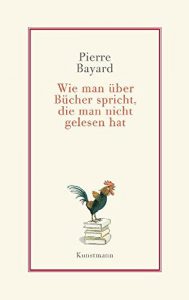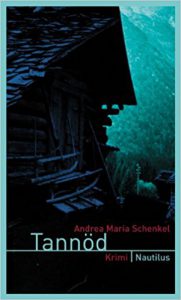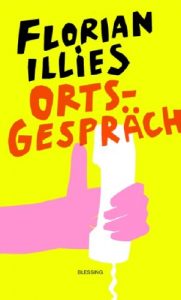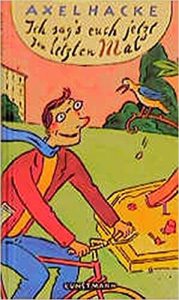Von Bernd Berke
„Rätin, er lebt!“ soll seine Großmutter erleichtert der Mutter zugerufen haben, als er endlich den ersten Schrei tat. „Mehr Licht!“ hat er angeblich selbst geflüstert, als er 1832 starb. Sozusagen zwischen den beiden Momenten verfasste er seine allzeit, aber immer wieder anders gültigen Klassiker vom „Werther“ bis zum „Faust“. Die WR hat einen stattlichen Stapel neuer Bücher über Goethe gesichtet.
Der muntere Knabe guckt oben aus dem Fenster. Doch was tut er denn da? Lachend wirft er Tassen und Teller aufs Straßenpflaster. Klirr! Drunten stehen Leute und feuern ihn an: «Mehr! Mehr!“ Das schöne Familien-Geschirr…
Die Szene, die Goethe selbst in seinen Lebenserinnerungen „Dichtung und Wahrheit“ beschreibt, trug sich in seiner Vaterstadt Frankfurt am Main zu – und kann jetzt auch im Comic-Strip betrachtet werden. Das Leben des Dichterfürsten in bunten Bildchen mit Sprechblasen? Ja, wenn es der Leseförderung dient. Das Goethe-Institut und die Stiftung Lesen haben sich in die Edition eingeklinkt. Folglich tauchen keine Kürzel wie „Ächz“ oder „Sabber“ auf, sondern vornehmlich edle Originaltexte des Olympiers („Zum Sehen geboren“ / „Zum Schauen bestellt“, Ehapa Verlag, 2 Bände, je 52 Seiten, je 19,80 DM).
Mit „Goethe – Sein Leben in Bildern und Texten“ (Insel Verlag, 414 S. Großformat, 39,80 DM) kann man visuell in die damalige Ära eintauchen: So also hat Goethes Puppentheater ausgesehen, so sein Geburtshaus und so die Stadt Frankfurt zur fraglichen Zeit.
Zwei weitere Bildbände widmen sich dem Zeichner und Kunstkenner. Erstaunlich preiswert: „Goethe und die Kunst“ (Hatje, 644 S., 49,80 DM). Hier werden auch Themen wie „Wolkenstudien der Goethezeit“ aufgegriffen. Und man lernt, dass Goethe wichtige Künstler seiner Zeit wie Turner oder Goya praktisch ignoriert hat. Er war eben auch nur ein Mensch. Freilich einer, der fleißig zeichnete und von dem 2700 Blätter erhalten sind. Etliche stellt das Buch „Goethe. Der Zeichner und Maler“ (Callwey, 208 S., 99,90 DM) vor. Stets spürbar: die Freude am prallen Blühen der Natur.
„Goethes äußere Erscheinung“ (Insel-Taschenbuch. 200 S., 27,80 DM) besteht aus vielen Goethe-Porträts und Eindrücken der Zeitgenossen. So schrieb der Mime Wilhelm Iffland: Goethe hat einen Adlerblick, der nicht zu ertragen ist.“ Und Freund Friedrich Schiller bemerkte: „Er ist von mittlerer Größe, trägt sich steif und geht auch so; sein Gesicht ist verschlossen, aber sein Auge sehr ausdrucksvoll.. .“
Viele wollen Goethe ans Leder. So wurde ausgerechnet der so oft in weibliche Wesen Vernarrte als schwul „geoutet“, als Rabenvater oder politischer Reaktionär gebrandmarkt. Hier setzt auch dieses Buch an: W. Daniel Wilson „Das Goethe-Tabu“ (dtv, 414 S., 24,90 DM),
Wilson möchte partout beweisen, dass Goethe als Geheimrat in Weimar ein perfides Spitzelsystem aufgebaut habe, welches sich nicht nur gegen Studenten, sondern auch gegen Autorenkollegen wie Herder und Fichte gerichtet habe. Zudem habe er gnadenlos junge Burschen als Soldaten außer Landes verkauft. Just das Gegenteil liest Ekkehart Krippendorf aus den Quellen heraus: In „Goethe. Politik gegen den Zeitgeist“ (Insel. 232 S., 44 DM) würdigt er den Dichter als Förderer der Toleranz und der Abrüstungspolitik.
Federn lässt der Mythos des Dichters wiederum im Roman von Hugo Schultz: „Goethes Mord. Der Seelenmord an J. M. R. Lenz“ (Edition Isele, Eggingen. 441 S, 44 DM). Hier wird ein Verhalten beleuchtet, das Goethe nicht gerade sympathisch macht. Kaum einen seiner Zeitgenossen ließ er neben sich gelten. Besagten Dichter Lenz hat er ebenso kühl abblitzen lassen wie Heinrich Heine, Heinrich von Kleist oder Jean Paul – wahrlich keine zweitklassigen Schreiberlinge.
Ein wenig ins andere Extrem verfällt Gertrud Fussenegger in „Goethe – Sein Leben für Kinder erzählt (Lentz-Verlag/Herbig, München. 224 S., 24.90 DM). Hier ist sozusagen jede Zeile von Dankbarkeit erfüllt. Aber der Text klingt durchaus kindgerecht und gaukelt kein Wissen vor, das wir Heutigen nicht haben können. Der historische Abstand wird nicht verkleistert, sondern mit Würde gewahrt.
„Hat er, oder hat er nicht – und wann mit welcher?“
Wer sich ausgiebig mit Dichters Erdenwallen befassen will, greift vielleicht zu den Wälzern von Nicholas Boyle: „Goethe“ (Verlag C. H. Beck. Band 1: 1749-1790. 884 S., 78 DM / Band 2: 1790-1803, 1115 S., 88 DM). Der Brite geht wirklich in die Einzelheiten. Einen dritten Band ähnlichen Kalibers will er noch nachreichen. Bemerkenswert übrigens, dass Sigrid Damm: „Christiane und Goethe“ (Insel, 49,80 DM), eine intensive biographische Erkundung über Goethe und seine Frau Christiane Vulpius, seit Wochen die Sachbuch-Bestsellerliste anführt.
Falls man es lieber knapp und alphabetisch sortiert mag, erwirbt man das „Taschenlexikon Goethe“ (Piper, 316 S., 16,90 DM). Der Text gibt sich flockig. Unter dem Stichwort „Frauen“ erhebt sich die Frage: „Hat er, oder hat er nicht – und wann mit welcher?“ Hehe!
Nähern wir uns den Texten des Meisters selbst: „Verweile doch“ (Insel, 512 S.. 39.80 DM) heißt eine Auswahl von 111 Goethe-Gedichten mit Interpretationen. Ausgerechnet Marcel Reich-Ranicki knöpft sich Goethes berühmte Kritikerschelte vor… „Schlagt ihn tot, den Hund! Es ist ein Rezensent“. Reich-Ranickis bezeichnender Befund: Das sei Volksverhetzung…
Dass auch Genies nicht immer auf einsamer Höhe stehen, lässt die schmale Kollektion „Goethes schlechteste Gedichte“ (Residenz-Verlag, 95 S., 19.80 DM) ahnen. Die Herausgeber haben hier vor allem auf‘ Gelegenheitslyrik (zu Geburtstagen, Jubiläen usw.) zurückgegriffen, die Goethe nebenbei aus dem Handgelenk schüttelte. Kostprobe: „Die Welt ist ein Sardellen-Salat / Er schmeckt uns früh, er schmeckt uns spat“. Nun ja. Gemein ist’s, solche lässlichen Sünden zu sammeln.
Ungleich ernsthafter gehen die Herausgeber der auf 40 Bände angelegten Gesamtausgabe vor. Soeben erschienen: „Goethes ästhetische Schriften 1816-20. Über Kunst und Altertum 1-11″ (Deutscher Klassiker Verlag. 1622 S., 198 DM). Titel und Preis lassen ahnen, dass wir es hier mit einem Monument penibler Germanistik zu tun haben. Die Erläuterungen beginnen bereits auf Seite 617, umfassen also rund 1000 Seiten und erdrücken Goethes Worte nahezu.
Auf Reisen war meistens ein Diener dabei
Eigentlich unglaublich: Für 99,90 DM kann man 22 Bände Goethe („Berliner Ausgabe“) nebst wichtigen Briefen, den Gesprächen mit seinem Vertrauten Eckermann und 120 Artikel aus dem Goethe-Handbuch erwerben. Allerdings nicht zum gemütlichen Schmökern, denn es handelt sich um einen Daten-Silberling für den Computer. Mit Suchfunktionen kann man z. B. herausfinden, an welchen Stellen Goethe etwa Worte wie „Liebe“ oder „Italien“ verwendet hat. Um den elektronischen Kraftakt „Goethe – Zeit, Leben, Werk“ (CD-Rom, 99,90 DM) mit Textmassen, Bildern und Tönen zu bestehen, haben sich die Verlage Metzler, Aufbau und Schroedel mit dem Südwestrundfunk (SWR) und der Stiftung Weimarer Klassik vereint.
Goethe unterwegs, Goethe als Feinschmecker – auf dem Buchmarkt gibt’s alles: „Goethe auf Reisen“ (Weltbild, 144 S., 39,90 DM) verknüpft den historischen Rückblick mit Reisetipps für heute. Goethes Touren waren weit beschwerlicher als unsere, er hatte aber meist einen Diener dabei.
Goethe war also ein Genießer, der sich manche Mühsal abnehmen lassen konnte. „Zu Gast bei Goethe“ (Wilh. Heyne Verlag, 215 S., 68DM) fuhrt uns an den Tisch des Lukullikers, der „Welsches Huhn mit Trüffeln“ oder „Leipziger Allerlei mit Krebsen“ verzehrte. 40 Rezepte aus der Weimarer Hofküche kann man nachbrutzeln.
Der Dichter hasste Hunde und Raucher
Zum Schluss zwei besonders originelle Bücher. „Goethes merkwürdige Wörter“ (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 216 S., 58 DM) macht anhand von über 1000 Begriffen bewusst, wie weit wir uns sprachlich von Goethes Epoche entfernt haben. Der Blumenliebhaber hieß bei ihm noch „Blumist“, für Pedanterie schrieb er „Kahlmäuserei“. Sagte er „Geilheit“, meinte er Übermut und „Dreistigkeit“ bedeutete ihm Zuversicht. Ein gar schönes Museum der deutschen Sprache.
Angriffslustig gehen Oliver Maria Schmidt und J. W. Jonas in „Gute Güte, Göthe!“(Haffmans-Verlag, 220 S., 24 DM) zu Werke. Unter der Überschrift „bebende Bärte“ werden Goethe-Deuter der verflossenen Jahrhunderte dem Gelächter preisgegeben: lauter salbungsvolle Rechthaber und Erbsenzähler der komischsten Sorte. Welch eine herrliche Realsatire zur Wirkungsgeschichte Goethes!
Schmunzelnd lernen wir hier auch Goethes Abneigungen kennen: Der leidenschaftliche Weintrinker hasste Hunde, Raucher, Brillen, Lärm, Sauerkraut und das „Zerknaupeln“ (Kneten) von Kerzenwachs. Außerdem gab er geliehene Bücher nie zurück. Dem Haffmans-Band entnehmen wir das passende Schlusswort, ein Zitat von Walter Benjamin aus dem Jahr 1932 (100. Todestag Goethes): „Jedes in diesem Jahr über Goethe eingesparte Wort ist ein Segen“. Schon gut. Wir schweigen.
_______________________________
Der Text stand am 28. August 1999 in der Wochenendbeilage der Westfälischen Rundschau.