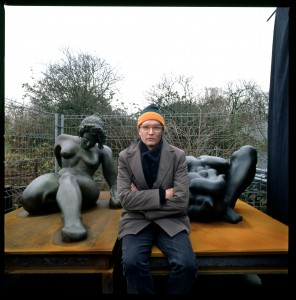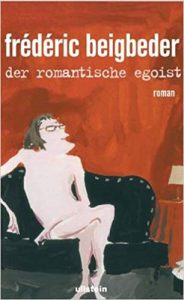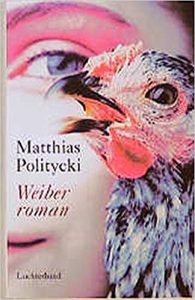Ob Gebühren oder Gedichte – Wenn alles zur Zumutung wird
Im Aufmacher der feiertäglichen WAZ-Titelseite geht es um Studiengebühren. Demnach möchten NRW-Hochschulen die Langzeitstudenten (so ca. ab dem 20. Semester und darüber hinaus) ein wenig zur Kasse bitten. Bis jetzt sind es nur Gedankenspiele.

Hier hatte der Protest noch einen gewissen Pfiff: Bekleidung zur Demo gegen Studiengebühren beim bundesweiten „Bildungsstreik“ – hier am 17. Juni 2009 in Göttingen. (Foto: Niels Flöter / miRo-Fotografie) – Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Schließlich, so die hauptsächliche Begründung, profitierten diese zögerlichen Studenten ja auch viele Jahre lang von günstigem Mensa-Essen, dito von preiswerten Nahverkehrstickets und speziellen Tarifen bei der Krankenversicherung. Womit noch nicht alle Vorteile genannt sind.
Falls nicht besondere Umstände vorliegen (Krankheit, sonstige Notlage), die eben geprüft werden müssten, finde ich die Gebührenpläne durchaus nachvollziehbar, sofern sie sich im moderaten Rahmen bewegen. Etwa 74000 Langzeitstudenten, rund zehn Prozent aller Studierenden, blockieren dem Bericht zufolge in NRW Studienplätze an den ohnehin schon überfüllten Hochschulen.
„In jedem Fall diskriminierend“
Okay, bevor jemand fragt, gestehe ich freimütig: Auch ich bin nicht in 8 Semestern fertig geworden, sondern habe zwölf gebraucht. Ein wenig Orientierungsphase und so genanntes „Studentenleben“ sollten schon möglich sein. Eng getaktete Verschulung gibt’s inzwischen mehr als genug, uns ging’s in der Hinsicht noch besser. Jedoch: Sind 20 Semester und mehr noch statthaft? Langwierig auch auf Kosten von Steuer zahlenden Kindergärtnerinnen und Krankenschwestern zu leben, ist alles andere als „cool“.
Worauf ich aber hinaus will, ist der unsägliche Ausspruch eines Studentenvertreters, der da laut WAZ folgenden Satz von sich gegeben hat:
„Gebühren sind in jedem Fall diskriminierend.“
Also ehrlich, bei diesem Schwachsinn schwillt mir einfach der Kamm.
Dümmlicher Zynismus
Weiß der Bursche, der übrigens Michael Schema heißt (keine Scherze mit Namen!), überhaupt, was er da faselt? Kennt er eigentlich die wirkliche Bedeutung des Wortes Diskriminierung? Fühlt er sich auch diskriminiert, wenn Miete und Stromrechnung fällig werden oder wenn er in der S-Bahn seinen Fahrschein vorzeigen soll? Ist ihm bewusst, dass sein Ausspruch nicht nur dümmlich, sondern nachgerade zynisch ist, wenn man an wirklich diskriminierte Menschen denkt?
Aber wir erleben ja schon seit geraumer Zeit, worauf es hinausläuft mit dem diffusen Gefühl, „diskriminiert“ und benachteiligt zu werden. Im Gefolge der political correctness an US-Universitäten, wo einem (weitaus seltener: einer) Lehrenden mitunter jede scherzhafte Äußerung als „Mikro-Aggression“ ausgelegt werden und blitzschnell zum Karriereende führen kann, breitet sich auch hier eine erschreckende Überempfindlichkeit aus, die allüberall Zumutungen und Verletzungen wittert.
Bewunderung als Belästigung?
Ein neueres Beispiel rankt sich um einen unschuldsvoll-harmlosen Text des Lyrikers Eugen Gomringer (92) aus dem Jahr 1951. Seit vielen Monaten wogt eine heftige Debatte um folgende Zeilen, die den Titel „Avenidas“ tragen:

Schmucklos genug: Fassade der Berliner Alice Salomon Hochschule für Sozialarbeit, Gesundheit und Erziehung im Februar 2011. (Foto: Auto 1234 – Self photographed) Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.en
„Alleen / Alleen und Blumen / Blumen / Blumen und Frauen / Alleen / Alleen und Frauen / Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer“
Ganz, ganz schlimm, nicht wahr? Das findet jedenfalls der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Berliner Alice Salomon Hochschule, an deren Fassade der Text seit 2011 steht. In Gomringers Gedicht werde die „patriarchalische Kunsttradition“ reproduziert, in der Frauen nur die Musen seien, die den männlichen Künstler inspirieren.
Und weiter im Asta-Sprech, nun vollends losgelöst vom dichterischen Sinn: „Es (das Gedicht, d. Red.) erinnert zudem unangenehm an sexuelle Belästigung, der Frauen alltäglich ausgesetzt sind.“ Selbstredend wird die Entfernung des Gedichts gefordert. War da nicht mal was?
Sie wähnen sich für alle Zeit im Recht
Nach diesem „Verständnis“ dürfte man Frauen also nicht einmal mehr bewundern. Dass die Studierenden weder einen blassen Schimmer vom Zeitkontext des Gedichts noch von Lyrik überhaupt haben, darf man mit Fug vermuten. Diskutieren wollen sie über ihre bodenlos ahnungsfreie Gedicht-„Interpretation“ selbstverständlich auch nicht. Sie wähnen sich fraglos ein für allemal im Recht.
Gomringer, ein Doyen der Konkreten Poesie, sprach jetzt im Deutschlandfunk von „Säuberung“. Auch diese Wortwahl mutet einstweilen noch übertrieben an. Aber der Zorn des großen alten Mannes ist nur zu berechtigt.