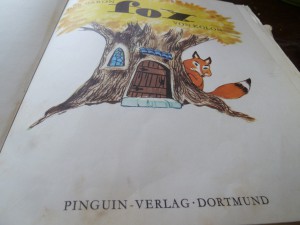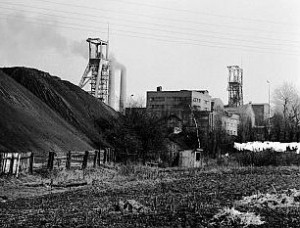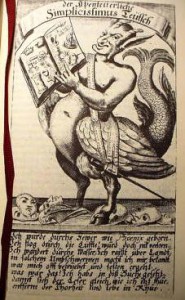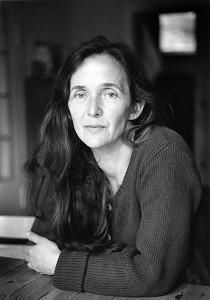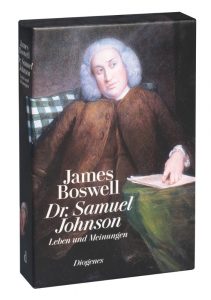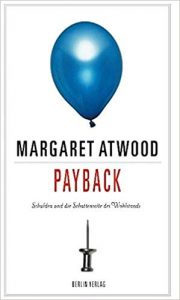Raffaels Madonnen in Dresden vereint
Der deutsche Papst hat es möglich gemacht. Fast fünfhundert Jahre lang haben sich die von Raffael fast zeitgleich gemalten Altarbilder nicht mehr getroffen, jetzt kann man sie nebeneinander betrachten.
Zuletzt standen die „Madonna von Foligno“ und die „Sixtinische Madonna“ im Jahre 1512 zusammen im Atelier des italienischen Renaissance-Malers. Dann trennten sich die Wege der Bilder, die auf eindringliche Weise die himmlische Erscheinung der Maria mit dem Jesuskind thematisieren.
Auf verschlungenen Pfaden und verschiedenen Zwischenstationen kam die „Sixtinische Madonna“ 1754 nach Dresden, um die ohnehin prächtige Sammlung von August III., dem sächsischen Kurfürst und König von Polen, mit einem ebenso unzweifelhaften wie bedeutenden Raffael-Gemälde nochmals aufzuwerten und zu schmücken.
Die „Madonna von Foligno“ wurde, nachdem napoleonische Truppen sie beschlagnahmt und restaurierten hatten, im Jahr 1816 nach Italien zurückgebracht, um in der Vatikanischen Pinakothek ein gut behütetes und viel umschwärmtes Dasein als Ikone der Kirchenkunst zu führen. Zwei Jahrhunderte lang wurde das Bild nicht ausgeliehen, nie ging es auf Reisen. Dass aus Anlass des Deutschland-Besuches von Papst Benedict XVI., die „Madonna von Foligno“ den Vatikan verlassen und in der Gemäldegalerie der Alten Meister in Dresden ihr Schwesterbild treffen darf, ist eine Geste eines Kirchenführers an seine deutsche Heimat – und es ist eine Kunst-Sensation.
Die beiden kostbaren Raffael-Bilder sind nicht allein in Dresden. Zu ihnen gesellen sich knapp 20 weitere Werke, Gemälde, Zeichnungen, Kupferstiche, Bücher und Dokumente. Skizzen Raffaels zu seinen „Madonnen“, korrespondierende Werke von italienischen Malern wie Corregio und Garofalo sind zu sehen, aber auch Arbeiten deutscher Künstler, Albrecht Dürer und Lucas Cranach d. Ä., die „Stuppacher Madonna“ von Matthias Grünewald.

Raffael: Sixtinische Madonna, 1512 (Copyright: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gemäldegalerie Alter Meister - Foto: Estel/Klut)
„Himmlischer Glanz“, so der Titel der Ausstellung, ist wahrlich keine opulente und ausufernde, aber dennoch bedeutende Kunstschau. In klaren Konturen und beispielhafter Deutlichkeit zeigt sie nicht nur klassische Beispiele der Madonnen-Darstellung aus der Zeit Raffaels. Sie belegt auch, wie Werke wichtiger Künstler – auch über die Alpen hinweg – miteinander kommunizierten, wie sie sich in Bildsprache und Themengestaltung, Malweise und Farbgebung aufeinander bezogen. Das ist spannend und lehrreich, kann aber den Blick des faszinierten Betrachters nicht vom magischen Zentrum der Bilderschau lenken: den beiden großformatigen, von zeitloser Schönheit, ästhetischer Erhabenheit und göttlicher Gnade kündenden Madonnen-Bildern.
Hier die „Sixtinische Madonna“, die wahrscheinlich von Papst Julius II. in Auftrag gegeben wurde und für die Klosterkirche San Sisto in Piacenza bestimmt war, quasi als Geschenk dafür, dass die oberitalienische Stadt dem Kirchenstaat beigetreten war: In der Mitte schreitet Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm in Richtung der irdischen Welt. Der kniende Papst Sixtus II. und die Heilige Barbara weisen ihr den Weg. Unten lümmeln sich zwei schelmische und sympathische Engelchen, die, aus dem Bild tausendfach herauskopiert, längst zu Pop-Ikonen der Alltagskultur geworden sind.
Und nur eine Armlänge in Dresden entfernt nun die „Madonna von Foligno“: Die Muttergottes, auf Wolken sitzend vor einer Sonnenscheibe, mit dem Kind auf dem Arm. Links Johannes der Täufer und Franziskus, rechts der Heilige Hieronymus und Auftraggeber Sigismondo dei Conti. Und alles strahlt, nach mehreren Restaurierungen, in Rot, Blau und Gold. Gegen die satten und knalligen Farben nimmt sich die matt und grünstichig erscheinende, seit vielen Jahren nicht mehr aufgefrischte „Sixtinische Madonna“ geradezu kleinlaut aus. Gleichwohl verheißt auch dieses Bild ein großes Versprechen, und jeder Betrachter spürt, hier zwei der bedeutendsten Meisterwerke der Renaissance ansichtig zu werden und Zeuge eines einmaligen historischen Moments zu sein: Denn wohl nie wieder werden die beiden Schwestern sich begegnen.
Infos:
+ „Himmlischer Glanz. Raffael, Dürer und Grünewald malen die Madonna“. Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gemäldegalerie Alter Meister, bis zum 8. Januar 2012
+ Öffnungszeiten: tägl. 10 – 18 Uhr, Mo geschlossen
+ Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 7,50 Euro.
+ Informationen und Anmeldungen von Führungen unter 0351/49142000 oder besucherservice@skd.museum
+ Katalog, herausgegeben von Henning und Arnold Nesselrath, Prestel Verlag, München, 128 S., 80 Farbabbildungen, 24,95 Euro.
+ Mehr über Raffael und die Renaissance: Giorgio Vasari: „Das Leben des Raffael“, neu übersetzt und kommentiert, Wagenbach Verlag, Berlin 2004, 204 S., 12,90 Euro.