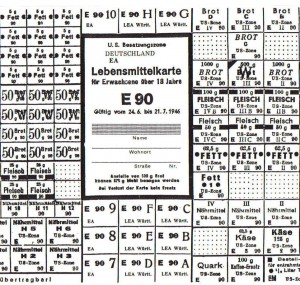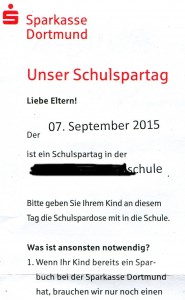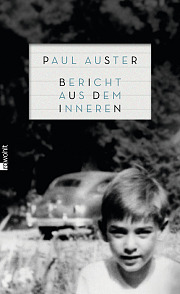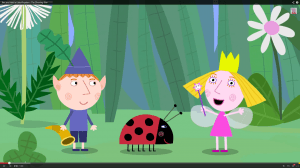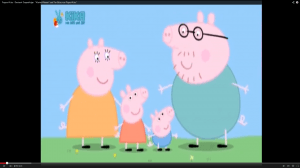Was die Alten Römer konnten – eine Mitmachausstellung für Kinder in Hamm
Ach, wie gediegen geht es doch gemeinhin bei Ausstellungsterminen für die Presse zu: eine überschaubare Anzahl von Menschen, daher recht freier Blick auf die Exponate. Dazu in der Regel kein ungebührlicher Lärm, sondern zumeist gepflegte Konversation.
Hätte ich die Hammer Ausstellung „Hightech Römer“ zur Pressekonferenz gesehen, dann hätte ich also einen völlig falschen Eindruck bekommen. So aber empfängt uns als zahlende Besucher (drei Erwachsene, zwei Kinder) im Gustav-Lübcke-Museum ein ordentlicher Krach, zu dem unsere Sechs- und Siebenjährigen sogleich selbst kräftig beisteuern werden. Und das ist in gewissen Grenzen auch erwünscht. Es geht ja ums lustvolle Entdecken.
Eingangs läuft ein Einführungsfilm, der das Interesse an Erfindungen der Alten Römer wecken soll, indem er jene längst vergangene Welt zwischen Kolosseum und Pantheon dreidimensional „auferstehen“ lässt. Doch der Kino-Bereich ist leider nicht schallisoliert, deshalb versteht man die Tonspur kaum. Denn in den Räumen dahinter dürfen und sollen Kinder an insgesamt 35 Stationen alles selbst ausprobieren – inklusive Schussapparaturen wie Katapult und Balliste. Auch wenn da nur Plastikbällchen fliegen, klackert der Mechanismus doch ganz erheblich. Ich appelliere an die akustische Vorstellungskraft der Leserinnen und Leser und rate zum Besuch an ganz normalen Werktagen.
Wie hält der Triumphbogen?
Für Leute ab etwa 5 Jahren (happiger Eintrittspreis für die Kleinen: auch schon 7 Euro) ist die anregende Ausstellung mit einigen Themenschwerpunkten (Architektur, Militär, Handwerk, Rechnen, Straßen, Reisen, Luxus, Maschinen, Kommunikation) gedacht. Tatsächlich vermittelt sie allererste Eindrücke von manchen technischen Leistungen der Römer – vom Flaschenzug bis zur Fußbodenheizung und zum ausgeklügelten System der Wasserleitungen (Stichwort Aquädukt). Letztere kann man im einfachen Modell ebenso nachbauen wie eine Brücke oder einen Triumphbogen. Wie kriegt man bloß den obersten Stein so hingesetzt, dass der ganze Bogen hält?
Nur noch ein paar weitere Beispiele: Kinder dürfen sich hier als Dachdecker nach Art der Antike betätigen, sie können ein Bodenmosaik legen, frühe Entfernungsmesser erproben, mit Holz bauen, altrömische Statuen per Bildschirm bunt anmalen und einander zwischen zwei Türmen mit Flaggen Signale senden. Zwischendurch sieht man wenige originale Fundstücke in Vitrinen. Sie werden hier eher zur Nebensache. Weitaus empfänglicher sind Kinder für anschauliche Details aus der römischen Sklavenhaltergesellschaft.
Selbst auf der Galeere rudern
Besonders belagert sind der Schießstand, an dem man mit althergebrachter Technik auf Scheiben zielen kann, und die „Galeere“. Vom Bildschirm her gibt ein fieser Trommler die rhythmischen Kommandos, die natürlich allesamt auf „Schneller, schneller“ hinauslaufen. Gerudert wird freilich nicht virtuell, sondern schweißtreibend analog. Am Ende kann das jeweilige Vierer-Trüppchen vom Bildschirm ablesen, welche Strecke es geschafft hat. Der Rekord (Highscore) lag an unserem Besuchstag schon bei unfassbaren 61,5 Seemeilen. Was wir geschafft haben? Och, das tut nichts zur Sache.
Die Wanderschau ist eine Koproduktion des LVR-Landesmuseums Bonn mit Museen in Den Haag und Nijmegen (Holland) sowie Mechelen (Belgien). Den Einführungsfilm und die Beschriftungen gibt’s denn auch auf Deutsch, Niederländisch, Englisch und Französisch. Doch damit nicht genug. Themengerecht kann man die Ausstellungstexte via Homepage auch auf Lateinisch herunterladen.
Was von all dem emotional und gedanklich andauern wird, lässt sich scherlich vorhersagen. Vielleicht erinnern sich die Kinder später an einzelne Anstöße, wenn sie etwas übers Altertum lesen oder hören. Vielleicht wird der gar eine oder andere Besucher (Besucherin) später einmal hochgelahrter Antike-Spezialist. Und wenn dann jemand fragt, wie alles begonnen hat, dann heißt es womöglich: „Damals in Hamm…“
„Hightech Römer“. Mitmachausstellung im Gustav-Lübcke-Museum, Hamm, Neue Bahnhofstraße 9. Bis 30. Oktober 2016, geöffnet Di-Sa 10-17, So 10-18 Uhr, montags geschlossen..
Am Sonntag, 22. Mai (Internationaler Museumstag), ist das ganze Haus kostenlos zugänglich. Sonst: Erwachsene 9 Euro, Kinder ab 5 Jahren 7 Euro, Familienkarte (bis 2 Erwachsene und 3 Kinder) 22 Euro.