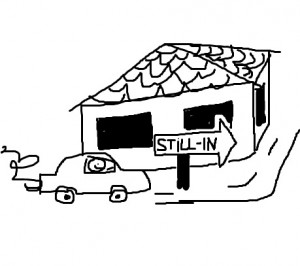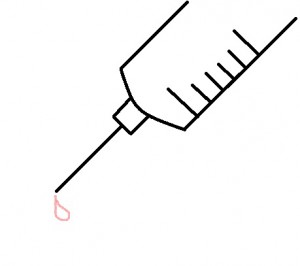Der Kinder- und Drehbuchautor Justus Pfaue wurde 70 – ein arg verspäteter Glückwunsch
Ich bin ja hier so einer, der sich gern mal bei Todestagen wirklich wichtiger Menschen in dieser Republik zu Wort meldet, der aber noch viel lieber aufzeigt, wenn solche Menschen Jahrestage haben, Geburtstage zum Beispiel. Da ist mir im vergangenen Jahr doch einer durchgegangen. 2012 wurde Justus Pfaue 70 Jahre alt.
Wie? Etwa vergessen? Das ist der kluge Mensch, aus dessen Feder so vieles stammt: „Timm Thaler“, „Patrik Pacard – Entscheidung im Fjord“, „Oliver Maass – Das Spiel mit der Zaubergeige“, „Bas-Boris Bode – Der Junge, den es zweimal gibt“, „Teufels Großmutter oder der Himmel auf Erden“, „Anna“ und noch vieles andere. Justus Pfaue hat viele Kinderbücher, sehr viele Drehbücher und aus diesem Fachbereich seiner rastlosen Arbeit das eine oder andere auch für sehr, sehr bekannte Filme geschrieben, er ist einer der bedeutendsten seiner Zunft in Europa, lebt wahlweise in München und Positano (Campagna, Italien), ein Ort, von dem John Steinbeck mal schrieb, dass er der einzig senkrechte auf der Welt sei. Und – Justus Pfaue kommt aus Unna.
Vor Jahrzehnten hatte ich mal das Glück und das Vergnügen, mit dem Mann, in dessen Geschichten bis heute gern die besten deutschen Schauspieler auftreten, zu telefonieren, obwohl der eine grundständige Abneigung gegen alles hegt, was mit Journalismus zu tun hat. Beinahe eine halbe Stunde dauerte das Gespräch, was gemessen daran, dass er ansonsten eher zweisilbig bis einsilbig daher kommt, geradezu inflationär anmutet. Ich gestehe, ich habe jede Sekunde genossen, weil ich um seine verschlossen-freundliche Art wusste.
Daher bewahre ich an dieser Stelle auch mein Herrschaftswissen über Justus Pfaues Geburtsnamen, den anscheinend nicht einmal das allwissende Wikipedia kennt. Nur ein paar Handverlesene in Unna wissen von ihm … und das ist auch gut so.
Er ist Jurist, forensischer Psychologe und gestochen scharf Beobachtender des menschlichen Alltags, woraus er sich bereits in Studienzeiten Material für seine späteren Produkte holte und für die „ZEIT“ und den Hörfunk Berichte oder glossierende Geschichten schrieb.
Brigitte Horney, Peter Pasetti, Gerd Baltus, Loni von Friedl, Eberhard Feik, Elfriede Kuzmany, in neuerer Zeit Jürgen Vogel – alles Namen, die in den Rängen der Großen deutscher Schauspielerei zu siedeln sind. Sie alle rissen sich darum, in einer Serie oder einem Fernsehfilm mitzuspielen, dessen Grundidee von Justus Pfaue entwickelt worden war.
Bevor er so begehrt und offensichtlich auch von Fachleuten zu Recht bewundert wurde, zog es ihn durch viele Bereiche Unnas und immer mal wieder mit seinen Freunden ins Café Jokisch (ungefähr da, wo heute ein überflüssiger Balkon die Unnaer Marktatmosphäre stört). Da half die „Kleine Jokisch“ gern mal dem Vater und bediente die Kundschaft. Der junge Justus und seine Freunde hatten es besonders gern, wenn gerade sie ihnen den Kaffee servierte, weil die „Kleine Jokisch“ ein sehr apartes Wesen war (und sie ist das auch heute noch).
Dann aber zog es ihn in Richtung des deutschen Südens und er wählte München zu seiner Hauptresidenz. Zu den Unnaer Freunden hat er nur vereinzelte Kontakt, und da er auf seine Privatsphäre damals wie heute empfindlich achtete, behalte ich auch in dieser Hinsicht mein Wissen für mich.
Nun kann ich ja auch nur noch nachträglich zum 80. gratulieren, worauf der Landsmann vom Hellweg, der richtig gebürtig eigentlich aus Ballenstedt (Sachsen-Anhalt) stammt, wohl aber keine nennenswerten Reaktionen zeigen wird. Ich tu’s trotzdem.