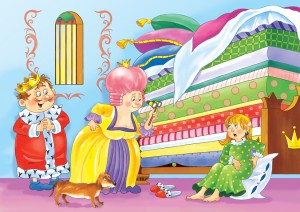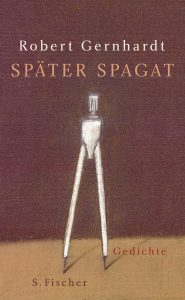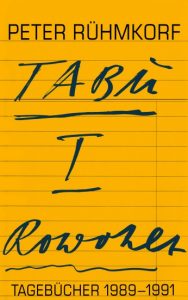Wir Angsthasen und Zimperliesen: Die neue Empfindlichkeit
Sicher liegt es an dieser ordinären Currywurst in scharfer Soße, die ich gestern hemmungslos aus einer Pappschale gepickt und, jawohl, genossen habe. Ethisch nicht zu vertretende Schlachtprodukte, weiß der inzwischen omnipräsente Veganer, blockieren das Gutsein und fördern fiese Überlegungen.
Freunde, das mag sein. Jemand wie ich, der Fleisch, Fisch und tierische Segnungen wie Milch, Eier, Honig ohne Zögern zu sich nimmt, der frisst auch eure Bedenken. Mit Mayo. Es tut mir leid. Aber wann sind wir eigentlich alle so extrem empfindlich geworden? Je besser es uns geht, desto weniger können wir vertragen. Das gilt nicht nur fürs Essen, sondern auch für stickige Luft, Lärm und alles, was gegen unsere zimperlichen Gewohnheiten geht.
„Stell dich nicht so an!“ Dieser barsche Satz gehörte in der Aufbauzeit des 20. Jahrhunderts zur Kindererziehung. Das war kein Spaß, kann ich jüngeren Lesern versichern. Wir mussten den Teller mit dem muffigen Kochfisch leeressen, bei Tisch die Klappe halten, im Stockdunklen einschlafen („Die Tür bleibt zu!“), sonntags ohne Widerspruch wandern und gruseligen alten Tanten ein Küsschen geben.
Verfeinerte Lebensart
All das wollten wir unseren eigenen Kindern nicht antun. Meine Tochter durfte sich Pommes bestellen, mit Erwachsenen plappern, nachts ihre Gänselampe anlassen und stets mit unserer Aufmerksamkeit rechnen. Auch wurde sie nie eiskalt abgeduscht, obwohl das sicher gesund ist. Keiner von uns wollte die Härte der von traumatisierenden Erlebnissen geprägten Kriegsgeneration an die Gesellschaft der Zukunft weitergeben.
Wir waren sensibel, wir wollten es sein. Für eine bessere Gesellschaft. Leider haben wir Gewalt und üble Absichten nicht aus der Welt schaffen können. Verrückte Diktatoren und hasserfüllte Fanatiker tummeln sich auch in der Gegenwart. Und was tun wir? Wir feilen wir an der eigenen Lebensart und haben sie so stark verfeinert, dass wir uns gegenseitig damit erheblich auf die Nerven gehen. Wir sind die Memmen des Alltags. Jeder Hauch von Zigarettenrauch widert uns an. Raus mit euch, ihr Qualmer!
Essen als Herausforderung
Ein gemeinsames Essen wird zu einer Herausforderung. Man muss so viel bedenken. „Kannst du eigentlich Brokkoli vertragen“, fragt mich meine Freundin Uschi, eine kreative Köchin. Nein, Süße, kann ich nicht. Auch andere gesunde Sachen wie Zwiebeln, Nüsse, Kohl und Linsen, sogar Salat sind schlecht für meine Art der Darmbeschaffenheit, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich hätte gern Maispoularde mit Kartoffelpüree. Und Suppe ohne Schnittlauch. Und bloß kein Körnerbrot. Lieber Baguette. Und zum Nachtisch keine Beeren. Aber gerne eine Schokoladen-Mousse.
Gut, dass meine Freundin nicht zugleich eine jener Frauen eingeladen hat, die abends keine Kohlenhydrate wollen und Zucker für pures Gift halten. Den größten Küchenstress hat Uschi, selbst eine erklärte Freundin von Gulasch und Leberkäs, in ihrem vegetarisch-kalorienarm orientierten Damenkränzchen, zu dem ich zum Glück nicht auch noch gehöre. Allerdings ist eine Allergikerin dabei, die weder Eier und Milchprodukte noch Schalentiere und Zitrusfrüchte vertragen kann – von Nüssen ganz zu schweigen.
Um es klar zu sagen: Einige Unverträglichkeiten können lebensgefährlich sein. Wer davon betroffen ist, hat keine Wahl, als auf die bedrohliche Eigenart seines Immunsystems Rücksicht zu nehmen. Aber niemand weiß genau, wie viele Menschen tatsächlich unter ernsthaften Allergien leiden. Nach Auskunft der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft zeigen etwa 27 Prozent aller deutschen Männer und 39 Prozent der Frauen in unserer (zu) gründlich geputzten Zivilisation allergische Reaktionen. Die meisten davon reagieren verschnupft auf Pollenflug, einige bekommen Bauchweh von Mehl oder Milch. Andere klagen über die Tücke der Hausstaubmilbe und lassen den Teppichboden entfernen. Nur ein glatter Boden ist ein guter Boden. Der lässt sich leicht wischen. Aber nicht mit scharfen Substanzen, davon brennen uns die Augen. Am besten nur mit Wasser.
Selbst Wasser wird zum Problem
Apropos Wasser. Selbst das harmlose Element ist ein heikles Thema für uns Empfindsame. Während in Dürre-Regionen jedes Schlammloch genutzt wird, müssen wir, was da klar aus der Leitung fließt, erst mit Magneten und Heilsteinen „lebendig“ machen, um es trinken zu können. Manche glauben, jeder Schluck Sprudel könnte ihren Bauch aufblähen und die Gesundheit ruinieren. „Mit oder ohne Kohlensäure“ ist in Lokalen inzwischen eine gängige Frage, genau wie „mit oder ohne Koffein“. Ein Luxusproblem, wie mir scheint.
So, wie wir nicht mehr einfach zu uns nehmen, was auf den Tisch kommt, kontrollieren wir stets die gewöhnlichen Bedingungen unserer Umgebung. Allem wird misstrauisch nachgefühlt. Ist es hier drin zu kalt oder zu warm? Zieht es von der Tür her? Reden die Leute zu laut? Muss ich mich umsetzen? Aber nicht an den Tisch zwischen Fenster und Spiegel! Da geht nach Feng Shui die Energie verloren.
Kein Filter für die Umweltreize
Hilfe, wir sind so empfindlich, es ist nicht auszuhalten mit uns! Tatsächlich erforscht die amerikanische Psychologin Elaine Aron (72) schon seit den 1990er-Jahren ein anschwellendes Phänomen, das sie „high sensitivity“ nennt, Hochsensibilität (HS). Bis zu 20 Prozent der Bevölkerung, sind nach Ansicht der Bestseller-Autorin („Sind Sie hochsensibel?“) von dieser Besonderheit betroffen. Das heißt, sie nehmen die Reize ihrer Umwelt intensiver wahr als der Rest der Menschheit. Geräusche, Gerüche, Farben, zufällige Berührungen können für hochsensible Naturen schier unerträglich sein. Ihnen fehlt gewissermaßen der innere Filter, mit dem robustere Naturen ihre Wahrnehmungen dämmen.
Wenn es eng wird bei der Vernissage, flieht der hochsensible Typ nach Hause. Wenn das Ferienhotel neben der Durchgangsstraße liegt, muss er sofort abreisen. Er kann das weniger Angenehme einfach nicht ausblenden – und will es auch nicht. Wie der Antiheld aus Wilhelm Genazinos Roman „Mittelmäßiges Heimweh“. Zitat: „Ich muss überlaute Menschen rechtzeitig erkennen und ihnen schnell aus dem Weg gehen. Seit Wochen schon will ich private Lärmerwartungsstudien anstellen, damit ich im Straßenverkehr nicht mehr so oft erschreckt werden kann.“ Angst und das Bedürfnis nach Kontrolle gehören auch im wirklichen Leben zusammen.
Wie die Prinzessin auf der Erbse
„So ein Quatsch“, hätte meine Mutter dazu gesagt. Wie viele Zeitgenossen hatte sie früh gelernt, die eigenen Befindlichkeiten zu ignorieren, um Nazi-Terror, Kriegsnächte, mörderische Fluchten und Hunger zu überleben. Bis zuletzt mangelte es ihr an Zartheit. Wir behüteten Nachgeborenen hingegen scheinen geradezu stolz auf unsere Empfindlichkeit zu sein. Ja, vielleicht wollen wir sogar gern die Hochsensiblen sein. Und fein wie die „Prinzessin auf der Erbse“ aus Hans-Christian Andersens kleinem Märchen. Sie erinnern sich?
Es war einmal ein Prinz, der wollte partout eine Prinzessin heiraten. Doch er traf auf seinen Reisen nur Betrügerinnen. Da ersann die alte Königin zu Hause einen unfehlbaren Test. Sie ließ die nächste Kandidatin, die ganz durchnässt am Stadttor erschienen war, in der Schlafkammer übernachten. Ganz unten auf die Bettstelle hatte sie eine Erbse gelegt und darauf zwanzig Matratzen sowie zwanzig Eiderdaunendecken gestapelt. Als die Unbekannte am nächsten Morgen klagte, dass sie überhaupt nicht schlafen konnte, weil sie auf etwas Hartem gelegen habe, da wussten alle, dass dies die richtige Braut war. Denn: „So empfindlich konnte niemand sein außer einer echten Prinzessin.“
Und? Wie zickig ist das denn? Wir sind keine Märchenprinzessinnen und sollten unsere Empfindlichkeiten auf ein angemessenes Maß reduzieren. Wie wäre es mit einer Currywurst draußen an der Ecke, wo es zieht und der Verkehr vorüberrauscht? Nur so als Übung. Na bitte: Geht doch!