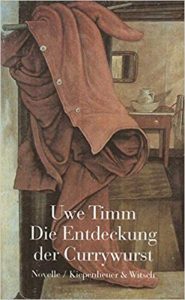Eine Legende hebt ab – Sönke Wortmanns verklärender Film „Das Wunder von Bern“
Von Bernd Berke
Allzu viele bleibende Legenden hat die Bundesrepublik nicht hervorgebracht. Schon deshalb gehört der deutsche Sieg bei der Fußball-WM 1954 („Wir sind wieder wer“) unbedingt ins Kino. In seinem Film „Das Wunder von Bern“ trägt Regisseur Sönke Wortmann das Zeitkolorit mit breitem Spachtel auf.
Der in Marl geborene Wortmann, früher selbst ein begabter Kicker, hat sich viel vorgenommen: In etlichen Spielszenen sucht er den berühmten „Geist von Spiez“ zu beschwören, der die deutschen Balltreter um Fritz Walter und den kürzlich verstorbenen Helmut Rahn zum Titel getragen haben soll.
Zudem schildert er das in kohlenschwarzer Dürftigkeit geradezu pittoreske Ruhrgebiet jener Zeit – zwischen Zechensiedlung, Taubenschlag und Eckkneipe. Noch dazu erzählt Wortmann die (Familien)-Geschichte eines Kriegsheimkehrers – und die WM-Erlebnisse eines jungen Sportreporters aus München, der mit seiner schicken Frau als Kontrastfigur zur Revier-Tristesse daherkommt.
Wie passt das zusammen? Nun, der elfjährige Matthias Lubanski (Louis Klamroth) wohnt mit Mutter (Johanna Gastdorf) und zwei älteren Geschwistern in einer Essener Bergarbeitersiedlung, sie betreiben eine Schankwirtschaft. Einer der Nachbarn im Viertel heißt – Helmut Rahn! Täglich trägt Matthias ihm, der sein Ersatzvater oder starker Bruder sein könnte, die Tasche zum Training von Rot-Weiß Essen. Rahn wiederum, den sie alle „Boss“ nennen, redet dem Jungen (und sich selbst) ein, dass er wichtige Spiele nur gewinnt, wenn der kleine „Furzknoten“ Matthias im Stadion ist.
Sascha Göpel spielt das Essener Fußball-Idol als kernigen Reviertypen – immer einen deftigen Spruch auf den Lippen, öfter mal die Bierflasche am Hals und das Herz auf dem richtigen Fleck. Eines Tages kehrt Matthias‘ Vater (Peter Lohmeyer) aus russischer Kriegsgefangenschaft heim. Als der Kumpel wieder in „seinen“ Schacht einfährt und die Presslufthämmer dröhnen, glaubt er Maschinengewehre zu hören. Auch hat er sich von der Familie entfremdet, will aber sofort wieder das Heft in die Hand nehmen. Konfliktstoff! Und der wird schauspielerisch sorgsam, wenn auch nicht ganz klischeefrei abgetragen.
Bei Rahns Tor jubeln Mönche und Kommunisten
Parallel dazu durchleidet man noch einmal das ganze WM-Turnier. Trainer Sepp Herberger (knorrig-verschmitzter Patriarch: Peter Franke) sondert klassische Sprüche ab. „Der Ball ist rund, und das Spiel dauert 90 Minuten“. Diese unvergängliche Weisheit hat er (laut Film) von einer betagten Schweizer Hotelputzfrau.
Es ist einer der raren ironischen Momente, wenn Herberger ihre verbale Steilvorläge anderntags der WM-Journaille auftischt. Sonst vermisst man solche sanften Brüche. Die Heldensaga treibt zwischen Trübsal und Pathos voran. Meist ist die Geschichte gut „geerdet“, doch einige Szenen heben bedenklich verklärend ab.
Hauptsache fürs Revier, dass Rahn endlich aufgestellt wird. Mit jedem Sieg heilen (so Wortmanns Kurzschluss) auch die Wunden der Faimilie Lubanski. Hier gilt als das wahre Wunder von Bern, dass die Menschen vom Krieg und seinen Folgen genesen.
Der Vater leiht sich vom Pfarrer („mit Gottes Segen“) einen klapprigen DKW und tuckert mit Sohn Matthias zum WM-Finale. Man weiß ja: Wenn der Kleine vor Ort ist, kann’s klappen. Als Rahn das erlösende 3:2 gegen Ungarn schießt, jubeln hier alle mit – vom Mönch bis zum Ost-Berliner Kommunisten. Bestimmt will Wortmann damit keine neue „Volksgemeinschaft“ aufleben lassen. Doch der Regisseur hat sich mitreißen lassen vom Mythos, bis hin zum fragwürdigen Schluss: Wenn die WM-Gewinner mit dem Zug heim gekommen sind, schwebt die Kamera hoch und schwelgt im bäuerlichen Idyll, als sei die „deutsche Scholle“ der Urgrund, auf dem glorreiche Siege wachsen. Da sind, mit Schaudern sei’s gesagt, gewisse Entäußerungen der NS-Malerei nicht allzu fern. Zwiespältig genug! So kann’s gehen, wenn sich einer kopfüber in die Zeitgeschichte stürzt.