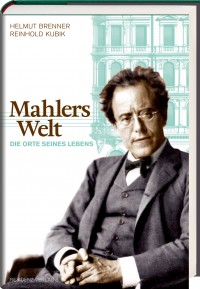In vino veritas! Wer wollte bestreiten, dass im Wein der Widerschein von Weisheit und Wahrheit funkeln kann? Das edelste aller Getränke spornt den Menschen seit jeher auch zu sprachlichen Anstrengungen an, mit denen er den zahllosen Geschmacksnoten halbwegs gerecht werden will – ein ähnlich schwieriges Unterfangen wie die verbale Umschreibung musikalischer Nuancen.

Von einem Schloss zum anderen… (Foto: Bernd Berke)
Der mindestens ebenso starke Hang zur Bequemlichkeit hat allerdings eine standardisierte, vielfach zu Formeln geronnene Sprache mit sich gebracht, die sich derart in Schwärmerei und Huldigung ergeht, dass oft genug die Gefilde des Lächerlichen gestreift werden. Da wird geraunt, rhapsodiert, psalmodiert und in die Harfe gegriffen, dass es nur so rauscht.
Aus zwei umfangreichen Weinkatalogen renommierter Häuser (Hanseatisches Wein- und Sektkontor sowie Tesdorpf) habe ich gängige Floskeln des Rühmens herausgepickt, wie sie nach der Verkostung offenbar so anfallen. Am Schluss dieses Beitrags finden sie sich in einer Auflistung, quasi fürs Vokalbelheft.
Mutmaßung: Wer die wichtigsten Signalwörter einigermaßen stilsicher anwendet, der ist schon ziemlich gut für den Verkauf gerüstet. In diesem Sinne ist es eine peinliche Entgleisung, wenn hie und da von „Powerwein“ gemunkelt wird. Die unbedarfte Wortschöpfung passt nicht in eine Welt, in der ansonsten Jahrhunderte währende Traditionen beschworen werden und in der etwa die Punktewertung des Wein-Gurus Robert Parker wie in einer Monstranz einhergetragen wird.
Bei all dem vermengen sich Begrifflichkeiten für Duft- und Geschmacksnoten manchmal bis zur Unschärfe. Überhaupt gewinnt man bei fortlaufender Lektüre solcher Beschreibungen den Eindruck, dass man die häufigsten Weinwörter nahezu beliebig kombinieren und stapeln kann – schon klingt es nach dem Jargon der Eingeweihten. Doch fragt man sich bang, wie die stille Post von den hochsensiblen Degustierern zu den Werbetextern gelangt. Ob da immer alles so ankommt, wie es gemeint war?
Vollmundige Lobpreisungen setzen bereits bei Gewächsen an der 12-Euro-Grenze ein, so dass bei edlen Tröpfchen zu mehreren tausend Euro pro Flasche auch sprachlich die Luft nach oben ganz dünn wird. Die stets selig schwelgenden Texter haben ihr Pulver, so scheint es, schon längst auf dem Gelände der moderaten Einstiegspreise verschossen. Was soll man verbal noch nachlegen, wenn man schon den einen oder anderen 25-Euro-Wein der „Weltklasse“ zugerechnet hat? Hier empfiehlt es sich vielleicht, die Fachsprache noch entschiedener zu systematisieren, also auf strenge Hierarchie zu trimmen und bestimmte Worte nur den teuersten Weinen vorzubehalten…
Es fällt auf, dass der Hanseaten-Katalog immerzu mit dem Begriff „Körper“ („saftiger Körper“, „mächtiger Körper“) wuchert und so manchen „Abgang“ („warm und schön lang“) getreulich verzeichnet, während es Tesdorpf eher mit Struktur, Statur und Finale hält. Im Großen und Ganzen aber überschneidet sich das wabernde Vokabular der Weinbeschreibung, wie es sich in vielen Jahrzehnten verfestigt hat. In aller Regel sind die angepriesenen Weine zumindest harmonisch und gut ausbalanciert, sodann beispielsweise nobel oder vital. Mit steigenden Preisen mehren sich denn doch Verzückungsworte wie diese: umwerfend, atemberaubend, betörend, hinreißend, bezaubernd, aristokratisch, majestätisch, zum Niederknien, monumental, unergründlich oder unbegreiflich. Man muss sich das mit tremolierender Stimme und weit ausholender Geste von einer gülden umrahmten Bühne herab gesprochen vorstellen. Oder gleich vor einem Altar mit Tabernakel.
Da wir hier in einem Kulturblog sind, folgen jetzt noch vier erlesene Wein-Vergleiche aus dem Reich der Künste. Bitte festhalten, es geht gleich scharf in die Kurve:
Tänzerisch wie der leichtfüßige Tanz des legendären Rudolf Nurejew.
Hier perlen die Aromen wie Bach’sche Fugen.
…zart konturiert wie ein Bild von Claude Monet
…überrascht mit aromatischen Wendungen wie eine Oper von Verdi
______________________________________________________________
So. Und nun der samt und sonders aus Originalzitaten geschöpfte Lernstoff, der beim nächsten Mal „sitzen“ soll, ganz nach dem altbewährten Motto: Hefte `raus – Klassenarbeit!
Kleines Weinbeschreibungs-Lexikon
ABGANG, FINALE & Co.
Erstaunlich frischer Abgang
Der Abgang ist warm und schön lang
Nachhaltiges Finale
Mit grandiosem Feuerwerk im Finale
Im Finale macht sich eine leicht malzige Würze bemerkbar
Mit einem sehr langen Finish
Ewig langes Finish
Konzentrierter, zugleich aber filigraner Nachhall
Tiefer und langer Nachhall
Langer, saftiger Nachhall
Beträchtliche Persistenz
Von beeindruckender Persistenz
FRUCHT
Die Aromen sind fruchtig und floral
Reife Frucht und kühle Mineralität wunderbar ausbalanciert
Geradlinig fruchtig
Schön prononcierte Fruchtaromen
Fruchtbetont
Delikate Frucht
Richtige Balance von Frucht, Frische und Volumen
Sehr schön ausgefeiltes Frucht-Säure-Spiel
Mit prallen Frucht-Aromen und überbordender Vitalität
Subtile, hochelegante Frucht
Üppige, elegante Frucht
Üppige und auskleidende Frucht
Saftig pikante Frucht
Brillanz der prallen Frucht
Feuerwerk delikat fruchtiger Aromen
GAUMEN
Der Gaumen ist samtig
Am Gaumen schmelzig und rund
Am Gaumen vielschichtig und samtweich
Am Gaumen sauber und erfrischend
Am Gaumen substanzreich und komplex
Am Gaumen wirkt er schlüssig und stimmig
Am Gaumen ein Schmeichler
Die Präsenz am Gaumen ist geschmeidig und sehr samtig, zeigt aber durchaus Kraft und Muskeln
…der den Gaumen liebkosend willkommen heißt
…dessen Präsenz am Gaumen einem Vulkanausbruch gleichkommt
Am Gaumen entwickelt sich ein regelrechter Sturm der Aromen
Der Gaumen wird von runden, samtigen Gerbstoffen zart gestreichelt
KÖRPER
Beeindruckt mit Frucht, gutem Körper und Tiefe
Hat einen vollen Körper
Mit charakteristischem und stabilem Körper
Mächtiger Körper
Am Gaumen mit tollem Körper
Der Körper ist stabil
Saftiger Körper
MINERALITÄT
Mineralische, erdige und leicht florale Noten
Hintergründige Mineralität
Beinahe salzige Mineralität
Rassige Mineralität
Hintergründige, feinherbe Mineralität
Säurespiel mit mineralischem Nerv
Cremige Mineralität
Erfrischende Mineralität
…ruht die Frucht auf einem mineralischen Kissen
NASE
Die Nase ist klar
Zeigt eine reife Nase
Vielschichtige Nase
Eine saubere, klare Nase
Hat eine konzentrierte Nase
STRUKTUR
Plus an Struktur und Kraft
Elegante Struktur
Subtile Struktur
Samtig-weiche, noble Struktur
Tiefgründig strukturiert
Von verwobener Struktur
Nobel strukturiert
Türmt sich die aromatische Struktur geradezu auf
Weit ausholende Struktur
Sehr reich in seiner Struktur
Verzaubernd strukturiert
Bezaubernd im reich strukturierten Duftspiel
Fein geschliffene Struktur
TANNINE
Angenehme Tanninstruktur
Seidenfeine Tannine
Seidige Tannine
Durch sechs Monate Barrique geschmeidig gewordene Tannine
Tanninrückgrat
Mit seidigen Tanninen gut strukturiert
Tannine sind fest und stabil
Runde Tannine
Weiche Tannine
Tannine sind fein und zurückhaltend
In Samt und Seide gehüllte Tannine
Zart schmelzende Tannine
Feinmaschige Tannine
Zarte, reife Tannine ummanteln den Säurenerv
TEXTUR
Die Textur ist viskos
Seidenfeine Textur
Feincremige Textur
Perfekt eingebundene Textur
TERROIR
Schieferkalk-Terroir
Schiefer-Terror
Terroirbezogen
Nektar des Bordelaiser Terroirs
VERSCHIEDENES
Spritzig frisch, lebendig
vital
juvenil
Mit dem besonderen „Pfefferl“
Maskulin im Auftreten
Geradezu muskulös
Blumige Akkorde
Herrlich saftig
Atemberaubendes Elixier, das sprachlos macht
Er ist tiefdunkel und deutet schon mit prächtigen „Kirchenfenstern“ Viskosität und Volumen an.
Samtig, sanft und auskleidend
„Outstanding“ schreibt Parker über diesen „Wahnsinn im Glas“.
Sensationell, nobel, feingliedrig, distinguiert und tiefgründig
Sagenhaft samtig, unglaublich dicht, hochelegant und doch kraftvoll
Kostümiert sich mit einem filigranen Duftspiel
Hinreißender Wein mit magischem Tiefgang
Komplexes aromatisches Geflecht
Schmeichelt den Sinnen wie eine warme, sternklare Nacht
…dass die Sinne nicht nur vibrieren, sondern beben
AROMEN, BOUQUET
Ananas Anis Apfel Aprikosen
Backpflaumen Beerenkonfitüre Birne Bittermandel Bitterschokolade Blaubeere Brioche Brombeere
Cassis
Datteln Dunkle Beeren Dunkles Steinobst
Eichenholz Erdbeeren Espresso Eukalyptus Exotische
Früchte Feigen Feuerstein Flieder Florale Komponenten
Gelbe Früchte Gewürzschränkchen Grapefruit
Haselnuss Himbeere Holunder Holz Honig Honigmelone
Jasmin Johannisbeere
Kaffee Kandierte Früchte Karamell Kernobst Kirsche Kirschkompott Konfitüre Koriander Kräuter der Provence
Lakritz Lavendel Lebkuchengewürz Leder Limetten Limonen Lorbeer Lychees
Mandelblüten Marillen Marzipan Maulbeeren Melone Minze Mokka Mokkabohnen
Nektarinen Nelke Nüsse
Orangenblüten Orangenschalen Orient-Tabak
Paprika Pfirsich Pflaumen Pflaumig-malzig-traubig Pfeffer Pilze
Quitte
Rhabarber Rosen Rosenholz Rosinen Rosmarin Röstaromen (dezente…) Rumtopffrüchte
Sandelholz Schattenmorellen Schokolade Schwarze Johannisbeeren Schwarze Oliven Schwarzer Tee Schwarzkirsche Stachelbeere Steinobst Süßholz Süßkirsche
Tabak Tarte au Citron Thymian Toastbrot Toffee Trockenfrüchte Trüffel
Vanille Veilchen
Waldbeeren Waldboden Waldfrüchte Walnüsse Weichselkirsche Weihrauch (Anmutung von…) Weinbergpfirsiche Weiße Blüten Weißer Pfeffer Wiesenblumen Wildkräuter
Zabaione Zartbitter Zedernholz Zigarrenkiste Zimt Zitronenbaiser Zitronengras Zitrusfrüchte Zwetschgen