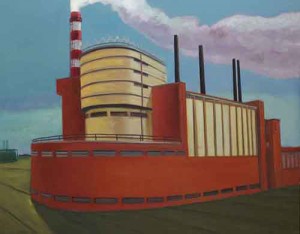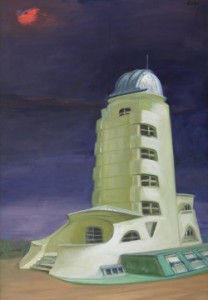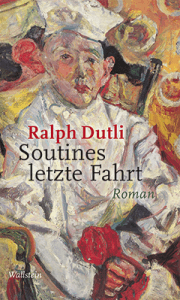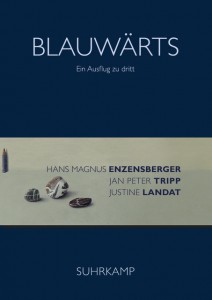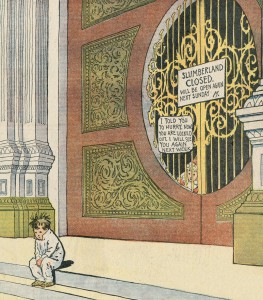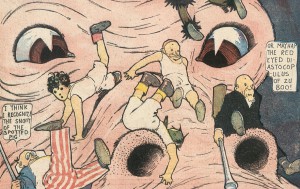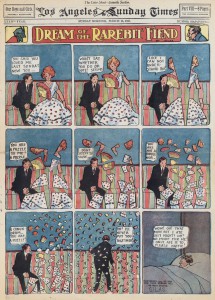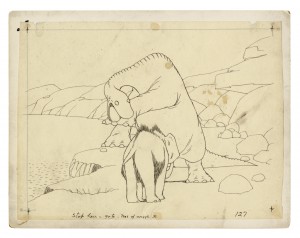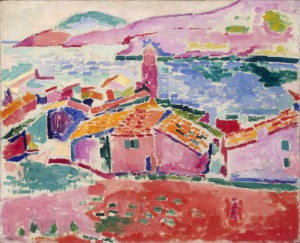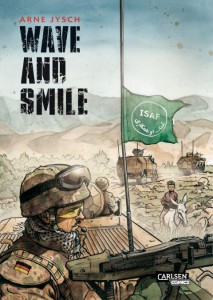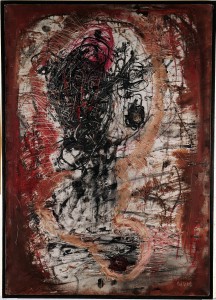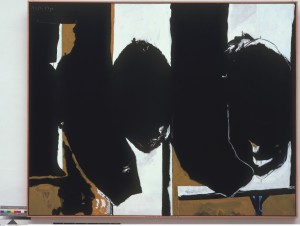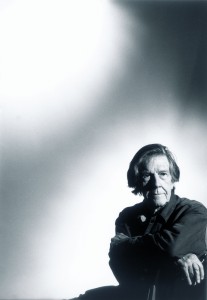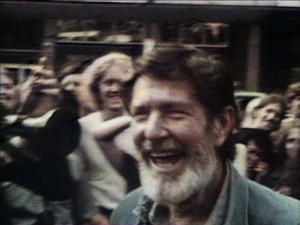geschrieben von Werner Häußner | 6. September 2013
Ein feines Kunst-Event, vor allem für Freunde zeitgenössischer Kunst, findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt: Zum „DC Open“ schließen sich 50 Galerien aus Düsseldorf und Köln zusammen, um die Saison mit einem Wochenende zu eröffnen. Der Ausstellungs-Parcours soll die künstlerisch spannende Region vorstellen und knüpft an die Sammler- und Sammlungstradition im Rheinland an. Die Galerierundgänge, erleichtert durch einen Shuttle-Service zwischen den beiden Städten, beginnen am Freitag, 6. September, 18 Uhr.
Nach einem erfolgreichen Start im letzten Jahr bietet DC Open auch in diesem Jahr wieder ein breit angelegtes Programm an Kuratoren- und Sammlerführungen. Eingeladen sind 2013 die Museumsvereine der Umgebung, dazu Ausstellungsmacher, Kunsthistoriker und Sammler schwerpunktmäßig aus Warschau und Istanbul. Geplant ist der Besuch von Galerien, Künstler-Präsentationen und Privatsammlungen. Somit ist DC Open nicht nur ein Wochenende für Kunstinteressierte, sondern auch ein internationaler Treffpunkt für Profis aus der Kunstszene.
Einige Beispiele: Die Galerie Kaune, Posnik, Spohr in der Albertusstraße in Köln zeigt unter dem Titel „Excerpts from Silver Meadows“ Fotos des Amerikaners Todd Hido. Die Bilder, die bis 29. November zu sehen sind, beziehen sich auf eine reale Straße in Kent in Ohio, wo der Künstler seine Kindheit verbrachte.

Benedikt Hipp: „In der folgenden Betrachtung wird vorausgesetzt der Körper sei eindimensional“. Bild: Courtesy Galerie Kadel Willborn
Hido hält jedoch nicht die – nicht mehr existierende – Vorstadtwelt der siebziger und achtziger Jahre fest, sondern fotografiert Orte, die ihn an diese nicht mehr betretbare Kindheitswelt erinnern. Entstanden sind sinnlich-expressive Bilder, geheimnisvolle Landschaften, ambivalente Porträts junger Frauen. Hido ist 1968 geboren, studierte an der „Boston School of the Museum of Fine Arts“ und der Tufts University. Seine Arbeiten werden weltweit gezeigt; der Künstler lebt in der San Francisco Bay Area.
In Düsseldorf zeigt Kadel Willborn an seinem Sitz in der Birkenstraße bis 12. Oktober Arbeiten von Benedikt Hipp: neue kleinformatige Gemälde in hellen Farbtönen und Zeichnungen mit Collagen-Einsprengseln sowie installative Arrangements aus Elementen wie Plastiken, Readymades und objets trouvés. Der 1977 in München geborene Künstler konnte sich seit 2004 in mehreren Einzelausstellungen vorstellen, ist aber für die Rhein-Ruhr-Region ein „Newcomer“.
Bei conrads in der Düsseldorfer Lindenstraße ist Kunst mit differenzierten Bezügen zu Politik, Kunst-, Architektur- und Mentalitätsgeschichte zu erleben: „Great Nature®“ zeigt Arbeiten von Blaise Drummond – etwa das Bild „When the Cathedrals were White“. Im Titel greift er eine Schrift des Architekten Le Corbusier auf, im Bild interpretiert er Camille Corots Gemälde „Chartres Cathedral“. Drummonds Bilder oszillieren – so die Galerie in ihrer Mitteilung – zwischen dem Scheitern der Ideale und dem Wunsch nach einem Neubeginn. Der Architektur stehe in den Bildern die Natur gegenüber – in einer fragmentarischen Repräsentation und auch als Element des Konflikts und des Widerspruchs. Die Ausstellung ist bis 19. Oktober zu sehen.

Matthias Danberg, Zahnrad, C-Print, 2013, courtesy Galerie Voss, Düsseldorf
Die Galerie Voss, Mühlengasse, Düsseldorf, lässt sich mit Arbeiten von Matthias Danberg auf einen Künstler ein, der vor allem am Computer arbeitet. Danberg zielt auf Schichten historisch-kultureller Entwicklung, verarbeitet sie in einer narrativen, metaphorischen Bildsprache. „Seine künstlerische Strategie changiert dabei zwischen der kalten Simulationsästhetik des Virtuellen auf der einen Seite und der subjektivindividuellen Gestaltungskraft eines tendenziell anachronistischen und damit widerständigen Künstlerverständnisses auf der anderen“, heißt es in der Pressemitteilung der Galerie. Danberg hat in Dortmund und Münster Philosophie und Kunst studiert. Er lebt in Düsseldorf.
Fünf neue abstrakte Skulpturen des Mexikaners José Dávila zeigt die Galerie Figge von Rosen in der Aachener Straße in Köln unter dem Titel „Das muss der Ort sein“. Gezeigt werden auch einige seiner „cut-outs“, Fotodrucke, in die weiße Leerstellen geschnitten sind. Dávila, 1974 in Guadalajara geboren, hatte zahlreiche Einzelausstellungen weltweit. Schon 2011 zeigte die Galerie Figge von Rosen Arbeiten von ihm unter dem Titel „Nowhere Can Be Now Here”.
Jeff Cowens fotografisches Werk bewegt sich zwischen abstrakten, malerischen Kompositionen, Motivcollagen und subtil verfremdeter Porträtfotografie. Der 1966 in New York geborene Künstler wurde bereits 2012 vom Kunsthandel Michael Werner präsentiert. Zum DC Open sind nun neueste Arbeiten Cowens in der Kölner Gertrudenstraße ausgestellt. Zu der Schau erscheint ein Katalog. Bis 26. Oktober sind die Werke zu sehen, die das weite Feld bildnerischen Arbeitens in der Fotografie ausmessen.
Ganz „klassisch“ dagegen präsentiert sich die Galerie Boisserée in der Kölner Drususgasse: Sie zeigt bis 2. November Skulpturen, Radierungen, Lithografien und Arbeiten auf Papier des in Brühl geborenen Max Ernst (1891 bis 1976). Zu dieser Ausstellung erscheint ein 160seitiger Katalog mit einem Text von Jürgen Pech, wissenschaftlicher Leiter des Max Ernst Museums Brühl. Er ist zum Preis von 20 Euro auch per Postversand von der Galerie erhältlich.
Die DC Open 2013 findet vom 6. bis 8. September statt. Die beteiligten Galerien sind am Freitag, 6. September, ab 18 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 12 bis 20 Uhr, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Am Samstag, 7. September verkehrt ein Shuttle-Bus zwischen Köln (Rudolfplatz/Barcelò Hotel) und Düsseldorf (Grabbeplatz/Hermannplatz). Er verlässt Köln um 13, 16, 19 Uhr und Düsseldorf um 12, 15, 18 Uhr. Information: www.dc-open.de
geschrieben von Werner Häußner | 6. September 2013
Die Beachtung für den Künstler wächst, und die neue Ausstellung in der Wuppertaler Von der Heydt-Kunsthalle wird dazu beitragen: Ab 8. September werden dort Werke des in Berlin lebenden Malers und Lichtkünstlers Sven Drühl gezeigt.
Drühl, 1968 in Nassau/Lahn geboren, setzt sich vornehmlich mit Landschaften auseinander, malt aber auch Architekturdetails oder Einsichten in Industrie- oder Technikbauteile. Immer wieder kreiert er auch Installationen aus Neonröhren.

Sven Drühl: E.T.C., 2012, Sammlung Zeebs, Berlin, Copyright: VG Bild-Kunst 2013
In der Region ist Drühl nicht unbekannt: Von 1991 bis 1996 studierte er in Essen Kunst und Mathematik; bis 1999 hatte er einen Lehrauftrag an der Gesamthochschule Essen inne. Im Museum Morsbroich in Leverkusen und im Museum am Ostwall in Dortmund fanden 2002 seine ersten Einzelausstellungen mit dem Titel „Die Aufregung“ statt; in Gruppenausstellungen wurden bereits 1999 Werke Drühls in Recklinghausen und Essen gezeigt.
Auch danach blieb er in der Kunstszene in NRW präsent: Zuletzt widmete die Galerie der Stadt Remscheid 2008 dem Künstler eine Einzelschau. Außerdem war Drühl 2012 in der Ausstellung „Kalte Rinden – Seltene Erden“ im Märkischen Museum Witten zu sehen, die sich der Landschaft in der Gegenwartskunst widmete.
In Wuppertal werden nun Arbeiten aus den letzten 12 Jahren seit 2001 ausgestellt. So will die Kunsthalle mit der Schau „unterschiedliche Werkserien und Motivlinien“ deutlich machen.
Kennzeichnend für Drühls Arbeiten ist das Arrangieren, Zitieren oder Dekonstruieren vorgefundenen Materials, das er aus den Werken anderer Künstler nimmt: Caspar David Friedrich oder Ferdinand Hodler kommen ebenso vor wie Zeitgenossen, etwa Wolfgang Tillmans. In seinen Gemälden verwendet Drühl Ölfarbe, Lack und Silikon und schafft mit diesem Materialmix Verfremdung und Vertrautheit, gibt ihnen den – ironisch geladenen – Charakter des Dekorativen und gleichzeitig eine unbehaglich sterile Enthobenheit.

Eines der neuesten von Drühls Neon-Bildern: F.H. von 2013. Copyright: VG Bild-Kunst 2013
Die Ausstellung „Sven Drühl. Werke 2001 bis 2013“ ist bis 14. Januar 2014 zu sehen. Die Von der Heydt-Kunsthalle in Wuppertal-Barmen ist von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet; der Eintritt kostet drei, ermäßigt zwei Euro. Am 10. November, 15 Uhr, findet ein Künstlergespräch mit Sven Drühl statt. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit Texten von Gerhard Finckh, Peter Forster und Loop Moss. Das 144seitige Werk kostet 15 Euro.
geschrieben von Katrin Pinetzki | 6. September 2013

Levée des conflits / Ruhrtriennale
Das Stück beginnt, und nach wenigen Minuten haben die Zuschauer oben im Amphitheater auf der Halde Haniel in Bottrop alles gesehen. Das können sie zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wissen. Erst mit zunehmender Dauer von Boris Charmatz‘ Choreografie „Levée des conflits“ (Die Aufhebung der Konflikte) erahnt man das Prinzip, begreift die Struktur im vermeintlichen Chaos.
Der französische Tänzer und Choreograf, der schon vor einem Jahr bei der Ruhrtriennale mit seinem Mensch-Maschine-Stück „enfant“ für Aufsehen sorgte, lässt die 24 Tänzer diesmal kein Stück in klassischem Sinne aufführen. Es gibt weder Thema noch Handlung, keine Entwicklung und kaum tänzerische Interaktion. Vielmehr bildet Boris Charmatz eine kinetische Skulptur. Er schafft mit tänzerischen Mitteln ein Stück bildender Kunst auf der Bühne – ein Perpetuum Mobile aus einem festgelegten Bewegungskanon, der von den Tänzern zeitversetzt ausgeführt wird.
Es beginnt mit einer Tänzerin. Sie setzt sich auf das mit Rasen ausgelegte Bühnenrund und streicht weit ausholend übers Gras, als würde sie sich einen Schlafplatz zurechtmachen. Etwa eine Minute später die nächste Figur: Sie streckt den Hintern gen Luft und schiebt ihn nach links und rechts wie eine Katze. Eine Minute später steht sie und schlägt, beide Armen vor- und rückschleudernd, auf Brust und Rücken zugleich. Eine Minute, dann folgt ein maschinenähnliches Hantieren mit unsichtbaren Geräten, das einem nicht zu durchschauenden Ziel folgt.
Minütlich folgen weitere Bewegungsabläufe, und längst sind weitere Tänzer in Straßen- oder Sportkleidung auf die Bühne gekommen. Ohne erkennbar Notiz voneinander zu nehmen, führen sie die gleiche Abfolge aus, jeder in seinem Tempo, jeder in seinem Stil – bis zwei Dutzend Tänzer gleichzeitig auf der Bühne sind. Sie rollen und winden sich über den Boden, hüpfen und springen, drehen sich um die eigene Achse, lassen sich zu Boden werfen und wieder aufhelfen, fließen weich wie eine Welle durch den Bühnenraum und scheinen alle Möglichkeiten auszukosten, ihn mit dem eigenen Körper zu erkunden. Dazu läuft eine Sound-Collage: Mal sind es HipHop-Fetzen, mal avantgardistische Neue Musik, mal industrielle Geräusche, mal alles zugleich.
Irgendwann scheinen sich die Tänzer wie zufällig zu formieren: Es zentriert sich ein strudelartiges Knäuel in der Mitte, dann am Rand. Obwohl jeder für sich arbeitet, bilden sie doch erkennbar ein Ganzes. Es braucht seine Zeit, diesen irgendwann sogar meditativen Rhythmus zu erkennen und es letztlich zu genießen, seine Augen in dem Strudel treiben zu lassen, der ständig wiederkehrende und doch neue Bilder produziert.
Die nötige Muße dazu kam allerdings wetterbedingt nur schwerlich auf. „Das Stück ist sowieso chaotisch, aber heute Nacht ganz sicher“, hatte Charmatz vor Beginn mit Blick auf das Wetter angekündigt. Der leichte Regen wurde im Laufe des Stücks immer heftiger, so dass die Compagnie des „Musée de la Danse“ aus Rennes sich am Ende entschloss, die Aufführung etwas abzukürzen. Dankbarer, dennoch begeisterter Applaus.
geschrieben von Rolf Dennemann | 6. September 2013
Die Installationen der RuhrTriennale – umsonst und teilweise draußen. Jeder soll teilhaben an den Großkunstwerken, die die diesjährige RuhrTrienale zum temporären Einsatz eingekauft hat.
Heiner Goebbels, Experiment-Experte und moderierender Leiter des Kunstfestivals, stellte Künstler und Werke vor. Und alles ist so, als sei es am richtigen Ort zur richtigen Zeit – Festspielzeit im Nachhang des Sommers. In allen großen Nachrichtensendungen des Fernsehens wurde die Eröffnung bildreich angekündigt und man verwechselte schon mal Bochum mit Essen.

Dusche (Foto:Dman)
Und wenn es noch heiße Tage geben sollte, dann kann der zufällige Spaziergänger vor dem Ruhrmuseum sich seiner Klamotten entledigen und unter die Dusche springen, die da von der Künstlergruppe „rAndom international“ in Zusammenarbeit mit „Urbane Künste Ruhr“ errichtet wurde. 25.000 Liter Wasser rauschen dort pro Minute von weit oben in einem Viereck auf den Boden nieder, wo sich bei Sonne ein Regenbogen bildet. Nachts wird alles künstlich erhellt, was das Publikum sich tags denken darf. Der Ort sei dafür eine Entdeckung, sagte man. Nun ja, versteckt liegt er nicht und der urbane Raum ist das bekannteste Open-Air-Museum des vergangenen, lauten Zeitalters der krachenden Industriewerke im Revier.
Wer die Mischanlage der Kokerei Zollverein zum ersten Mal betritt, wird vor lauter Erbauung erst mal verstummen. Ein gigantischer Eindruck verhärtet hier den Gedanken an harte Arbeit und die schwere schmutzige Ressource Kohle.

Geisterbahn (Foto:Dman)
Der Schotte Douglas Gordon durfte sich hier auslassen und schuf Lichteffekte, Videos und einen poetisch-brachialen Sound. Es nebelt und bubbert. Im gefilmten Treppenaufgang wird gesungen und musiziert, auf einem Monitor sieht man einem Raben zu, wie er sein Mahl zerrupft und frisst. Eine Art Explosionssound lässt gar diese Mauern erzittern. Der Raum wird erneut illustriert, aber beeindruckend. Als Gordon, der Kaugummi kauend witzig lässig seine Unternehmung „Silence, Exile, Deceit“ beschreibt, erzählt er von seinem kleinen Sohn, dem es gruselte: „Like in a haunted house“ (Wie in einer Geisterbahn). Das ganze Ruhrgebiet sei eine Art Geisterbahn. Das ist allerdings wunderbar und die liebevoll britische Art von Humor. Aber wenn man drin lebt, erschrickt man nicht mehr.
Das edle Museum Folkwang zeigt zwei Arbeiten des Choreographen William Forsythe, der seit langem Tanz und Bildende Kunst auf gleiche Ebenen bringt. Zunächst kann mich sich als Besucher in einer

Installation „Nowhere and everywhere at the same time Nr.2“ (Foto Dman)
Art Zerrspiegel zeitversetzt in verschiedene Positionen schieben, ein Spiel mit Zeit und Selbstbild. In der großen Halle findet man sich dann zu einem Spielraum für Erwachsene zusammen. Von der Decke hängen Pendel, die sich unter Pufflauten verschieben. Man darf und soll hineintreten, allerdings nicht mehr als 12 Personen gleichzeitig. Der Mensch tanzt unwillkürlich durch die engen Gassen zwischen den Fäden mit den Pendeln. Berührt man sie, hat man verloren. Die einen schauen, die anderen tänzeln, laufen, stehen, versuchen zu gewinnen. Preise gibt’s nicht im Spiel- und Tanzzimmer.
Das größte Werk ist in der Kraftzentrale des Duisburger Landschaftsparks zu sehen, Ryoji Ikedas „test pattern“ in der 100-Meter-Version. Und das geht nur in einer solchen Halle. Der Komponist und Bildende Künstler der „elektronischen Szene“ wird mit seinen audio-visuellen Werken international durchgereicht, war bei zahlreichen electronic-art Festivals und in den großen Museen zu sehen und zu hören. Für zart besaitete Kunstliebhaber ist dieser Ort eher ein Raum der Verstörung.

Test Pattern (Foto Dman)
Unsäglich hohe Töne zersägen den Kopf, bevor tiefe Töne den Bauch bewegen. Auf der 100-Meter-Fläche wechseln in nicht wahrnehmbarer Geschwindigkeit Formen in schwarz-weiß. Man kann die Strecke begehen, laufen, rennen, stehen bleiben, sich dem Ganzen aussetzen. Das hat zwar keinerlei poetische Wärme, aber das muss ein elektronisches Werk auch nicht haben. Es ist laut und schrill und sicherlich für viele ein beeindruckendes Beispiel für die „Macht des Unaufhaltsamen“ , die digitalen Daten und Barcodes.
geschrieben von Eva Schmidt | 6. September 2013
Fünf Spidermen fassen sich an den Händen und tanzen Ringelreihen. An wen erinnert bloß diese Tanzszene, die der in Dortmund geborene Künstler Martin Kippenberger so kühn aufs Papier gebannt hat? Genau: „La Danse“ von Henri Matisse ist das Vor-Bild für die ironische Collage und dass beide Künstler nun in einem Museum zusammentreffen, kein Zufall: Zum 50. Geburtstag des Musée Matisse zeigt Nizza unter dem Titel „Un été pour Matisse“ (Ein Sommer für Matisse) noch bis zum 23. September insgesamt acht Ausstellungen, die von dem berühmtesten Maler der Côte d’Azur inspiriert sind.

Musée Matisse, Nizza, Foto: E. Schmidt
Von 1917 bis zu seinem Tode 1954 lebte und arbeitete Henri Matisse in Nizza, hier schuf er sein farbenfrohes, vom Licht der Küste durchdrungenes Oeuvre. Den Rundgang auf den Spuren des Malers beginnt man am Besten in der roten Villa auf dem Berg über Nizza im Stadtteil Cimiez, in der heute das Musée Matisse untergebracht ist. Hier widmet man sich zum Jubiläum dem Thema der Musik im Werk von Matisse, die ebenso wie der Tanz eine zentrale Rolle bei ihm spielte. Seine Bilder zeigen Instrumente und mehrfach Tochter und Sohn an Klavier und Geige. Ergänzt wird die Schau durch die dazu passenden historischen Instrumente. Im Untergeschoss lernt man die Vielseitigkeit des Meisters erst richtig kennen: Es finden sich Theaterkostüme und eine schwungvolle blaue Keramik, die Matisse zur Gestaltung eines Schwimmbads entworfen hat. Sein Enkel hat das gesamte Interieur kürzlich der Stadt Nizza geschenkt.
Das Sujet führt den Besucher ins nebenan gelegene Musée d’archéologie, einen kleinen modernen Zweckbau nahe der Ausgrabung einer römischen Therme. Als mondäner Badeort ging Nizza in die Tourismusgeschichte ein, hier widmet man sich dem Thema des Swimming-Pools in der Kunst und hat einige ganz hübsche Fotografien und Videos zusammengestellt, die einen ein wenig abkühlen. Doch es hilft alles nichts, wir müssen den Berg hinunter, ans blaue Meer. Die Straße führt vorbei am Hotel Regina, in dem Ende des 19. Jahrhunderts noch Queen Victoria mitsamt Hofstaat logierte. Später wurde das imposante Gebäude zum Grand Hotel, in dem Matisse von 1938 bis 1954 wohnte und sein Atelier hatte.

Palais Lascaris, Nizza, Foto: E. Schmidt
Unten, in der quirligen Altstadt, wird auf der Place Saint Francois gerade der Fischstand abgespritzt und die Fleischergesellen machen eine Zigarettenpause. Gleich um die Ecke liegt der Palais Lascaris, ein barocker Palazzo, der einen in schattiger Dunkelheit empfängt. Hier ist die Ausstellung „Matisse und die Jahre des Jazz“ untergebracht: Zwischen 1943 und 1949 schuf Matisse ein Künstlerbuch unter dem Titel „Jazz“: Sein schwebender Ikarus auf blauem Grund mit zackigen gelben Sternen ist weltweit bestimmt millionenmal nachgedruckt worden.
Wir wandern weiter in die gleißende Sonne entlang der berühmten Strandpromenade Boulevard d’Anglais zum Musée Masséna, das in einer herrschaftlichen Luxusvilla mit Meerblick residiert, die Victor Masséna d’Essling duc de Rivoli 1898 erbaute. Hier geht es um das Thema der Palme in der Kunst, ausgehend von Matisse, der den südlichen Sehnsuchtsbaum in verschiedensten Variationen immer wieder gemalt hat. Aber Picasso hat das auch nicht schlecht gemacht, wie man sieht.
Der Rückweg über die Rue de France verführt profanerweise zum Sandalenkauf mit viel zu hohen Absätzen, in denen ich die Stufen zum Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC) kaum mehr hochsteigen kann. Doch die Mühe lohnt, denn oben heißt es freundlich „Bonjour Monsieur Matisse“ und die Kuratoren haben eine beeindruckende Auswahl an moderner Kunst zusammengetragen, die den Einfluss des stilbildenden Meisters des 20. Jahrhunderts auf seine Nachfahren augenfällig werden lässt. Von Roy Lichtenstein über Jean-Michel Basquiat und Niki de Saint Phalle bis hin zu Martin Kippenberger ist einiges von Rang und Namen vertreten.
Aufmerksame Leser haben vielleicht mitgezählt: Wir haben nur fünf von acht Matisse-Ausstellungen geschafft. Leider mussten wir dann die schmerzenden Füße ins Meer hängen. Wer alle acht an einem Tag absolviert, soll sich bitte bei mir melden, aber ich brauche Beweise. Der Flug Düsseldorf-Nizza dauert nur anderthalb Stunden.
Infos: matisse2013.nice.fr
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
Solch einen Lehrer hätte man sicherlich gern gehabt: Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker verabreicht selbst schwierige Lektionen auf eine Weise, dass man unentwegt lacht – und gar nicht merkt, dass man unterwegs eine Menge gelernt hat; so auch in seinem Programm „Der Künstler ist anwesend“, das jetzt noch einmal bei 3Sat zu sehen war.
Es handelt sich um einen höchst unterhaltsamen Streifzug durch die Kunstgeschichte, der von der vorzeitlichen Höhlenmalerei in Lascaux bis zu Joseph Beuys führt. Am allerliebsten hält sich Jürgen Becker bei den Passagen auf, in die das Religiöse hineinspielt, denn da ist er wahrlich Fachmann.
Mal züchtig und mal splitternackt
Es kommt keine Minute Langeweile auf. Das Spektrum der 90-minüten Vortrags ist ungemein breit, es reicht von den Lackaffen, die man bei Galerie-Vernissagen antreffen kann, über Beziehungen zwischen ägyptischer, griechischer und altrömischer Kunst, bis hin zu Gerhard Richters umstrittenen Kirchenfenstern für den Kölner Dom.

Streifzug durch die Kunsthistorie: Kabarettist Jürgen Becker (© WDR/ZDF/Annika Fußwinkel)
Der vergnügliche Parforceritt führt kreuz und quer durch alle weiteren Epochen und Wechselfälle. Eine Leitlinie gibt zum Beispiel die Frage vor, wann sich die Kunst züchtig verhüllte und wann sie in Nacktheit schwelgte. Wie Becker etwas vom Wesenskern der Gotik oder des Barock in wenigen markanten Sätzen skizziert, das ist jedenfalls aller Ehren wert.
Keine Angst vor Kalauern
Ganz wie die großen Künstler oft das Höchste und das Alltäglichste erhellend kontrastiert haben, so lässt auch Becker gern die Luft aus allem allzu Aufgeblasenen und Erhabenen heraus, wobei er den einen oder anderen Kalauer keineswegs scheut. Lassen sich Bezüge zwischen hehrer Hochkultur und – zum Beispiel – den rheinischen Institutionen Karneval, „De Höhner“, Trude Herr oder dem 1. FC Köln herstellen, so wird nicht lange gefackelt. Nicht jeder Wortwitz ist subtil, doch einem wie Becker kann man kleine Fehlgriffe nicht krumm nehmen.
Jürgen Becker zählt als Kabarettist keineswegs zu den „harten Hunden“ der unerbittlichen Fundamentalkritik. Gerne lässt er fünfe gerade sein und auch schon mal menschliche Milde walten. Doch gar manche seiner Spitzen treffen sanft, aber wirksam ins Mark.
Die Wahrheit über die röhrenden Hirsche
Immer wieder schwenkt die Kamera der WDR-Produktion ins Publikum. Da sieht man nicht nur köstlich amüsierte Mienen, sondern auch Leute, die Becker geradezu atemlos wissbegierig folgen. Kein Wunder, erklärt er doch beispielsweise endlich einmal, was die millionenfach reproduzierten Bilder von röhrenden Hirschen wirklich zu bedeuten haben (es hat, ganz vornehm gesprochen, mit Arterhaltung zu tun).
Inzwischen ist die Szene längst höchst unübersichtlich geworden. Wer sagt uns denn, dass der Feuerlöscher an der Museumswand nicht auch wieder ein Kunstwerk sein soll? Doch ganz zum Schluss löst Jürgen Becker auf kölsche Weise sogar die knifflige Frage, was denn eigentlich Kunst sei. In der Stadt mit der weltgrößten Kunstspedition namens Hasenkamp kann die Antwort wohl nur so lauten: „Kunst ist alles, was von Hasenkamp transportiert wird…“
______________________________________________________________
Der Beitrag ist zuerst bei www.seniorbook.de erschienen

geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
Der Maler Walter Eisler stellt ins Zentrum seiner Bilder meist riesenhafte Gebäude, die er aus ihren ursprünglichen Zusammenhängen gelöst hat – von der Brauerei bis zum biblischen „Turm zu Babel“. Sind die Bauten von Landschaft umgeben, so bleibt die Natur bloße Kulisse, lediglich ein Kontrast zu den gefügten Steinen.
Doch nichts und niemand trumpft hier auf. Diese Bilder sind gleichsam defensiv, sie wirken wie nach innen gerichtet, in sich selbst versunken. Gerade deshalb üben sie allerdings eine stille, durchaus rätselhafte Anziehungskraft aus.
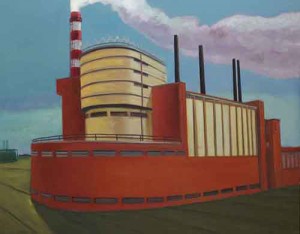
Walter Eislers Fabrikbild „Krasnaja Snamija“, 2009, Öl auf Leinwand (© Walter Eisler/Foto: Lars Wiedemann)
„Krasnaja Snamija“ heißt die kleine Schau, die das Hagener Osthaus-Museum Eisler jetzt in der oberen Galerie ausrichtet. Die russischen Worte bedeuten „Rotes Banner“ und beziehen sich auf eine Textilfabrik in St. Petersburg (seinerzeit Leningrad), die 1926 vom berühmten Architekten Erich Mendelsohn geplant wurde und die Eisler 2009 ins Bild gesetzt hat. Die am Bug charakteristisch gerundete, schräg zum Betrachter gestellte Elektrozentrale dieser Fabrik sieht aus wie ein gigantisches Dampfschiff. Auf einem anderen Bild schwimmt „Die Brauerei“ sogar vollends auf dem Wasser. Fremde, in Bewegung geratene Dingwelt.
In einer ähnlich diagonalen Ausrichtung stellt Eisler auch das – ebenfalls von Mendelsohn entworfene – Stuttgarter Kaufhaus Schocken (das 1960 in einem barbarischen Akt abgerissen wurde) keilförmig vor uns hin. Auch hier schiebt sich der grandios gerundete Gebäudeteil in den Vordergrund und eröffnet, als wär’s eine Entscheidung, die man vor dem Bild zu treffen hätte, zwei Wege – links und rechts am Baukörper vorbei. Rechts vor dem Scheideweg findet sich eine unscheinbare Absperrung mit Bausteinen, die freilich den ganzen Bildaufbau durchbricht. Ein seltsam irritierendes und somit bannendes Detail.
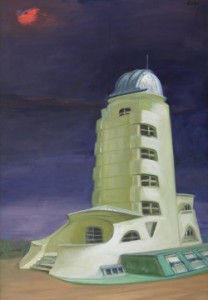
Gebäude in Potsdam: „Einsteinturm“, 2005, Öl auf Leinwand (© Walter Eisler/Foto: Lars Wiedemann)
Ein weiteres Gemälde, das sinnbildlich aufgeladen ist, greift eine Entscheidung, vor die der Betrachter gestellt sein könnte, auch noch im Titel auf: „Die Schaltwarte“ (2002) lässt eine verwirrende, nahezu labyrinthische Raumfolge ahnen, in der man sich schwerlich zurechtfinden kann.
Den monumentalen, im realistischen Duktus eines späten Nachfahren der Neuen Sachlichkeit gemalten Bauten wohnt also eine sonderbare Magie inne. Sie weisen offenkundig weit über ihre Architektur hinaus – aber wohin? Zwar liegt auf den ersten Blick die Gestaltung recht offen zutage, sie scheint sich aber bei näherem Hinsehen vor dem Betrachter zu verschließen, sich jeder raschen Deutung zu verweigern und hermetisch abzuriegeln. Es ist zuweilen, als habe der maskierte „Zauberer“ (2008) seine Hände in solch einem Spiel der Verwandlung.
Hat es mit der Herkunft des Malers zu tun? Walter Eisler wurde 1954 in Leipzig geboren. Er ein einer von zwei Söhnen des DDR-Malergranden Bernhard Heisig (1925-2011) und hat den Nachnamen der Mutter angenommen – wohl auch, um nicht namentlich im Schatten seines Vaters zu stehen, von dessen Stil er sich mittlerweile auch deutlich emanzipiert hat. Schon zu DDR-Zeiten dürfte freilich auch Eisler (und sein Bruder Johannes, gleichfalls Künstler) gelernt haben, Kunstwerke vieldeutig anzulegen und zu verrätseln. Diese Strategie, zu der es im SED-Staat kaum gangbare Alternativen gab, scheint bis heute Walter Eislers Bildsprache mitzuprägen.

Geheimnisvoller Hintergrund: „Infantin“, 2010, Öl auf Leinwand (© Walter Eisler/Foto: Lars Wiedemann)
Die rund 35 Bilder umfassende Werkgruppe, die jetzt in Hagen zu sehen ist, stammt jedoch aus den letzten zehn Jahren und ist noch von keinem Museum gezeigt worden. Insofern kann man von Entdeckungen sprechen. Einzig ein noch ganz anders geartetes Selbstporträt von 1986 markiert einen früheren Punkt auf der Strecke, die Eisler seither durchmessen hat.
Angesichts weniger menschlicher Figuren, die das neuere Oeuvre denn auch nur spärlich bevölkern, meint man die Präferenz für gemalte Architektur nachvollziehen zu können. Ein wenig unsicher, manchmal geradezu etwas ungelenk stellt Eisler leibliche Formen dar, vor allem Hände („Die Infantin“, 2010) wirken – sofern ausgeführt – bisweilen wie starre Fremdkörper oder werden gleich nur schemenhaft dargestellt.
Doch kleine Schwachstellen tun den subtilen Stimmungswerten, die in diesen Bildern aufgehoben sind, keinen Abbruch. Gewiss: Mal mag man sich an Giorgo de Chirico, mal an Edward Hopper erinnert fühlen – oder just an die Neue Sachlichkeit. Aber es ist denn doch etwas sehr Eigenes um Eislers Schaffen. In manch einem Bild kann man sich lang verlieren, um die Fährtensuche zu beginnen.
Walter Eisler: „Krasnaja Snamija“. Osthaus-Museum, Hagen (Museumsplatz 1 – Navigation: Hochstraße 73). 26. Juli bis 1. September. Geöffnet Di, Mi, Fr 10-17 Uhr, Do 13-20 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr. Eintritt 6 Euro, ermäßigt 2 Euro. Kein Katalog.
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013

Der Fotograf Anton Corbijn in der Bochumer Ausstellung – zwischen seinen Porträts von Ai Wei Wei (links) und Damien Hirst. (Foto: © Lutz Leitmann/Presseamt der Stadt Bochum)
Fotos der weltweiten Prominenz sehen oft genug wie Klischees oder gar wie leblose Charaktermasken aus, sie bestätigen vielfach das eh schon verfestigte Image. Nicht so bei Anton Corbijn.
Der mittlerweile 58jährige Niederländer, stets rastlos unterwegs, weil seine phänomenalen Fähigkeiten auf allen Kontinenten gefragt sind, bringt es zuwege, dass wir Gesichter von Popstars, berühmten Künstlern und sonstiger Prominenz (Spektrum von Mandela bis Kate Moss) auf einmal ganz anders und wie neu sehen. Ganz so, als kämen sie jetzt, in diesem Moment der Aufnahme und des Betrachtens, wahrhaft zu sich. Davon kann man sich bis zum 27. Juli in der Corbijn-Ausstellung des Kunstmuseums Bochum überzeugen, die mit über 40 großformatigen Bildern aufwartet.

Anton Corbijn: Porträt des Malers Lucian Freud (Fotografie, London 2008 – © Anton Corbijn)
All das (sozusagen selbstverständlich) in Schwarzweiß, festgehalten mit einer analogen Hasselblad-Kamera, nur mit vorhandenem Licht, ohne Stativ; also möglichst unverfälscht, so weit dies irgend möglich ist.
Dieser seriöse ältere Herr mit dem Schnauzbart, das ist also Paul McCartney, wie wir ihn wohl noch nie erblickt haben. Und der 1996 abgelichtete Mann in Frauenkleidern, der keineswegs lächerlich wirkt, heißt Mick Jagger. Melancholische Gesichtslandschaften erzählen vom wechselhaften Leben eines Johnny Cash, Tom Waits oder einer Patti Smith. Und schwingt nicht auch eine vitale Essenz ihrer Musik in diesen Bildern mit?
In einem Film über Corbijns Arbeit, der ebenfalls in dieser Ausstellung zu sehen ist, sagt Herbert Grönemeyer, so mancher Rockstar versuche hernach so zu werden, wie er auf Corbijns Bildern wirkt. Wenn es sich so verhält, dann kann man wohl von außerordentlicher Prägekraft reden. Vielleicht haben solche Fotos sogar indirekt Einfluss auf die Geschichte der populären Musik genommen.

Anton Corbijn: Porträt der britischen Singer-Songwriterin PJ Harvey („PJ Harvey – New Forest“ / © Anton Corbijn)
Dabei trumpft Corbijn, dessen Laufbahn einst mit eindrücklichen Bildern der düster umwölkten Gruppe „Joy Division“ begonnen hat, keineswegs willkürlich auf. Selbst heftigere Gestik wirkt auf seinen Bildern nicht exaltiert, sondern als notwendiger Ausdruck. Die bloße Pose lässt er schon gar nicht durchgehen, allenfalls greift er etwaige Versteckwünsche just spielerisch auf, so etwas bei Jeff Koons, der sich hinter einer etwas albernen Maske verbergen darf und daher umso kenntlicher zu werden scheint. Ähnliches gilt für den mindestens ebenso millionenschwer gehandelten Künstler Damien Hirst, der seinen weiß gepuderten Kopf gleichsam als Totenschädel herzeigt – ungefähr nach dem vielsagenden Motto „Nicht ohne mein Markenzeichen“. Gerhard Richters markanter Kopf ist derweil nur von hinten zu sehen – dies gemahnt an allerletzte Bilder in filmischen Nachrufen, wenn jemand buchstäblich von hinnen geht. Da hebt gewiss schon der Nachruhm an, den auch der (2011 verstorbene) Maler Lucian Freud in seinen nahezu jenseitigen Blick gefasst zu haben schien, als Corbijn ihn im Profil porträtierte.
Sehr diesseitig, frontal und kolossal schaut einen hingegen der chinesische Künstler und unbeugsame Dissident Ai Wei Wei an. Er scheint vor Physis und Widerstandskraft zu strotzen.
Gänzlich anders gelagerter Fall: Den inzwischen des Dopings überführten und aller großen Titel ledigen US-Radprofi Lance Armstrong zeigt Corbijn bereits anno 2004 im bis zum Halse stehenden Wasser, als würde der Sportler gleich ertrinken. Darf man hier von Vision sprechen? Hat Corbijn etwa vage Anzeichen eines Niedergangs vorausgesehen? Wer weiß.
Ganz offenkundig gelingt es Anton Corbijn jedenfalls immer wieder, während der Porträt-Treffen Atmosphären und Situationen zu schaffen, in denen vordergründige Zufälligkeiten abgestreift werden und etwas Wesentliches, Charakteristisches hervortritt, das eben auch in den Fotografien aufscheint. Auf diese Weise wirken nicht wenige Rock- und Kunststars wie Wahrzeichen ihrer selbst, gesehen im bezeichnenden, gültigen Augenblick. Fühlbar wird so etwas wie der essentielle „Stoff des Lebens“, der sich auf je ganz eigene Weise in Gesichter und Gesten eingezeichnet hat.
Nicht nur die Abgebildeten sehen aus, als wären sie nun ganz bei sich, auch der Fotograf bleibt in seiner speziellen Sehweise immerzu präsent. Es ist, als wäre alles auf einmal da, alles zugleich. So sehen große und haltbare Momente aus.
Anton Corbijn – Inwards and Onwards. Fotoportäts. Museum Bochum, Kortumstraße 147 (Tel.: 0234/910-42 30). Noch bis 28. Juli. Di-So 10-17, Mi 10-20 Uhr. Katalogheft 12,50 Euro.
(Ebenfalls jetzt im Bochumer Museum: die Ausstellung des aus Israel stammenden Micha Laury).
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
Es ist, als würden alle Räume neu vermessen, alle Körper und Gegenstände von Grund auf neu erkundet, noch einmal erfunden, anders zusammengesetzt. Ein zweiter Schöpfungsakt aus dem Geiste und mit den Kräften der Kunst.

Micha Laury: „Holding my Brain“ (1969). (© Micha Laury/Museum Bochum)
Der aus Israel stammende, seit 1976 in Paris lebende Künstler Micha Laury, vereint in seinem Werk unvordenkliche Uranfänge mit weit ausgreifender Zukunftsschau. Bochums Museumdirektor Hans Günter Golinski, dessen Haus Micha Laury nun die erste deutsche Einzelausstellung ausrichtet, fühlt sich dabei gelegentlich gar an die Universalgelehrten der Renaissance erinnert, etwa an Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer. Doch es gibt natürlich auch ästhetische Anknüpfungsstränge in der neueren Kunst, so bei Duchamp, Beuys oder Jasper Johns.
Unter der Enge im Kibbuz gelitten
Laury (Jahrgang 1946) ist in einem Kibbuz aufgewachsen, in denkbar elementaren, einfachen und notgedrungen ärmlichen Verhältnissen, auch in einer gewissen Enge. Der junge Mann verlangte mehr vom Leben und ahnte, dass Kunst Auswege eröffnen könnte. Er durfte eine Kunstschule besuchen. Doch man ließ ihn dort wochenlang biedere Blumenvasen abmalen, also rebellierte er – und wurde hinausgeworfen.
„Fuck the art“ nennt er 1967 ein zorniges, doch auch mit Ironie getränktes Bild, auf dem die Finger ziemlich unsanft durchs Halteloch der (wohl überflüssigen) Palette stoßen. Das bloße Abbild muss überwunden werden, die Dinge muss man aus ihren gewohnten Zusammenhängen heraus reißen, damit man sie neu denken kann. Ein umfassender Ansatz.

Micha Laury: „Fuck the Art“ (Study for Plaster Cast), 1967. (© Micha Laury/Museum Bochum)
Sein erstes Atelier hatte Laury in einem unterirdischen Bunker – eine Zelle, die ihn ganz auf sich selbst und die wenigen Gegenstände aus der unmittelbaren Umgebung verwiesen hat. Käfig- und Gefängnisbilder scheinen das Trauma immer wieder zu umkreisen. Und so wirken seine frühen Arbeiten (bezeichnender Titel „Ich weiß nicht, was ich tun soll“) zuweilen ausgesprochen klaustrophobisch, selbstbezüglich, ja beinahe autistisch.
Wenn der Mund am Finger saugt
Da werden mit zahlreichen Studien etwa Zunge, Finger und Ohren jeweils für sich in ihren grundlegenden Funktionen bildnerisch erforscht. Was geschieht genau, wenn ein Finger sich in den Mund senkt und daran gesaugt wird? Wie ist es, wenn eine Zunge von innen an die Wange stößt? Und weiter, schon (wie etliche andere Motive) schmerzlich an Gewalt und Folter gemahnend: Wie sieht es aus, wenn ein Kopf vor die Wand schlägt? Was wird aus Armen und Beinen, wenn sie sich verselbständigen oder zu Prothesen werden? Makaber auch eine Kochanleitung, bei der Spiegelei und Hirn zusammen in einer Pfanne schmoren. Dieser Künstler erspart sich und dem Betrachter nichts. Er führt eine Art Tagebuch, das ihn immer weiter und weiter ins Unbekannte geleitet; auch ins abgründig Böse.

Micha Laury: „Two Figures (Sandwich)“. (© Micha Laury/Museum Bochum)
Apropos Hirn. Schon sehr bald, auf einer Zeichnung von 1970, deutet sich diese bleibende Passion an. Da halten zwei Hände eine rohe Gehirnmasse. Auf anderen Bildern sieht man Gehirnströme, die sich aus den Köpfen nach draußen ergießen oder Wolken, die gleichsam ausgehaucht werden. Der als Fallschirmspringer im Krieg schwer am Kopf verletzte Laury ist bis heute geradezu besessen vom Hirnthema, das er freilich im Lauf der Zeit aus der Leidensdarstellung herausgeführt und im schier unstillbaren Erkenntnisdrang produktiv gewendet hat. Zunehmend hat er sich in den letzten Jahren mit weltweit führenden Hirn- und Zukunftsforschern vernetzt. Gemeinsame Langzeit-Projekte und Symposien sind auf dem Weg.
Botschaft der Todesangst
Für eine Serie von Anti-Heldenbildern wollte Laury einen Freund dazu bewegen, mit einer Militärmaschine Botschaften von Todesangst an den Himmel zu schreiben. Der Luftwaffenkommandant hatte etwas dagegen. So blieb es bei Zeichnungen, die den ungeheuerlichen Vorgang imaginieren. Die Draufsicht-Perspektive des Fallschirmspringers erzeugt übrigens ein ums andere Mal „abstrakte“ Formen. Auch auf solche Weise können sich Bildmuster verwandeln.

Micha Laury: „Shadow“ (1969). (© Micha Laury/Museum Bochum)
Laury befasst sich mit Skulptur, Objekten, Installation und Performance, er untersucht also Räume und deren Koordinaten. Bochum hat sich für die vergleichsweise zurückgenommenen Arbeiten auf Papier entschieden. Es ist mithin eine intimere, nahezu kammermusikalische Ausstellung geworden, deren rund 120 Blättern vielfach etwas Unvollendetes, Skizzenhaftes eigen ist. Zeichnungen sind bekanntlich näher an der ursprünglichen Idee, erst recht gilt dies für Laurys Expeditionen in die Terra incognita.
Jenseits des heutigen Menschenbildes
Die Ausstellung endet mit Zukunftsvisionen. Laury sieht eine völlig beispiellose Ära der posthumanen Wesen heraufdämmern, die die Begrenzungen des menschlichen Leibes und des bisherigen Intellekts bei weitem überschreiten werden. Er führt uns Elemente und Erscheinungsformen dieser Transformation vor Augen. Da tun sich überall ungeahnte Kraftfelder auf, es herrscht ein allseits frei fluktuierender Austausch zwischen Hirnen und Maschinen, Telekinese und Teleportation sind selbstverständlich.
Solche Zustände seien schon in dreißig bis fünfzig Jahren zu erwarten, sagt Laury. Moralfragen stellt er zunächst einmal nicht. „Wir haben ohnehin keine Wahl. Das alles wird kommen.“ Und das allerletzte Bild? Es zeigt, wie unendliche Schwärze das ganze Universum aufsaugt….
Micha Laury: „Human Mind Body Space“. Arbeiten auf Papier. Kunstmuseum Bochum, Kortumstraße 147. Vom 29 Juni bis zum 11. August. Geöffnet Di-So 10-17 Uhr, Mi 10-20 Uhr. Katalog 25 Euro.
P.S.: Während der Ausstellungseröffnung (29. Juni, 17 Uhr) wird ein Freundschaftsvertrag des Bochumer Museums mit dem israelischen Museum of Art in Ein Harod unterzeichnet, einem bereits 1938 begründeten Außenposten der internationalen Kunstszene. Bochums Museumleiter Hans Günter Golinski findet es derweil höchst bedenklich und fatal, dass in Europa manche Kräfte aus politischen Gründen auf einen Boykott israelischer Kunst dringen…
Über das Museum in Ein Harod kam auch der Kontakt zu Micha Laury zustande. Bei dieser Ausstellung kooperiert Bochum außerdem mit den Museen in St. Etienne (Frankreich) und Goch (Niederrhein).
P.P.S.: Im Bochumer Museum ist derzeit (bis 28. Juli) ebenfalls eine Schau des – vor allem durch Porträts von Rockgrößen – berühmten Fotografen Anton Corbijn zu sehen. Dazu demnächst noch ein paar Worte an dieser Stelle.
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
Ja, sicher, den Sommer mit blauem Himmel mag Hermann Buß irgendwie auch. Doch so etwas malt er nicht.
Er fühlt sich seelisch entschieden heimischer beim Anblick des grau verhangenen Himmels und des grau schimmernden Meeres. Dort draußen in den Übergangszonen, wo manchmal gar nicht mehr auszumachen ist, ob man sich nun noch zu Lande oder schon halbwegs zu Wasser befindet.

Hermann Buß: „Zwischenstation II“ (2007), Öl auf Leinwand. (© für alle Bilder: Katalog/Hermann Buß)
Weit draußen also, auf den Vorposten entlang der Küstenlinie, wo die Menschen sehr einsam und auf sich gestellt wirken, wo sie klein werden, an den Rand rücken und vielleicht überhaupt nur noch Beiwerk am Saum des Nichtseins sind. Wo man den Boden unter den Füßen zu verlieren droht. Wo es einem vorkommt, als werde alles Feste flüssig, als gerate alles ins Schwanken, als sei dies der Durchgang in eine andere Daseinsform. Womöglich gleicht dies gar einem Grenzgang zwischen Leben und Tod.

Hermann Buß: „Spiegelung“ (2004), Öl auf Leinwand. (Bild: Katalog)
Die Bilder tragen Titel wie „Überfahrt“ oder „Land’s End“. Ja, tatsächlich. Nicht wenige Bilder von Hermann Buß, dem jetzt im Haus Opherdicke die sehenswerte Ausstellung „ZwischenWelten“ ausgerichtet wird, ragen in eine quasi-religiöse Dimension hinein. Häufig bekam er kirchliche Aufträge zur Altar- oder Kapellengestaltung, so etwa auf der Insel Langeoog oder im Kloster Loccum. Doch statt Weihrauch riecht man auch auf solchen Bildern vor allem Seeluft. Da bringt einer die rauhe Außenwelt mitten hinein in die Kirche. Zu derlei Aspekten hat Alfred Buß, ehemaliger Präses der Evangelischen Kirche in Westfalen, einen Aufsatz im Katalog beigesteuert. Er kommt zwar aus der gleichen Region, ist aber nicht verwandt oder verschwägert mit Hermann Buß.

Hermann Buß: „Land’s End“ (2008), Öl auf Leinwand. (Bild: Katalog)
Müsste man anhand der Bilder blindlings erraten, woher der Künstler stammt, so könnte man rasch auf die Spur kommen. Er wurde 1951 in Neermoor-Kolonie bei Leer (Ostfriesland) geboren. Sein Vater war Schiffseigner. Der Sohn fuhr schon sehr früh zur See und mochte sich lange nicht endgültig zwischen Seefahrt und Kunst entscheiden. Doch mit den Jahren wurde ihm klar, wie überaus entbehrungsreich und unsicher das Leben der Matrosen ist.
Der Mann, der nicht allzu viele Worte macht, kennt sich in jeder Hinsicht aus, wenn er Meeresszenen malt. Das schützt ihn vor romantischer Verklärung. Eine Serie lässt zwar ahnen, wie hart die Arbeit der Küstenschützer ist. Doch es ist, wie es ist. Da wird nichts künstlich überhöht oder ungebührlich gesteigert. Allerdings reizt den Künstler Alfred Buß – bei allem Detail-Realismus der Darstellung – nicht selten das Ungewisse, das Unergründliche, das zuweilen Surreale und fast Gespenstische.

Hermann Buß: „Stiller Hafen“ (2011), Öl auf Leinwand. (Bild: Katalog)
Es ist gar nicht verwunderlich, dass Buß mit seiner Familie im ostfriesischen Städtchen Norden in einem abgelegenen, ehemaligen Robbenfänger-Haus gleich hinterm Deich wohnt – umtost von Wind, umgeben von Schafen, „zurückgezogen, aber weltbezogen“, wie er es nennt. Da kann es schon einmal geschehen, dass die Landschaftsstimmung das Gemüt beschwert. Wenn man etwa das winterliche „Schwarze Eis“ sieht, das durch den Schlick verdunkelt ist, wird einem wohl etwas betrüblich zumute.
Buß hat auch ein Bild der massenhaft von Touristen bestürmten Meyer Werft zu Papenburg gemalt, wo gerade mal wieder ein neuer Schiffskoloss vom Stapel gelaufen ist. Es ist dies eine Art Gegen-Bild. So will er das Meer nicht erobert wissen. Man kann sich lebhaft vorstellen, dass Buß etwa Offshore-Windkraftanlagen verabscheut, sie verstellen jedenfalls keinen seiner weiten Horizonte.

Hermann Buß: „Seereise“ (2008), Öl auf Leinwand. (Bild: Katalog)
Wenn er hingegen zersplitterte, zerfaserte Überreste von längst aufgegebenen Holzbooten malt, so spürt man, dass sie in Würde verfallen, wie denn überhaupt das allmähliche Vergehen ein Hauptthema vieler dieser Bilder ist. Möge niemand daran rühren. Das Bild, das „Traumschiff“ heißt, zeigt selbstverständlich keinen luxuriösen Partydampfer, sondern ein älteres Schiff, das gleichsam still vor sich hin träumt.
Kunst ist ihm eine sehr ernste Angelegenheit, ja mitunter auch eine Qual. „Ich arbeite mich beim Malen ab“, sagt der angenehm zurückhaltende Hermann Buß. Die herbe Schönheit, die ihm zusagt und aus der er schöpft, findet er nicht im Süden, sondern eben in Ostfriesland, in Flandern, in der Bretagne und in Irland. Ist eines der ausgesprochen sorgfältig gemalten Ölbilder vollendet, dann ist es – wie er sagt – „mir selbst ein Rätsel. Dann sehe ich es aus einer Distanz, so wie jeder andere Betrachter…“

Hermann Buß: „Zwei Wasser II“ (2008), Öl auf Leinwand. (Bild: Katalog)
Fühlt sich da jemand an Edward Hoppers Melancholie erinnert? Oder an die Haltung der Figuren von Caspar David Friedrich zur Natur? Drängt sich da ein Wort wie „meditativ“ auf? Ja, warum nicht? Aber diese Bilder wollen auch für sich gesehen und nicht nur an anderen gemessen werden.
Für die denn doch etwas begrenzten Hängungsmöglichkeiten im Haus Opherdicke sind die rund 70 Gemälde von Hermann Buß hinreichend oder auch reichlich großformatig, hie und da würde man sich ringsum mehr Leeräume, mehr „Atem“ wünschen. An manchen Stellen der Schau kann man (raumbedingt) gar nicht sinnend vom Bild zurücktreten, sondern muss dicht davor verharren. Nicht nur in solcher Nahsicht übt so manches Meeresbild einen kaum widerstehlichen Sog aus. Man kann sich imaginär hinaustreiben lassen. Wer weiß, wohin.
Hermann Buß – „ZwischenWelten“. Haus Opherdicke (Holzwickede, Dorfstraße 29). Vom 30. Juni (Eröffnung um 11.30 Uhr) bis zum 13. Oktober, Öffnungszeiten Di-So 10.30-17.30 Uhr. Eintritt 4 Euro. Katalog 22 Euro.
geschrieben von Rudi Bernhardt | 6. September 2013

Kleine Menschen vor einem gewaltigen Kunstwerk.
Ich nahm Maß, nahm alle meine beschränkten Begabungsressourcen beisammen (so viele habe ich bei der Gabe des Fotografierens nicht) und nahm einen veritablen Keith Haring auf – in die Serie meiner Aufnahmen, die ich nach einem Besuch in Pisa heim brachte.
Und in diesem Moment nahm ich wieder einmal an, was mir vor vielen Jahren mein ehrlich bewunderter Lehrer Ewald Linka nahe brachte: die Gedanken von Walter Benjamin zum Thema „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“. In unregelmäßigen Abständen werden diese in meinen persönlichen Gedanken immer wieder mal sehr handfest und regelrecht erspürbar. Denn die Aura, über die Benjamin schrieb, sie umgibt nur wenige Werke, denen ich in meinem bisherigen Leben begegnete.
„Tutto Mondo“ heißt das gewaltige Mauerbild, das überwältigend bunt und ebenso überwältigend detailreich die Giebelwand eines Wohnhauses im Schatten der „Chiesa di Sant‘ Antonio Abate“ in Pisa bedeckt. 1989 wurde dieses Kunstwerk in monatelanger Arbeit geschaffen. Keith Haring, dessen furioses Leben schon am 16. Februar 1990 enden sollte, dirigierte, inspirierte und koordinierte. Eine wachsende Zahl von Studentinnen und Studenten halfen dem stets freundlichen Meister. Viele von ihnen nächtigten nach ermüdender Tagesarbeit in der benachbarten Kirche. Von dort kam auch ein großer Teil des Caterings. Das klassische Pisa traf offen wie so häufig in seiner Geschichte auf eine neue Zeit – die Piazza dei Miracoli mit Dom und Schiefem Turm an dem meistbesuchten Punkt und Popart am entgegengesetzten Punkt der Innenstadt.
Ein junger Pisaner Student hatte kurz zuvor in New York einen Haring bestaunt und den ihm unbekannten Herrn neben ihm seine uneingeschränkte Bewunderung ausgedrückt. Es kam beim Richtigen an, denn der Herr war Haring in persona. Alsbald heckten der junge Pisaner und der schillernde Metropolenkünstler den Plan zu „Tutto Mondo“ aus. Und sie setzten ihn auch um, schnell und ungeduldig. Haring wusste längst um das enge Maß der Zeit, die ihm noch bleiben sollte. Pisas Behörden zeigten sich speditiv und kaum bürokratisch, was in Italien entgegen aller Vorurteile keineswegs normal ist. Pisas Bürger waren wie immer gastfreundlich und hilfsbereit. Und so gelang in einem wunderbaren Zusammenspiel aller Beteiligter Keith Harings letztes öffentliches Kunstwerk in einer Stadt, die eigenwillig solitär ist: uralt, hochmodern, tiefgläubig, tolerant-weltoffen, pisanisch eben.

Damit auch jedermensch weiß, dass hier alles authetisch ist, spendierte die Kommune ein Hinweisschild.
Und so stolz die Pisaner auf ihre ruhmreiche Geschichte sind, so ebenbürtig bis überlegen sie sich Florentinern, Luccesern oder auch den weiter entfernten Römern fühlen, so stolz sind sie auch auf dieses einmalige Kunstwerk, das nicht nur in seinem unverwechselbaren Duktus ein veritabler Keith Haring ist, sondern auch seine ganz persönliche Botschaft offenbart: Mitten im oberen Bereich des Wandbildes zerschneidet eine riesige grüne Schere eine knallrote Schlange – und zuversichtlich kringelt sich aus den beiden Hälften des Tieres je eine der weltweit bekannten AIDS-Schleifen.
Der letzte öffentliche Haring prägt längst das Stadtbild, er stieg empor auf der endlosen Route der vielfältigen Stadtkultur, ist Sinnbild eines ebenso intellektuellen wie proletarischen Kondensationskernes in Italien: tolerant, weltoffen und unerschütterlich selbstbewusst. Diese freundliche Eigenschaft bekam einst auch Silvio Berlusconi zu spüren, als er – noch Staatsoberhaupt – in einem vornehmen und kulinarisch wertvollen Pisaner Restaurant mit seiner Entourage speisen wollte. „Wir bedauern, aber alle Plätze sind schon besetzt, riservato!“ So scholl es dem sprachlos dreinschauenden Möchtegern-Cäsar entgegen. Als der verdattert darauf hinwies, dass doch so viele Plätze frei seien, gab es die ultimative Antwort: „Scusi, aber die sind reserviert für Neger und andere!“ Wortlos verließ Berlusconi das Lokal, eilte über die Stadtgrenzen Pisas und sodann noch flotter hinaus aus der Toscana. Ab nach Rom.
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
Immer `ran, gleich` ran: Wenn Weegee ein starkes Bildmotiv sieht, so hält ihn nichts mehr auf Distanz.
Dann rückt der Pressefotograf den Mördern, Opfern, Cops und Underdogs im New York der 1930er und 1940er Jahre ganz dicht auf den Leib und drückt sofort ab. Menschen, deren Behausung gerade in Feuersbrünsten niederbrennt, hält er die Kamera mitten in die entsetzten Gesichter.

Weegee: „Der Erkennungsdienst bei der Arbeit“, 1941 (© Weegee/Institut für Kulturaustausch, Tübingen 2013)
Seit 1935 als Freelancer tätig, kann sich der Autodidakt keine Sentimentalitäten erlauben. Er muss die besten, unmittelbarsten Bilder haben, sonst würden die sensationsgierigen Zeitungen sie nicht kaufen. „Murder is my business“, sagt Weegee einmal.
Die heute noch hinreißenden Ergebnisse seiner Arbeit sind jetzt in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen zu sehen. Die Dokumente werden längst als Kunstwerke wahrgenommen. Es liegt nicht am bloßen Verstreichen der Zeit und an der generellen musealen Aufwertung der Fotografie, sondern an wahrhaftigen Qualitäten dieser Schwarzweiß-Bilder. Die rund 100 Exponate stammen aus dem Fundus des Instituts für Kulturaustausch in Tübingen, aus dem Christine Vogt und ihr Oberhausener Team eine schlüssige Auswahl zusammengestellt haben. Übrigens gab’s im Ruhrgebiet noch nie eine Weegee-Schau.

Delinquenten verbergen ihre Gesichter: Charles Sodokoff und Arthur Webber, 1942 (© Weegee/Institut für Kulturaustausch, Tübingen 2013)
Weegees Art zu fotografieren (buchstäblich Bilder zu „schießen“) glich einem gewaltsamen Akt. Und so wirken die Aufnahmen denn auch auf den ersten Blick. Vom krassen Blitzlicht hart und grell konturiert, unerbittlich realistisch. Doch man weiß, dass Weegee zuweilen manch ein Detail eigenhändig arrangiert hat (so stellte er etwa nach einem Mord beim Bocciaspiel die Bocciakugeln „dekorativ“ in den Vordergrund), dass er Ausschnitte mit Bedacht wählte. Auch hat er Verbrechensopfer nicht in aller möglichen Drastik gezeigt, sondern ihnen einen Rest von geradezu ästhetischer Aura gelassen. In Wien würde man vielleicht sarkastisch sagen „A schöne Leich’“.
Vor allem aber hatte Weegee – mitten im heißesten Moment – ein untrügliches Gespür für wirksame Komposition und Dynamik. Wer heute versucht, den Augenblick mit schier endlosen Reihen von Digitalbildern zu fangen (Motto: Ein Gutes wird schon darunter sein), macht sich keinen Begriff davon. Damals, in der Zeit der Plattenkameras, mussten gleich die allerersten Bilder „sitzen“. Umso erstaunlicher, dass viele inzwischen den Status von Klassikern haben. So auch jenes umwerfende Bild von der gaffenden Menge, die uns auch auf unseren eigenen Voyeurismus verweist. Wir schauen Zuschauern beim Zuschauen zu, ganz fasziniert.
Oft war Weegee (1899-1968, bürgerlich Arthur Fellig) früher am Tatort als die Polizei selbst. Ab 1938 mit der offiziellen Genehmigung versehen, den Polizeifunk abhören zu dürfen, raste der besessene Nachtarbeiter sofort los, um gleichsam auf frischer Tat zugegen zu sein. Was er dann auf Platte bannte, wäre heute und zumal in Europa so nicht mehr publizierbar. Aber damals herrschten andere Gesetze. Und in den USA geht es ohnehin anders her.

Polizei beendet Straßendusche der Kinder, 1944 (© Weegee/Institut für Kulturaustausch, Tübingen 2013)
Schnell wurde der im heute polnischen Złoczew geborene Fotograf, der 1910 als Kind in die USA gekommen war, bekannt und kultivierte ein entsprechendes Image, nannte sich höchst selbstbewusst „Weegee – The Famous“ und zeigte sich gern als zerknautschter harter Kerl, allzeit mit Zigarre im Mundwinkel. Als Zeitgeist-Typus der Hardboiled-Ära hätte er jederzeit in einem Marlowe-Roman von Philip Chandler auftauchen können (wenn die nicht in Los Angeles spielen würden).
Eines seiner Fotos zeigt das unglaublich überfüllte Badeufer von Coney Island. Die vielen, vielen Menschen schauen hinauf zur Kamera, Weegee steht offenbar auf einem Podest inmitten der Massen. Er ist das Gegenteil eines „unsichtbaren“ Fotografen, der heimlich auf Motive lauert. Weegee wirft sich geradezu hinein in die Situation oder stellt sich beherrschend über sie. Dass er auch subtile, ja ätherische optische Sensationen zu erfassen weiß, zeigen seine Bilder von Stadtstrukturen, etwa vom mysteriösen Schattenwurf unter der Hochbahn.

Unter der Hochbahn, Bowery, o. J. (© Weegee/Institut für Kulturaustausch, Tübingen 2013)
Manche haben versucht, Teile seines Werks sozialkritisch zu interpretieren. Tatsächlich hat er ja die Schattenseiten der Gesellschaft gezeigt, hat Huren, Stripperinnen, Verbrecher, Säufer, Obdachlose oder auch die diskriminierten Farbigen in Harlem abgelichtet, doch wohl weniger aus edelmütigen politischen Antrieben. Er hat sich just in die harte Wirklichkeit begeben und dort Anzeichen sozialer Tatsachen vorgefunden, sofern man sie überhaupt sichtbar machen kann. Bei einem Fotografen mit dieser formalen Könnerschaft werden eben gültige Szenen daraus. Die Verhältnisse, sie waren so.

Ostersonntag in Harlem, 1940 (© Weegee/Institut für Kulturaustausch, Tübingen 2013)
So auch bei einem seiner berühmtesten Bilder, das zwei schwerstreiche Damen beim Gang in die Oper zeigt und die Aussage noch mit einem Trick steigert: Eine völlig desolat wirkende „Kritikerin“, die als Kontrastfigur auftritt, soll Weegee eigens angeheuert und unter Alkohol gesetzt haben. So obszön wirkte demgegenüber der zur Schau gestellte Reichtum, dass die Nazis das Bild zu perfiden Propagandazwecken nutzen und auf in Italien abgeworfenen Flugblättern die US-Soldaten hinterhältig fragten: „GI’s, is this what you’re fighting for?“ – „Dafür wollt ihr kämpfen?“

„Kritik“, 1943 (© Weegee/Institut für Kulturaustausch, Tübingen 2013)
Einmal prominent und wohlhabend, ließ es Weegee bequemer angehen. Er unternahm Europa-Reisen, verlegte sich vor allem auf Star-Fotografie und porträtierte etwa Louis Armstrong, Marilyn Monroe, Salvador Dali, Jackie Kennedy oder auch das verzückte weibliche Publikum des Frank Sinatra. Man wähnt sich hier beinahe schon in einem Konzert der Beatles mit hysterischem Kreischen und massenhaften Mädchen-Ohnmachten.
Auch Weegees Selbstinszenierungen weisen ja schon gelegentlich voraus auf Phänomene der 60er Jahre. Nicht ausgeschlossen, dass ein Mann wie Cassius Clay alias Muhammad Ali („I am the greatest“) einige seiner Imponier-Posen von einem wie ihm gelernt hat. Bei beiden, so wissen wir, steckte wirkliche Substanz hinter dem Gehabe. Und wie!
Sollte Weegee gar ein Vorvater der Pop Art gewesen sein? Ein Bild, auf dem er sich mit Andy Warhol zeigt, könnte die Vermutung nahelegen. Doch wie verschieden sind diese beiden Typen! Ein jeder steht für seine Zeit.
Weegee – The Famous. Fotografie. Bis 8. September 2013 in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, Konrad-Adenauer-Allee 46. Geöffnet Di-So 11-18 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 6,50 €, ermäßigt 3,50 €.
Kombiticket mit Gasometer Oberhausen (dort ist bis Ende Dezember die Christo-Installation „Big Air Package“ zu sehen) 13 €.
Statt eines Katalogs erscheint ein Booklet für 4 €.
Wenn’s etwas mehr sein darf, so greife man zu Weegees erstmals 1945 erschienenem Buch „Naked City“.
geschrieben von Günter Landsberger | 6. September 2013
Was haben Ralph Dutli und Theodor Fontane miteinander gemeinsam?
Sie haben beide mit 58 / 59 Jahren ihren ersten Roman veröffentlicht.
Bei Fontane wissen wir, dass auf seinen umfangreichen Erstling „Vor dem Sturm“ noch viele gute, meist kürzere Romane gefolgt sind, bis hin zu seinem späten, wieder etwas umfangreicheren Meisterwerk „Der Stechlin“; bei Dutli wissen wir vorerst nur, dass ihm sein Erstling wirklich gut gelungen ist und dass wir vielleicht noch auf weitere Roman-Überraschungen von ihm gefasst sein dürfen.
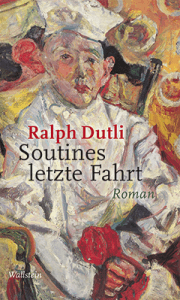
Ralph Dutlis 272 Seiten umfassender Roman „Soutines letzte Fahrt“ scheint sich vom Thema her vorrangig in die gerade auch aus der deutschen Literaturgeschichte her bekannte Gattung „Künstlerroman“ einzureihen.
Denkt man kurz nach, fallen einem auch durchaus einige deutschsprachige Künstlerromane ein, in denen Maler, überhaupt bildende Künstler, mehr oder weniger zu Hauptfiguren bestimmter Romane auserkoren worden sind: „Franz Sternbalds Wanderungen“ (Ludwig Tieck), „Maler Nolten“ (Eduard Mörike), „Goya oder der arge Weg der Erkenntnis“ (Lion Feuchtwanger), „Der Judas des Leonardo“ (Leo Perutz), „Deutschstunde“ (Siegfried Lenz) usf.; auch Erzählungen wie „El Greco malt den Großinquisitor“ (Stefan Andres) und „Barlach in Güstrow“ (Franz Fühmann) sollten nicht unerwähnt bleiben.
Dennoch: Romane von Rang, in denen weltberühmte Maler porträtiert werden, sind ziemlich selten, und wenn es auch Romane über Rembrandt, van Gogh, Michelangelo, Grünewald u.s.w. durchaus gibt, wird man solche nur ganz selten unter den Hauptwerken der Literaturgeschichte finden. So mag es weise gewesen sein, dass Albrecht Dürer bei Tieck und Leonardo da Vinci bei Perutz nur am Rande oder im Hintergrund auftauchen oder aber auf bekannte, allzubekannte Namhaftigkeit auch außerhalb des Romans (vgl. „Maler Nolten“) gleich ganz verzichtet wird.
Ralph Dutli wählt sich für seinen biographisch fundierten Roman einen Maler aus wie Chaim Soutine, der im öffentlichen Bewusstsein vom Bekanntheitsgrad her bei weitem nicht so verankert ist wie etwa Pablo Picasso oder auch Marc Chagall, die übrigens in Dutlis Roman durchaus nicht unerwähnt bleiben und von denen Marc Chagall sogar gelegentlich als Kontrastfigur zu Chaim Soutine dient. Dass Ralph Dutli nun anders als im Falle Ossip Mandelstams keine Biographie schreibt, sondern gleich einen Roman, scheint mir im Fall von Chaim Soutine durchaus angebracht und vermag vor allem im Ergebnis voll zu überzeugen.
Wir begleiten Chaim Soutine für die Zeit vom 6. August 1943 bis zu seinem Tod am 9. August 1943 auf seiner letzten Fahrt von einem Krankenhaus in Chinon zu einem in Paris, zu dem er langwierig und vorsichtig auf Schleichwegen in einem Krankentransportgefährt, das sich als Leichenwagen tarnt, schließlich gebracht wird. Ob diese Fahrt nun genauso stattgefunden hat oder auch nicht, ist nicht sicher verbürgt (wodurch Raum für behutsam und einfühlsam Fiktives entsteht), wohl aber, dass dieser umständliche Transport von Chinon nach Paris mit dem baldigen Tod des Malers geendet hat, da die erhoffte Operation in Paris keine Lebensrettung mehr bringen konnte.
Im Roman nun begegnen wir, auf der Folie seiner von seiner Lebensgefährtin Marie-Berthe Aurenche begleiteten letzten Fahrt, Kapitel für Kapitel (auf so kunstvoll wie plausibel verschlungene Weise) bestimmten früheren Lebenssituationen des ursprünglich aus einem Schtetl bei Minsk herstammenden Malers. Dabei entsteht ein sehr dichtes Bild; ein lebendiges Porträt dieses Malers und seiner Eigenart und seiner Stellung unter den Menschen und ein Bild von der oft recht verworrenen, nicht nur für diesen jüdischen Maler gefährlichen Zeitsituation.
Das rege Interesse an dieser Lektüre ist bei mir nie erlahmt, aber erst mit dem äußerst feinfühligen, ein indirektes, zeitlich versetztes Zwiegespräch zweier einander auch unausgesprochen Liebender montierenden 14. Kapitel („Mademoiselle Garde und das nichtige Glück“, ein Kapitel, das man indes nicht isoliert, sondern im Zusammenhang des Ganzen lesen sollte) habe ich den Roman zu lieben begonnen.
Es steht zu hoffen, dass der Roman Ralph Dutlis den Blick auf die geretteten Bilder Chaim Soutines neu zu beleben vermag bzw. allererst eröffnet.
Ralph Dutli: „Soutines letzte Fahrt“. Roman, Wallstein Verlag Göttingen 2013, 272 Seiten, 19,90 Euro.
geschrieben von Hans Hermann Pöpsel | 6. September 2013
In seiner Heimatstadt Leverkusen haben sie nicht nur ein Bronzeschild zu seinem Gedächtnis angebracht, nein, sogar eine Straße wurde im Jahre 2001 nach ihm benannt: Wolf Vostell, weltbekannter Künstler und auch Professor, 1931 in Leverkusen geboren und 1998 in Berlin gestorben, ist im Dortmundern Museum mit einigen hervorragenden Werken vertreten, und allein das scheint mir ein ausreichender Grund zu sein, mal wieder ins „U“ zu pilgern.

Straße in Vostells Geburtsstadt Leverkusen.
Ein Hauptthema im „Museum Ostwall im Dortmunder U“ sind Fluxus und Happening – Kunstbewegungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die unter anderem von Wolf Vostell vorangetrieben worden sind. Nach einer Verbindung von Kunst und Leben suchte man, „fördert die Nicht-Kunst-Realität“ hieß es sogar in einem Manifest von George Maciunas. Es entstanden also nicht nur Kunstobjekte, sondern vor allem Aktionskunst war gefragt.
Vostell wollte vor allem durch „aggressive Bildsprache“, wie es im Katalog heißt, Missstände benennen und Sozialkritik üben. Am beeindruckendsten scheint mir aber sein Rückgriff auf die Zeitgeschichte zu sein – nämlich in der Dortmunder Rauminstallation „Thermoelektrischer Kaugummi“. Die Installation mit dem seltsamen Titel assoziiert im Kopf sofort die Verbindung zu Bildern von Auschwitz, und wenn man über die am Boden verstreuten Esslöffel knirschend den Raum durchschreitet, kann es einem schon eiskalt über den Rücken laufen.
„So stellt Vostell die Frage nach der Verantwortung jedes Einzelnen für Tod und Leid“, schreiben die Museumsleute. Gerade in der Stadt Dortmund mit seinen aktuellen Naziaufmärschen sollte die Beschäftigung mit dieser Frage besonders wichtig sein.
geschrieben von Eva Schmidt | 6. September 2013

Andreas Rossmann, Foto: Anna Wolfinger
Sein Revier beginnt hinter der Ruhrtalbrücke, von auswärts mit dem Auto kommend. Hier fährt der NRW-Feuilletonkorrespondent in einen wichtigen Sektor seines Berichtsgebiets ein. Kunst und Kultur dieser Region sind Gegenstand seiner Reportagen und Rezensionen, die er seit über 20 Jahren für die FAZ verfasst. Nun hat Andreas Rossmann eine Auswahl davon unter dem Titel „Der Rauch verbindet die Städte nicht mehr“ als Buch im Verlag der Buchhandlung Walther König herausgebracht.
Der „Reiseführer fürs Handschuhfach“ ist illustriert mit Schwarzweiß-Fotografien aus dem Archiv von Barbara Klemm, entstanden zwischen 1974 und 1999, die dem Paperback einen eigenwilligen Retro-Charme verleihen. Gegliedert ist der Band nach Städten von B wie Bochum bis W wie Waltrop. Selbst versierte Ruhrgebietsbewohner können beim Nachbarn noch Neues entdecken.
„Der Rauch verbindet die Städte“ schrieb Joseph Roth 1926, doch seit er sich zum großen Teil in frische Luft aufgelöst hat, wo ist da das verbindende Element dieser zerklüfteten, postindustriellen und mit zahlreichen Kulturinstitutionen besiedelten Region? Was macht sie aus und wo scheitert sie? Mit großer Sympathie für ihre rauen Seiten und einem Scharfblick, der sich nicht scheut, zwischen Qualität und Kitsch zu unterscheiden, beschreibt Rossmann auf seiner Expedition im Land der aufgegebenen Fördertürme und Industriebrachen die Auswirkungen des vielbemühten Strukturwandels auf die kulturelle Identität des Ruhrgebiets.
Wenn es sein muss, macht sich der Kritiker auch zu Fuß auf den Weg, um auf Halden zu klettern oder Landmarken abzuwandern: „Oben angekommen, sieht der Wanderer sich einem unbekannten Ort ausgesetzt. Doch erst im dialektischen Umschlag vollendet sich die Kunst der Landmarke: Sobald der Besucher dem Hochpunkt, den sie einnimmt, den Rücken kehrt, eröffnet sich ihm ein Panorama des Ruhrgebiets, das auf den nur von hier aus möglichen zweiten Blick seine Zerrissenheit und Unfertigkeit, sein Pathos und seine Grandeur offenbart: Seine ,andere‘ Schönheit“, schreibt Rossmann.
Die Textstelle zeigt, was das Buch ausmacht: Der intellektuell-literarische Blick auf eine Kunst, bei der sich der Ruhrgebietsmensch oft weigert, sie als seine eigene oder für ihn geschaffene wahrzunehmen. Die er mitunter misstrauisch beäugt wie beispielsweise Serge Spitzers Spirale auf dem Kennedyplatz in Essen, die viele Bürger „weg haben“ wollten, weil sie sie hässlich fanden. Nach dem Motto: Das alte Eisen, da haben wir früher mit malocht, das soll jetzt Kunst sein?
So führt denn auch Rossmanns Lesung im Lehmbruck-Museum in Duisburg unweigerlich zu einer Diskussion unter den Zuhörern um das Selbstverständnis des Reviers und seiner Bewohner. Ist es nicht Zeit, endlich mit dem Montanindustrie-Kitsch Schluss zu machen? Ein Zuhörer fragt: Warum werde nicht mal die Architektur der Ruhruniversität Bochum als einem der größten Arbeitgeber der Stadt gewürdigt statt immer Zeche Zollverein, die überall als mediales Wahrzeichen herhalten müsse? So regiere das Klischee, das auf die Vergangenheit verweise und Auseinandersetzung mit dem tatsächlichen Strukturwandel in der Gegenwart verhindere.
„Warum wohnen Sie eigentlich nicht im Ruhrgebiet, sondern in Köln?“, möchte eine andere Zuhörerin von Rossmann wissen. Sie selbst ist gebürtige Kölnerin, die es unfreiwillig ins Revier verschlagen hat. Der Autor begründet dies mit seinen Anfangszeiten als Kultur-Kritiker, als er sich strategisch günstig zum WDR positionieren wollte. Einer seiner ersten Ruhrgebietsbesuche führte ihn allerdings zu einem Bewerbungsgespräch als Dramaturg ans Theater Dortmund. „Die haben mich zum Glück aber nicht genommen“, gibt er selbstironisch zu.
Doch vielleicht ist ja gerade eine Fernbeziehung in diesem Fall nicht das schlechteste: Mit ein wenig Abstand liebt es sich neugieriger, man teilt nicht den langweiligen, zuweilen schäbigen und profanen Alltag. Die angebetete „Metropole“ bleibt interessant, ihre Veränderungen aufregend, ihre Kapriolen energiestiftend – vor allem, wenn man sich schon so lange kennt.
Andreas Rossmann: „Der Rauch verbindet die Städte nicht mehr. Ruhrgebiet: Orte, Bauten, Szenen. Mit Photographien von Barbara Klemm. Verlag der Buchhandlung Walther König, 260 Seiten, 14,80 Euro
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
Als Zwanzigjähriger schlug der spätere Künstler, Tanzschöpfer und Theatermann Jan Fabre ein „Forscherzelt“ im elterlichen Garten auf und richtete darin ein Minilabor ein, um Insekten zu untersuchen.
Die ärmliche, eigen- und urtümliche, nahezu schamanisch wirkende Behelfs-Behausung ist jetzt als Installation in Fabres sorgsam inszenierter Recklinghäuser Ausstellung aus dem Frühwerk zu sehen. Die Zusammenstellung kreist mit etwa 120 Zeichnungen und 30 Kleinskulpturen um ein einziges, freilich vielgestaltig entfaltetes Thema, nämlich just Insekten.

Das Zelt des jungen Jan Fabre (Bild: Katalog)
Die Arbeiten aus den Jahren 1975 bis 1979 firmieren als Schau zu den Ruhrfestspielen, die traditionsgemäß am 1. Mai beginnen werden. Was da auf Wänden und in Vitrinen imaginär krabbelt und kreucht, könnte ausgesprochene Phobiker diesmal von einem Besuch der Kunsthalle abhalten. Doch anders als bei früheren Präsentationen aus Fabres Oeuvre, verzichtet man in Recklinghausen auf lebende Spinnen in einer abstrus anmutenden Modell-Landschaft, die sich vom Zirkus bis zum Sadomaso-Studio, vom Theatersaal bis zum Operationstrakt phantasiert. Belgische Tierschützer haben Fabre mit – um es mal mit der juristischen Formel zu sagen – „empfindlichen Übeln“ gedroht, also bleibt der große Schaukasten diesmal unbelebt.

Jan Fabre: Skulptur aus Insekt und Schreibfeder, 1976-79, Mixed media (Museum of Contemporary Art, Antwerpen)
Die Welt der Käfer und Spinnen wird hier dennoch erfahrbar als eigener Kosmos zwischen Naturgeschichte, mitunter bizarren Formensprachen, künstlerischem Schöpfergeist und quasi religiösen Deutungsmustern. Wer will, darf angesichts mancher Bilder des Antwerpeners Fabre sogar einen weiten Bogen zu den flämischen Altmeistern und ihren Vergänglichkeits-Darstellungen schlagen. Es wäre nicht allzu weit hergeholt, sondern wohl ganz im Sinne des Künstlers, der die Insekten ebenso als Instinktwesen (wiederkehrendes Zeichen dafür: die Nase) wie als naturbegabte „Handwerker“ mit veritablen Körperwerkzeugen betrachtet.

Jan Fabre: Spinnentheater, 1979 (Bild: Katalog)
Fabre war mit seiner Obsession familiär vorbelastet. Sein Vater war Biologe und Stadtgärtner. Ein angeblicher „Stief-Urgroßvater“ (oder auch nur Namensvetter?) hieß Jean-Henry Fabre und war ein führender Entomologe, also Insektenforscher, übrigens auf nobelpreisverdächtigem Niveau. Seiten aus den Büchern des Altvorderen werden gelegentlich zum Ausgangspunkt von Überzeichnungen durch Jan Fabre.
Vielfach hat Jan Fabre seine Bilder mit einer bestimmten Kugelschreiber-Marke zu Papier gebracht. Bei den einfachsten Motiven handelt es sich um spürbar spontane Ideenfindungen, noch nahe am halbbewussten Gekritzel, wie es beim Telefonieren entstandenen sein könnte, doch oft auch schon im frühen Stadium genialisch behaucht.

Jan Fabre: „Spinnenkoppenpoten“ (1979), Bic-Kugelschreiber auf Papier (Courtesy Stichting Kröller-Müller Museum, Otterlo)
Überaus erfindungsreich variiert Fabre die Facetten des Themas. So wird etwa der schon im alten Ägypten legendäre Skarabäus („Pillendreher“) gleich serienweise mit Assoziationen bis hin zur christlichen Symbolik aufgeladen. In einer anderen Serie lassen Gitternetz-Strukturen und Schraffuren die Insekten-Gestalten geheimnisvoll hervortreten.
Die von Insekten verfertigten, mikroskopisch feinen Gespinste und sonstige Hinterlassenschaften, etwa aus Häutungen, sind gleichfalls formprägende Elemente dieser filigranen Welt. In einigen Vitrinen finden sich überdies seltsame, surreale Mischwesen aus Insekten und Gegenständen wie Taschenlampenbirne, Knopfbatterie, Stempel, Stöpsel oder Rasierpinsel. Eine womöglich befremdliche Überschreitung der Schöpfung? Künstlich natürlich. Natürlich künstlich.

Der Künstler, Choreograph und Theatermann Jan Fabre (© Angelos bvba Stephan Vanfleteren)
Überhaupt ereignen sich hier unentwegt Metamorphosen, es ist ein ständiges Werden und Vergehen, ein endloser Schöpfungs- und Zerstörungsakt. Beim „Fest der kleinen Freunde“ (Serientitel) ergehen sich die Insekten in bunter Lust am schieren Dasein. Tod, wo ist dein Stachel?

Lachlust in der Insektenwelt: Jan Fabre „Feast of little friends“ (1977), Tinte/Wasserfarbe auf Papier (Courtesy Flemish Community, Museum of Contemporary Art, Antwerpen)
Ein gewisser Kern und Beweggrund von Fabres Schaffen mag sich in seinen frühen Werken zeigen, doch hat er seither meist ungleich aufwendiger und spektakulärer gearbeitet – mit einem Hang zum monumentalen Gesamtkunstwerk auch in Performances, Choreographien und Opern. Derzeit inszeniert er die Oper „The Tragedy of Friendship“ (Premiere in Paris am 29. Mai) über die schwierige Freundschaft zwischen Richard Wagner und Friedrich Nietzsche.
Jan Fabre: Insektenzeichnungen & Insektenskulpturen 1975-1979. Ausstellung der Ruhrfestspiele in der Kunsthalle Recklinghausen, Große-Perdekamp-Straße 25-27. Vom Sonntag, 21. April (Eröffnung 11 Uhr) bis zum 23. Juni 2013. Öffnungszeiten Di-So und feiertags 11-18 Uhr, öffentliche Führungen sonntags um 11 Uhr. Internet: http://www.kunst-in-recklinghausen.de/1%20Aktuell/2013_fabre.html
Auch in Wuppertal gibt es derzeit eine Fabre-Schau – aus dem neueren Werk: Im wunderschön gelegenen Skulpturenpark Waldfrieden werden bis zum 2. Juni 22 Bronzeskulpturen der letzten Jahre gezeigt.
geschrieben von Frank Dietschreit | 6. September 2013
„Hinter der Nebelwand im Gehirn / gibt es noch andere Gegenden, / die blauer sind, als du denkst“, heißt es in einem Gedicht des Autors, über den im biografischen Anhang des Lyrikbandes „Blauwärts“ behauptet wird, er sei „vor langer Zeit im Innern des Landes zur Welt gebracht und polizeilich gemeldet“ worden.
Und weiter im Zitat: „Bald lernte er Gehen, Lesen und Schreiben. Anfangs machte er von sich reden, schimpfte und ließ sich beschimpfen. Heute rühmt er sich seiner gusseisernen Gutmütigkeit“.
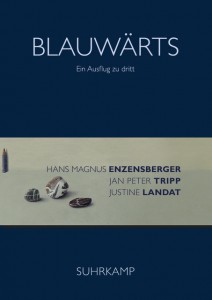
Hans Magnus Enzensberger war schon immer ein ironischer Flaneur, ein sanft lächelnder Beobachter politischer Aufgeregtheit und ein bissiger, unversöhnlicher Kommentator eines modischen Zeitgeistes, der sich stets genauso schnell wieder verflüchtigt, wie er aus dem Nebel der Mittelmäßigkeit aufgetaucht war. Doch jetzt, mit zunehmendem Alter, ist Enzensberger nicht nur mit enzyklopädischem Wissen und Weisheit gesegnet, sondern auch mit einer Gelassenheit, die ihn zu einem Buddha der Beharrlichkeit im unförmigen Brei der allgemeinen Banalität macht.
Der 83jährige Schriftsteller, Herausgeber und Übersetzer, Lyriker, Essayist und Erzähler ist seit Jahrzehnten einer der bedeutendsten Intellektuellen Deutschlands. Während anderen im Alter langsam die Worte ausgehen, läuft Enzensberger noch einmal zu ganz großer Form auf. Der Autor, der in den wirtschaftswunderlichen Jahren mit seinen politischen Gedichten die restaurativen deutschen Verhältnisse zum Tanzen brachte und zum Wortführer einer undogmatischen Studentenrebellion wurde, hat zuletzt mit einem poetischen „Album“ und mit satirischen „Lieblingsflops“, mit einer Polemik auf das „sanfte Monster Brüssel“ und kulturkritischen „Zwanzig-Minuten-Essays“ von sich Reden gemacht.
Jetzt also folgt ein furioser „Ausflug zu dritt“: Denn seine neuen Gedichte lässt Enzensberger vom Maler Jan Peter Tripp künstlerisch kommentieren. Wort und Bild kongenial kombiniert hat Gestalterin Justine Landat, die Textur und Bildsprache auf eigenwillige Weise miteinander ins Gespräch bringt. Tripps Bilder sind unabhängig von Enzensbergers Gedichten entstanden, sie illustrieren nicht, sondern durchdringen und übermalen den Text.
Sprechweise und Rhythmus variieren ständig, von kleinen, Haiku-artigen Gemeinplätzen bis zum großen Parlando des Langgedichts spielt Enzensberger mit allen Formen und Inhalten. Der Dichter spricht von unscheinbaren Nachbarn und ungebetenen Gästen, erinnert sich an tote Freunde und an seine Kindheit im Nationalsozialismus, er steht staunend vor einem „Dämonischen Enzephalogramm“, bekommt eine „Erleuchtung in der Besenkammer“, schaut der Seife dabei zu, wie sie immer weniger wird und schließlich „vollkommen verschwunden“ ist. In einem Gedicht über das „Gottesteilchen“ fragt er: „Warum wiegt etwas etwas / und nicht vielmehr nichts?“ Um das herauszubekommen, müssen wir mit Enzensberger „Blauwärts“ ziehen, denn in anderen Gegenden sieht die Geschichte anders aus: „von oben gesehen. Kühl und hell / schwerelos ginge dein Atem dort, / wo dein Ich nichts wiegt.“
Hans Magnus Enzensberger (mit Jan Peter Tripp und Justine Landat): „Blauwärts. Ein Ausflug zu dritt.“ Suhrkamp Verlag, Berlin 2013, 136 Seiten, 32 Euro.
geschrieben von Eva Schmidt | 6. September 2013
Was macht der Zugereiste, der Fremde an schmuddeligen Wintertagen in Düsseldorf? Wenn man nicht über die Rheinpromenade flanieren mag und Shopping auf der Kö zu teuer ist? Genau: Er geht in eines der hochkarätigen Museen der Kunststadt, spaziert in wohltuender Stille zwischen großformatigen Fotos umher, die sich realistisch geben, aber auf eine andere Wahrheit verweisen wollen. Die die Sehnsucht nach fernen Welten wecken und nach einem „höher hinaus“, nach einem Überschreiten der dörflichen Grenzen, nach einem Ende des kunstsinnigen Flüsterns.
Wie ein Fremdköper benimmt sich denn auch „Peer Gynt“ im Norwegerpullover (Olaf Johannessen) in den heiligen Hallen. Denn Staffan Valdemar Holm, der schwedische Ex-Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, hat Ibsens mythenbeladenem Helden in seiner neuesten Inszenierung ein Museum auf die Bühne gebaut. Lautstark streitet Peer dort mit der Mutter, sein ganzer Körper gespannt vor Aggressivität. Pöbelnd stört er den Hochzeitszug, ein Outlaw, den die Missbilligung der Gesellschaft zu besonders provozierendem Benehmen anstachelt. Doch es kommt noch besser: In ungezügeltem Trieb schändet er die Braut, stößt sie dann von sich. Wie ein reißender Wolf fährt er in die Herde der pietistisch korrekt gekleideten Trachtenmädchen, bespringt eine nach der anderen ohne zu ermüden. Doch auch das reicht ihm nicht. Wem das Menschsein zu eng wird, der sollte vielleicht ein Troll werden?

Staffan Valdemar Holm
Foto: Sebastian Hoppe
Es fällt schwer, als Zuschauer in Holms neuester Inszenierung nicht nach biographischen Anspielungen zu suchen: Aus gesundheitlichen Gründen hatte Holm Ende letzten Jahres seinen Posten als Intendant niedergelegt. Mit großer Offenheit hatte er über sein Burnout gesprochen und ebenso seinen Unmut über Sparmaßnamen und Auslastungsdruck öffentlich gemacht. In seiner Talkreihe „Gebrochen Deutsch“ thematisierte Holm mit feiner Ironie den „ausländischen“ Blick auf Düsseldorf, Merkwürdigkeiten, die Zugereisten auffallen, von den Hiesigen dagegen für selbstverständlich gehalten werden. So hat es „Peer Gynt“ nun in eine nordrhein-westfälische Kunstsammlung verschlagen – doch wie kommt er da bloß wieder raus?
Die Antwort lautet: Gar nicht. Denn ob Peer Gynt Thronfolger bei den Trollen wird oder reicher Sklavenhändler in Übersee, er bleibt doch immer im Museumsraum gefangen, nur die Ausstellungswände verschieben sich und die Bilder wechseln. Seine Geschichte bleibt immer eine vermittelte, eine, die man sich seit langer Zeit erzählt und die wir eher vom Hörensagen kennen. Denn wer von uns hätte schon eine richtige Heldenreise selbst erlebt? Deswegen kommt einem Peer Gynt auch eher vor wie ein Zukurzgekommener mit Borderline-Syndrom. Ihm bei seinen Eskapaden zuzusehen, hat durchaus Unterhaltungswert: Holms Inszenierung beweist Leichtigkeit und subversiven Witz, besonders das Trollvölkchen mit dicken Brillen und langen Plüschschwänzen entlarvt das Spießertum auf skurrile Weise.
Auch wenn der zweite Teil ein paar Längen aufwiest, so zieht die letzte Szene den Zuschauer noch einmal in ihren Bann. In einer verzweifelten Pantomime klammert sich Peer an seine große Liebe Solvejg (Anna Kubin), die er einst verliess. Doch er kann seine früheren Taten nicht ungeschehen machen und steht wieder mit nichts da wie zu Beginn, obwohl er doch alles erringen wollte.
Zum Glück hat wenigstens jemand zwischendurch Fotos gemacht und sie an die Wand gehängt. Wie geronnene Seelenzustände, die wir ein wenig distanziert betrachten. Ein fremdes Schicksal eben.
http://duesseldorfer-schauspielhaus.de/de_DE/Premieren/Peer_Gynt.867709
geschrieben von Eva Schmidt | 6. September 2013
„Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer Bewunderung: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.“ Aber wie passt die vielzitierte Sentenz des Philosophen Immanuel Kant zu einem Fotokünstler der Gegenwart?
Eigentlich gar nicht, möchte man meinen, doch empfangen den Besucher gleich im ersten Raum der Ausstellung von Wolfgang Tillmans im Düsseldorfer K21 riesengroße C-Prints von sternenübersäten Nachthimmeln. An der Wand gegenüber zieht eine kleine schwarze Venus über den orangenen Ball der Sonne. „Wann habe ich zuletzt einen derart geilen Sternenhimmel gesehen“, fragt man sich unwillkürlich und denkt an den letzten Sommerurlaub am Meer. Ernüchterung ereilt einen gleich im nächsten Zimmer: „Bitte nackt duschen“, warnt ein Schild und weitere Fotos zeigen unordentliche Kleiderstapel und schlecht sortierte Socken auf dem Sofa sowie herumstehendes Geschirr. Woher weiß der Fotograf denn so genau, wie es bei uns zu Hause aussieht?

Wolfgang Tillmans, Venus Transit, Kunstsammlung NRW
Vielleicht weil er unserer Generation angehört? 1968 in Remscheid geboren, feierte er noch ein paar wilde Partys in Düsseldorf oder so und machte sich dann Anfang der neunziger Jahre nach England auf. Heute lebt und arbeitet er in London und Berlin und die in der Schau versammelten Fotos wirken wie die Chronik seines Lebens – faszinierend und beiläufig zugleich. Sie zeigen die ihn umgebenden Menschen und Dinge völlig unprätentiös. Ein Mann in Unterwäsche betrachtet seine Fußsohlen, ein anderer steht im Schwimmbad herum. Zimmerpflanzen in Nahaufnahme treten nur für einen Augenblick, nämlich für dieses Foto, aus ihrem unbeachteten Dasein hervor und eine kleine Maus flüchtet in den Gulli, die Hinterbeine in die Luft geworfen.
Ebenso selbstverständlich blickt er auf die Phänomene der Subkultur und auf die nach harten Nächten Gestrandeten: Knutschende Männer, entblößte Muschis und Schwänze, die friedlich neben hübsch angerichteten Flugzeugtabletts liegen. Fast hätte man sie für das künstlich schmeckende Würstchen gehalten, das in solchen Situationen öfter gereicht wird.
Kaum ein Bild ist gerahmt, sie sind einfach so auf die Wand gepinnt und auch die fotografierten Promis kommen ganz unscheinbar daher: Fast hätte ich Kate Moss übersehen, bzw. sie für ein leidlich hübsches Mädchen mit etwas schiefen Zähnen gehalten, vor sich auf dem Tisch seltsamerweise eine Früchte-Mischung aus Erdbeeren und Kartoffeln. Manchmal kommt einem Tillmans vor, wie der Vorreiter der Facebookkultur: Ich poste mein Leben und ihr sagt mir, wer ich bin. Tatsächlich schafft es aber seine künstlerische Vermittlung, zu zeigen, wer wir alle sind.

Wolfgang Tillmans, Kunstsammlung NRW
Außerdem hat sein Werk durchaus eine gesellschaftspolitische Komponente: Eingehend hat sich Tillmanns mit dem Thema AIDS beschäftigt. Großformatig kopierte Zeitungsartikel lassen die Berichte aus Kriegsgebieten monströs erscheinen. Und das wandfüllende Foto von der blumengeschmückten Unterführung, in der ein Migrant Opfer von Neonazis geworden war, braucht keinen weiteren Kommentar. Ebenso wenig die überdimensionale Schaufel voll mit Müll aus dem Slum. So landet der Besucher nach den verschiedensten Eindrücken durch die Augen von Wolfgang Tillmans gesehen wieder beim Sternenhimmel, denn hier ist der Rundgang zu Ende. Von Moral war also auch die Rede, hätte man gar nicht gedacht. Und zum Schluss gibt es sogar noch einen Katalog geschenkt. Total nett, dieser Künstler. Kriegt ein „like“.
Bis 7. Juli im K 21 in Düsseldorf
www.kunstsammlung-nrw.de
geschrieben von Hans Hermann Pöpsel | 6. September 2013
Seit Januar und noch bis zum 21. April kann man sich in einem wirklich schönen Museum etwa 140 meist kleinformatige Gemälde und fast ebenso viele Zeichnungen von Otto Modersohn ansehen. Das Hagener Kunstquartier nennt in seinen Ankündigungen das Projekt zwar eine Doppelausstellung, doch Ottos Ehefrau Paula Modersohn-Becker ist nur in einem kleineren Nebenraum des Karl-Ernst-Osthaus-Museums mit wenigen Bildern vertreten.

Otto Modersohn, Landschaft im Winter.
(Foto: Museum Hagen)
Otto Modersohn, Mitbegründer der Worpsweder Malerkolonie, wird hier zum ersten Mal in Hagen mit einer Ausstellung von Werken aus allen Schaffensperioden gezeigt. Dabei hatte er durch seine Freundschaft mit Osthaus schon eine besondere Beziehung zu der westfälischen Industriestadt: Zusammen mit Heinrich Vogeler organisierte Modersohn vor hundert Jahren in genau diesem Museum die erste Retrospektive Paula Modersohn-Beckers, die in jungen Jahren nach der Geburt des zweiten Kindes gestorben war.
Die Schau macht deutlich, dass Otto Modersohn tatsächlich ein exzellenter Landschaftsmaler war, der Stimmungen durch Schatten und andere Lichteffekte sehr stark ausdrücken konnte. Aber auch die wenigen Bilder mit Personen, überwiegend Kinder oder die Ehefrau Paula, zeigen seine malerische und auch handwerkliche Qualität.
Die Bilder stammen überwiegend aus Privatbesitz, dazu zählen auch die Modersohn-Stiftung in Worpswede und das Museum in Fischerhude, Modersohns Wohnort. Dies und die kurze Lebenszeit seiner Frau Paula erklärt auch das Ungleichgewicht in dieser Ausstellung. So könnte man durch die getrennte Hängung und die kleine Anzahl der Bilder Paulas den Eindruck eines Qualitätsgefälles bekommen, aber eher das Gegenteil ist richtig. Paula Modersohn-Becker war ohne Zweifel die modernere und ausdrucksstärkere Künstlerin. Das zeigen sogar schon diese wenigen Gemälde, und die Nationalsozialisten haben sie gerade deshalb als „entartet“ aus den Museen verbannt. Das wirkt bei diesen Bildern schon fast wie eine Adelung, aber selbst das hat Paula Modersohn-Becker natürlich nicht nötig. Jedenfalls zeigt die Hagener Ausstellung das alte Dilemma, das entsteht, wenn die Exponate nicht nach Qualität, sondern nach Verfügbarkeit zusammengestellt werden.
Otto Modersohn: Landschaften der Stille – Paula Modersohn-Becker: Eine expressive Malerin. Werke aus Privatbesitz. Bis 21. April 2013. Karl-Ernst-Osthaus-Museum, Hagen, Museumsplatz 1. Eintritt 6 Euro, Katalog 28 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag 10 bis 17 Uhr, Donnerstag 13 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Montag geschlossen.
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
Wer hätte das gedacht: Da präsentiert Dortmund die bislang wohl weltweit umfangreichste Retrospektive zum Werk von Winsor McCay.
Winsor Who? – McCay! Der US-Amerikaner, der von 1869 bis 1934 gelebt hat, gilt als eigentlicher Erfinder des Zeichentrickfilms, dessen frühe Standards er lange vor Walt Disney gesetzt hat. So geht die zeitsparende Folientechnik für Bildhintergründe auf ihn zurück. Überdies war er einer der genialen Pioniere des Comics.
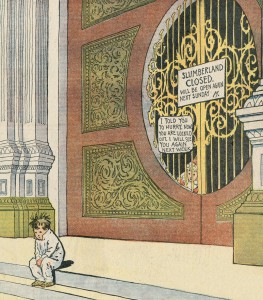
Das Tor zum Schlummerland – Detail aus Winsor McCays „Little Nemo in Slumberland“, 1906 (Bild: Katalog)
Diese besonders in Deutschland (NS-Zeit, Schundkampagne der 50er Jahre) lange unterdrückte bzw. gering geschätzte Kunstform entschied seinerzeit in den USA über Wohl und Wehe der Zeitungen. Nur wer die besten Comic-Zeichner hatte, konnte die Auflage nachhaltig steigern. Nachrichten aus Politik, Sport und Kultur waren demgegenüber fast zweitrangig. Die hatte ja, salopp gesagt, jeder. Der „New York Herald“ und später zahlreiche andere Blätter aber hatten Winsor McCay.
Die berühmtesten Serien McCays hießen „Dream oft the Rarebit Fiend“ (etwa: „Traum eines Käsetoast-Liebhabers“, ab 1904) und vor allem „Little Nemo in Slumberland“ („Der kleine Nemo im Schlummerland“, ab 1905). Vorbild dieser Kinderfigur war McCays Sohn Robert, der an Schlafstörungen litt und oft wüstes Zeug träumte. Während die irrwitzigen Käse-Episoden für ein erwachsenes Publikum gedacht waren, richtete sich Nemo in farbig gedruckten Wochenendbeilagen an ganze Familien und kam deshalb etwas entschärft daher.
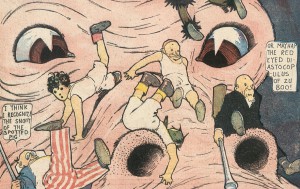
Alptraumszene aus „Little Nemo in Slumberland“, 1909 (Bild: Katalog)
Das Kerngeschehen beider Langzeitserien, die sich über Hunderte von Folgen erstreckten, wird von phantastischen Träumen und Alpträumen bestimmt, die freilich stets unterhaltsam ausfabuliert werden. Tatsächlich findet McCay dabei zu einer fulminanten Bildsprache, die Elemente des Surrealismus vorwegnimmt und manche Fährte der Freudschen Traumdeutung kongenial vor Augen führt.
Derart tief und manchmal verstörend ist McCay ins irrlichternde, flackernde Traumreich vorgedrungen, dass es im Grunde kaum verwundert, wer sein Werk in den späten 1960er Jahren der Vergessenheit entrissen hat. Es waren Underground-Zeichner wie Robert Crumb, die in ihm gleichsam einen Vorläufer ihrer wilden und windungsreichen Trips gesehen haben. Die Ausstellung dokumentiert auch Ausläufer solcher Nachwirkungen.
Im Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) sind nun annähernd 200 Exponate aus allen Schaffensphasen zu sehen – zumeist ursprüngliche Entwürfe oder originale Zeitungsseiten, für die auf dem Sammlermarkt zuweilen zigtausend Dollar bezahlt werden. Schräg gegenüber im Foyer des RWE-Towers ergänzen einige zusätzliche Filme die Schau, die den Abschluss einer stark beachteten Tournee (u.a. Hannovers Wilhelm Busch Museum und Basels Cartoonmuseum) bildet – mit deutlich mehr Ausstellungsstücken als an den vorherigen Stationen.
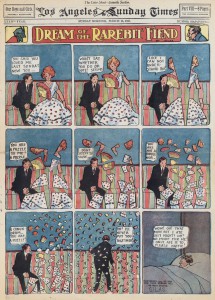
Bildfolge aus „Dream of the Rarebit Fiend“, 1913: Der Mann sagt, die Frau sei ihm ein Rätsel („puzzle“) – und schon löst sie sich in lauter Puzzleteile auf. (Bild: Katalog)
Der wahrhaft kundige Kurator der Schau, der gebürtige Dortmunder Alexander Braun, der notfalls stundenlang inspiriert und inspirierend über McCay sprechen kann, ist froh, dass just ein honoriges kulturgeschichtliches Museum den Schlusspunkt setzt, denn die anderen Stätten der Rundreise sind auf humorige Darstellungsformen spezialisiert. Hier aber erfahren die Comics nun die Nobilitierung, die solchen Künstlern und ihren Hervorbringungen gebührt. Heute nennen die Feuilletons bessere Comics ja auch ganz vornehm „Graphic Novels“.
Gewiss: Die Ursprünge McCays lagen im Varieté, im Vaudeville und in damals grassierenden Freak Shows. Mit seinen Filmen und sonstigen Vorführungen (z. B. als Schnellzeichner) hat der Workaholic, der bei Tag und Nacht in Schöpferlaune war, auch Jahrmarkts-Gelüste bedient, wie denn überhaupt das Kino anfangs eine Art Kirmesvergnügen gewesen ist und keine sonderlichen Hochkultur-Ambitionen gehabt hat.
Doch sowohl seine Filme als auch die Comics überwinden sehr rasch, ja quasi von Anfang an das starre Schema anderer Zeichner. Man sieht es schon am stets dynamisch wechselnden Zuschnitt der Bildformate, die – im Dienste der jeweiligen Geschichte – bis ins Extreme gehen können. Da werden beispielsweise ganze Bildfolgen mittels Zerrspiegel-Ästhetik in groteske Längenmaße gedehnt, andere verwirren durch endlose Treppenlabyrinthe. Und was der tausend Ideen mehr sind.
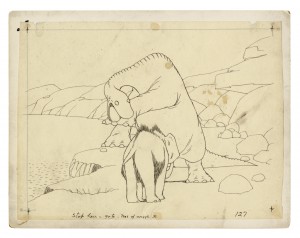
Zeichnung zum Trickfilm „Gertie, der Dinosaurier“, 1914 (Bild: Katalog)
Virtuos jongliert McCay mit den Zeichen- und Druck-Techniken des noch neuen Mediums, spannt weite, geradezu literarische Erzählbögen über viele Folgen hinweg und begibt sich alsbald immer mal wieder auf hintersinnige Meta-Ebenen, indem er etwa Dialoge mit seinen eigenen Figuren führt, die sich über schlampige Ausführung beschweren oder gleich in Tuscheflecken ertränkt werden. Höchst subtil sind Linienführung und Farbgebung, die durchaus an die Größen des Jugendstils heranreichen.
Und welche Visionen hatte dieser Selfmademan, der es übrigens zu einigem Wohlstand brachte! Zum US-Feiertag Thanksgiving denkt er sich einen Riesen-Truthahn aus, der ganze Häuser vertilgt – lange vor solchen Kinomonstern wie King Kong oder Godzilla. Seine immense Vorstellungskraft stellt er gelegentlich auch in den Dienst politischer Propaganda, so mit einem famosen Trickfilm über den Untergang der „Lusitania“ am 7. Mai 1915, die von einem deutschen U-Boot vor der irischen Küste versenkt worden war.

Fotografie von Winsor McCay, 1906 (Bild: Katalog)
Dieser schreckliche Vorfall bewog die öffentliche Meinung in den USA, im Ersten Weltkrieg gegen Deutschland Stellung zu beziehen. Die Kriegserklärung folgte allerdings erst rund zwei Jahre später. Fürs Zeitungs-Imperium des Verleger-Tycoons Randolph Hearst, der ebenfalls in diesem Sinne gegen Deutschland agitierte, illustrierte McCay in jenen Jahren zahlreiche Leitartikel.
McCays Lusitania-Film nimmt Sequenzen vorweg, wie sie später die großen Katastrophenfilme geprägt haben. Und man traut seinen Augen nicht, wenn die Menschen (sich) en masse vom Schiff stürzen. Hat da einer etwa schon Schrecknisse wie die des 11. September 2001 vorausgesehen? Sagen wir so: Wie viele andere Künstler, so hatte auch McCay einen geheimen Zugang zur Vorhölle, er war in der Lage, überzeitliche Formen des Urbösen zu imaginieren.
Zweierlei sollte man als Besucher jedenfalls mitbringen: Erstens viel Zeit, um sich auf die Bildfolgen einzulassen. Zweitens einigermaßen belastbare Englisch-Kenntnisse, sonst hat man von all dem leider ziemlich wenig.
Winsor McCay – Comics, Filme, Träume. 23. Februar bis zum 9. Juni 2013. Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Dortmund (Hansastraße 3). Eintritt 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Katalog 49 Euro. Geöffnet Di, Mi, Fr, So 10-17, Do 10-20, Sa 12-17 Uhr. Mo geschlossen. Infos über Führungen 0231/50-26028. Internet: www.museendortmund.de
Ergänzende Filmschau im RWE-Tower, Freistuhl 7. Vom 25. Februar bis zum 12. April 2013, werktags 9-18 Uhr (von außen durchs Schaufenster 24 Stunden lang zu sehen), Eintritt frei.
geschrieben von Theo Körner | 6. September 2013
Gefallen an ungewöhnlichen Gedankenspielen und Bereitschaft, sich auf Mystisches und Mythologisches einzulassen, sollten die Leser der „Briefe an Poseidon“ auf jeden Fall mitbringen. Es ist schon ein eigenwilliges Buch, das Cees Nooteboom geschrieben hat, in dessen Tiefen es sich aber durchaus einzutauchen lohnt.
In vielen kurzen, prägnanten Episoden schreibt der Autor über Begebenheiten, die ihn berührt haben. Nun richtet er seine Texte allerdings an einen Adressaten, von dem er wohl gerne eine Antwort hätte, aber sie kaum erhalten wird. Nooteboom wendet sich an den Meeresgott Poseidon. Dass nun gerade diese griechische Gestalt zur Projektionsfläche wird, ist ebenso Zufall wie die Ereignisse, von denen der Autor erzählt. Es war an einem Februartag 2008 auf dem Münchener Viktualienmarkt, als er in einem Fischrestaurant auf eine Serviette starrt, die die Gottheit mit dem Dreizack zeigt. Das Buch, auf das er zuvor gestoßen war, ein Werk des Schriftstellers Sándor Márai (der mit seinen Vorlieben für Lesen, Reisen und Beobachten eine Art Alter ego von Nooteboom gewesen sein könnte), inspirierte den mehrfach ausgezeichneten Schriftsteller zu seiner besonderen Art von Korrespondenz.

Es sind beispielsweise große Werke alter Meister, wie Gemälde von Brouwer, Rubens oder da Vinci, die Nooteboom anrühren. Nun beschreibt er nicht nur die Bilder eingehend, die übrigens in einem ausführlichen Anmerkungsapparat abgedruckt sind, er verknüpft mit den Betrachtungen auch gern Geschichten, die sich mit den Arbeiten in Beziehung setzen lassen. Mal sind es eher Randnotizen aus den Geschichtsbüchern, zu denen gehören dürfte, dass Samuel Beckett seine Vorliebe für Rubens sich auch durch die Nazis nicht vermiesen ließ und dessen Werke auch in einem Jahr wie 1936 im Kaiser Friedrich-Museum von Berlin anschaute.
Mal bietet sich aber auch beim Anblick eines Hafenbildes aus der beginnenden Neuzeit die Gelegenheit, zutiefst menschliche Fragen zu stellen. Wie ist es denn wohl eigentlich, wenn ein Mensch infolge eines Schiffsunglücks oder Flugzeugabsturzes in das Meer versinkt? Da müsste doch eigentlich Poseidon Expertenwissen mitbringen. Doch der schweigt. Nooteboom malt sich aus, wie oft dieser Gott wohl schon diese Dramen miterlebt haben muss. In solchen Worten steckt auch etwas Vorwurfsvolles. Der Verfasser berührt dabei durchaus die Frage, die auch Christen bewegt, warum nämlich ihr Gott Unheil und Übel zulässt. Indem Nooteboom mit Poseidon ringt, die griechische Mythologie mit ihren oftmals brutalen Machtkämpfen in Frage stellt, gewinnt das Buch eine durchaus religiöse Dimension. Und manchmal scheint der Autor Zwiegespräche mit „seinem“ Gott zu führen.
Bestechend an diesem neuen Buch von Nooteboom ist zudem die Präzision, wenn er über Tier- und Pflanzenwelt, das Weltall oder historische Ereignisse schreibt. Er selbst lässt sich gern von Eindrücken überwältigen. Dazu reicht das Wachstum einer Agave oder das Entdecken eines Lebewesens in den Untiefen des Meeres aus. Politisch bleibt sein Buch stets hochaktuell, verweist er doch auf ein Werk des griechischen Geschichtsschreibers Polybios (200 – 120 v. Chr.). Wenn er dessen Zeilen lese, habe er den Eindruck, die Tageszeitung von heute in Händen zu halten. Truppenbewegungen, Allianzen, Schlachten: Seit Poseidons Karrierebeginn hat sich so gut wie nichts geändert…
Cees Nooteboom: „Briefe an Poseidon“. Aus dem Niederländischen von Helga von Beuningen. Suhrkamp Verlag, 224 Seiten, 19,95 Euro.
geschrieben von Matthias Kampmann | 6. September 2013
Wäre Schweigen in diesem Fall eigentlich Gold? Warum dem Törichten eine öffentliche Plattform bieten?
Die Zeiten, in denen der Kritik das Wahre der Kunst von anderen Waren zu unterscheiden als Kernpflicht oblag, sind längst vorbei. Das System hat neben dem scheinbar reinigenden Meinungsgeblähe der Medien seinen eigenen Filter, um Qualität von, na sagen wir Scharlatanerie zu scheiden. Dennoch, wider den Stachel zu löcken ist im vorliegenden Fall einer unangenehmen Aktion von Iman Rezai angebracht, und zwar bewusst bildlos und linkfrei. Sie macht deutlich, dass eine neue Generation von Biografie-Designern am Werk ist, denen es vor allem um eins geht: PR. Und damit um Kohle. Hierbei sind die eingesetzten Mittel offensichtlich vollkommen zu Werkzeugen dieses Vermarktungssystems verkommen.
Das ist keine Kunst, das ist schlicht degoutant. Iman Rezai, 1981 im iranischen Schiraz geboren, im vergangenen Jahr Abschlusskandidat der Berliner Universität der Künste, tritt mit scheinbar provokanten Aktionen an die Öffentlichkeit. Neuester „Coup“: Er bietet – sofern es nicht ein Fake ist – dem geneigten Probanden zwischen dem 29.11. und 6.12. ein waschechtes Waterboarding an. Also diejenige Foltermethode, mit der das Opfer nicht getötet, sondern durch gewaltsames Untertauchen gequält und zermürbt wird. Diese menschenverachtende Perfidie kam während der Präsidentschaft George W. Bushs durch CIA und andere US-amerikanische Regierungsbehörden bei der Vernehmung von Terrorverdächtigen zum Einsatz und damit breiten Kreisen weltweit zu Bewusstsein.
Betroffenheitsklauseln aus der Hobbykiste
Man kann sich den ganzen hobbytheoretischen Begründungssermon hinter Rezais Pseudo-Polit-Anliegen sehr gut vorstellen. Denn seine PR-Maschine läuft wie geschmiert. In etwa so? „Der Berliner Künstler Iman Rezai kreiert Ausnahmesituationen, in denen Kunstbesucher mit einer Realität konfrontiert werden, die sie ansonsten nur aus den Medien zu kennen glauben…“ Noch ein paar Betroffenheitsklauseln in Fremdwort-Teig geknetet: Fertig ist die „große Kunst“. Besuche man nur die Webseite. Abstruse Sentenzen ummanteln in der Produktwerbung den eigentlichen Zweck mit billigen kulturhistorischen Behauptungen, um die Ausstellung – lasse man sich den verschwurbelten Titel auf der Zunge zergehen – „Die performative Postmoderne als Ausdruck moderner Austerität im Zeitalter der Prekarisierung Edition 1 – Illusion H2O“, in deren Kontext die Aktion stattfindet, zu bewerben. Neben Rezai bespielen zudem fünf weitere Nachwüchsler den Bereich eines Hotels am Checkpoint Charlie. Schaut man sich deren Werk an, wird die Lage auch nicht unbedingt interessanter.
Aktionen für den Boulevard
Wie unendlich differenzierter hat es 2006 Santiago Sierra mit „245 Kubikmeter“ in der von ihm mit Abgasen von sechs Pkw gefluteten Synagoge Stommeln vorgemacht, dass man – schockierend – Kunstbetrachter auf freiwilliger Basis in Extremsituationen bringen kann. Aber hier liegt der Fall anders, weil sinntragend und historisch kontextualisiert und auf die Gegebenheiten hin lokalisiert. Iman Rezai hingegen setzt ausschließlich auf Boulevard. Hinter ihm steht eine Agentur mit Namen „The Coup“, die sich selbst mit den Sätzen „Wir verstehen weder Fashion, Lifestyle noch Kunst als Charitybranchen. Im Fokus steht der Mehrwert und folglich der Profit des Kunden“ anpreist. Und wenn das kein Witz ist, heißt es: Wir verhökern jeden Dreck auf dreckige Weise, wenn’s nur Profit einbringt. Es geht also ausschließlich um Publicity und ums Kasse machen. Wie anders erklären sich die zwei törichten Vorläuferaktionen, mit denen Rezai sich ins Gespräch gebracht hat.
Zwischenruf: Sollen wir uns allen Ernstes an den Zustand gewöhnen, dass Modefotografen als Künstler proklamiert und von ein und derselben Agentur wie Rezai im gleichen sprachlichen Duktus vertreten werden? Der Künstler und die Kunst als gelabelte Luxushandtaschen. Und wie verkommen sind eigentlich diese „Nachwuchskünstler“, dass sie auf jene unverschämte Weise mit gestylter Dummheit in den Markt drängen und sich von PR-Schleudern wie „The Coup“ ein Image und Sprachgewand verpassen lassen?
Fingierte Guillotinen-Abstimmung
Doch zurück zur Sache: Das erste Mal fingierte Rezai im Internet eine Abstimmung über das Guillotinieren eines Schafs. Über 2,5 Millionen Klicks soll das eingebracht haben. Das Mordwerkzeug hat ein Sammler angeblich für 2,3 Millionen Dollar erworben. Anfang November verschickte er im Namen der der Neuen Nationalgalerie E-Mails, die behaupteten, Rezai habe den Server des Instituts unter Kontrolle gebracht. Täuschung wohin man schaut. Die Erregungsmaschinerie fand ihr Futter und der Schaumschläger seine billige Propaganda. Selbst gestandene Nachrichtenagenturen fielen auf den Blödsinn herein. Und nun dieses Wasserspielchen mit dem Publikum. Nein, das ist nichts. Das tut nur so, als ob es Kunst sei, dieses Deckmäntelchen niederer Interessen. Es ist ein albernes Spektakel für eine profitgeile Aufmerksamkeitsindustrie, das die niederen Instinkte einer ennuyierten Gesellschaft bedient, in der die Anliegen der künstlerischen Kritik und Aufklärung in Form rhetorischer Vehikel zum Rauschmittel des Glamours verkommen sind. Das einzig Kunsthafte an der Sache ist höchstens noch die Dreistigkeit, mit der Iman Rezai in den orchestrierenden Medien seine dürftige Karriere fingiert.
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
Wenn ein Kunsthaus einen Querschnitt durch den Eigenbesitz zeigt, so ist das vielleicht nicht sonderlich spektakulär, es hat aber doch etwas für sich. Zum einen sind die Kosten einer solchen Sichtung überschaubar, zum anderen schärft man den Sinn für Profil und Schwerpunkte der Sammlung. Mag sein, dass sich die künftige Ankaufspolitik danach neu ausrichtet.
Die Kunsthalle Recklinghausen verdankt ihre Bestände ganz wesentlich dem Kunstpreis „junger westen“, der aus der gleichnamigen Künstlergruppe (Gründung 1948 / Auflösung 1962) hervorgegangen ist. Deren Mitbegründer Thomas Grochowiak war von 1953 bis Ende der 1970er Jahre Direktor der Kunsthalle. Kein Wunder, dass andere Künstler aus seinem Netzwerk hier Heimstatt und Hafen fanden.
Wenn jetzt ein Überblick zu den Preisträgern von 1948 bis 2011 gezeigt wird, so erweisen sich womöglich Stärken und Schwächen, gewiss auch schmerzliche Lücken der Sammlung. Auch kann man ungefähr ermessen, was heute noch Bestand hat und was dem Vergessen anheimgefallen ist.

Kunsthallen-Leiter Ferdinand Ullrich (li.) und sein Stellvertreter Hans-Jürgen Schwalm mit dem Objekt "3er Sitz" des Hamburgers Stefan Kern (Preisträger des Jahres 1995). (Foto: Bernd Berke)
Genereller Eindruck: Die allermeisten Arbeiten sind auch jetzt noch durchaus vorzeigbar oder haben mit den Jahren gar an Bedeutung gewonnen, so etwa Bilder des nachmals weltberühmten Emil Schumacher, als er noch nicht dem Informel zugerechnet wurde. Ganz zu schweigen von einem Bild wie Gerhard Richters „Küchenstuhl“, das 1967 für schlanke 900 Mark erworben werden konnte. Heute würde man sich allenfalls wünschen, man hätte damals ein ganzes Konvolut aus seinem Atelier erworben. Einige andere Namen sind freilich allenfalls noch Fachleuten bekannt, sie sind in die zweite Reihe gerückt. Und manche Preisträger-Stücke sind auch jetzt im Depot geblieben, nicht zuletzt aus technischen oder Platzgründen. Wie denn überhaupt die Kunsthalle notgedrungen ein Institut der Wechselausstellungen ist und sonst keine Dauerschau bieten kann.
Kurzer Blick in die Historie: Die allerersten Ausstellungen der werdenden Gruppe gab es – mangels Museum – in der (damals gähnend leeren) Lebensmittelabteilung von Karstadt. Anfangs unterstützten die Künstler vom „jungen westen“ einander in Freundschaft, der Preis – zunächst gerade einmal 1000 Mark – wurde meist brüderlich zu mehreren geteilt. In der Frühzeit gab es zudem manchmal Sachpreise aus der Industrie, beispielsweise Maluntensilien oder auch ein Kofferradio. Ab 1956 wurden Jurys berufen, aus der gegenseitigen Akklamation wurde ein Verfahren der offenen Bewerbung, der die Urteilsfindung mit allem Für und Wider folgte. Es waren Entscheidungen mit Nachhall: Praktisch von allen Preisträgern (Frauen erst seit 1993, seither aber im Proporz) blieben Bilder in Recklinghausen – vielfach zum Freundschaftsentgelt überlassen. Hie und da gab es zur Abrundung auch Zukäufe aus dem Umkreis der Preisträger.
Heute beträgt die Dotierung des Kunstpreises „junger westen“ 10.000 Euro, doch hat die Auszeichnung nicht mehr den überragenden Stellenwert wie einst. Trotzdem gehen auf eine Ausschreibung (abwechselnd für Malerei, Arbeiten auf Papier und Skulpturen) rund 300 bis 600 Bewerbungen ein. Da es ein Förderpreis sein soll, liegt die Altersgrenze bei 35 Jahren, ehedem durften Bewerber bis zu 40 Jahre alt sein.

Constantin Jaxy (Preisträger 1987): "Titan" (Kreide, Tusche, Graphit auf Karton, kaschiert auf Leinwand). (Kunsthalle Recklinghausen / Foto: Bernd Berke)
Die weitgehend chronologische Präsentation lässt jetzt auf jeder der drei Kunsthallen-Etagen eine andere Zeitgeist-Mischung hervortreten. Im Erdgeschoss findet man vorwiegend das solide Fundament der Sammlung aus den 50er Jahren (Thomas Grochowiak, Emil Schumacher, K.O. Götz, Heinrich Siepmann, Gustav Deppe, Hans Werdehausen, HAP Grieshaber, Emil Cimiotti usw.), im ersten Stock werden Umbrüche der 60er und 70er dezent spürbar (Horst Antes, Gerhard Richter, Ansgar Nierhoff, Rolf Glasmeier). Ganz oben findet man sich schließlich in der Gegenwart wieder. Zugespitzt gesagt: Es ist, als würden archäologische Schichten der Sammlung freigelegt.
Wir können hier nicht alle 35 Künstler einzeln würdigen. Allerdings sollte man sich diese Ausstellung gerade nicht in schnöde summarischer Absicht ansehen, sondern sich sozusagen auf intensive „Lektüre“ einlassen und also zwar manches en passant anschauen, dafür aber bestimmte Arbeiten umso eingehender betrachten. Dann hat man vermutlich mehr vom Besuch. Meine persönliche Präferenz weist in die neuere Abteilung: Es sind die rätselvollen Raumschöpfungen der Berlinerin Heike Gallmeier, die den Preis 1999 erhalten hat. Ungewöhnlich ihr Verfahren: Sie malt Bilder, um aber sodann Fotografien der Gemälde zu zeigen. Ein Grenzgang zwischen den Medien.
Kunstpreis „junger westen“ 1948 bis 2011. Die Preisträger. Werke aus der Sammlung der Kunsthalle Recklinghausen. Sonntag, 11. November 2012 (Eröffnung 11 Uhr) bis 27. Januar 2013. Kunsthalle Recklinghausen, Große-Perdekamp-Straße 25-27. Geöffnet Di-So und feiertags 11-18, Heiligabend/Silvester 11-13 Uhr. Führungen sonntags 11 Uhr. Kein Katalog. Infos im Internet: www.kunst-re.de
geschrieben von Matthias Kampmann | 6. September 2013

Mustertafel mit „Mannequins“ für den Künstlerbedarf (Detail), französisch, um 1868, Sammlung Dietmar Siegert. Foto: Matthias Kampmann
Monsieur Leblonde kann man sich vorstellen als jemanden, der von Atelier zu Atelier zog und ein interessantes Produkt anpries: eine Puppe aus Kautschuk. An sich nichts Besonderes, aber zu der Zeit, es ist das 19. Jahrhundert, ein herrliches Utensil für halsstarrige Akademisten, die sich von der Fotografie nicht den Schneid abkaufen lassen wollten und natürlicher als die Natur zu malen gedachten.
Diese Puppe ist aus heutiger Sicht mehr als nur ein Symptom für die Geschäftstüchtigkeit eines Bildhauers mit Nebeneinkünften. Sie ist Symbol einer Zeit, in der Golems, Homunkuli und Roboterfantasien geträumt wurden. Das Doppel des Menschen. Hier in Form eines Lehrmittels. Leblonde führte nun nicht das vielfach ausgezeichnete Modell mit sich. Vielmehr besaß er einen Klappkoffer aus zwei Holzrahmen. In voller Ausbreitung mannshoch, zeigt es herrlich posierend diese Erfindung zur Erkundung der menschlichen Anatomie in zahlreichen Fotografien, und man muss schon zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass es sich um einen künstlichen Körper handelt.
Vielleicht ist es das überraschendste Exponat in der Ausstellung „Tagträume – Nachtgedanken. Phantasie und Phantastik in Graphik und Photographie“, die Yasmin Doosry, Direktorin der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg, zusammen getragen hat. Wieder einmal geht es um die Phantasmen, wieder einmal um die Relation der Surrealisten zu kunsthistorischen Vorläufern seit der Dürerzeit.
Nur Papier. Die trockene Feststellung ist keine Geringschätzung. Doosry beschreibt, dass gerade die Grafik Ideenschmiede der Künstler war. Rund 130 Fotografien, Zeichnungen, Druckgrafiken und Künstlerbücher sind in der Ausstellung zu sehen, die in Kooperation mit der Fundación Juan March, Madrid, entstand. Davon stammen 80 Prozent aus dem Bestand des Nürnberger Instituts. „Gut, dass unser Museum ein solches Depot hat. Sonst wären solche Ausstellungen nicht möglich“, meint Ulrich Großmann, Generaldirektor des Hauses.
Und in der Tat. Man sieht, hier wird aus dem Vollen geschöpft, und die Qualität der heimischen Arbeiten ergänzen prominente Leihgebern wie das Pariser Centre Pompidou. Es ist einfach wunderbar. Frisch wie am ersten Tag der Totentanz von Michael Wolgemut aus dem Jahr 1493 oder die „Majuskeln des lateinischen Alphabets“ von Matthias Zündt nach Hans Lencker von 1567, ein koloriertes und mit Gold gehöhtes Titelblatt von Lenckers „Perspectiva Literaria“.
Die Ausstellung, typisch für Grafikabteilungen, liegt im Halbdämmer. Das kommt nicht nur der Physis der empfindlichen Arbeiten wie den geradezu hingehauchten „Geschlossenen Augen“ eines Odilon Redon, eine Lithografie von 1890, zugute, sondern steigert auch die Einstimmung aufs Thema. Elf Kapitel beleuchten das Unheimliche, Fantastische, Träumerische in der Kunst seit der deutschen Renaissance. In den Vitrinen haben die Ausstellungsdesigner stumpfe Spiegel – gespenstisch – simuliert.
Der Besucher betritt jedoch keine mit Spinnweben vergarnte Rumpelkammer, sondern eine wohl sortierte und geordnete Melange aus kühler Geometrie mit ein bisschen Schreckenskabinett, Suchbildern und desorientierender Verwirrmaschine. Das Menschliche wird durch seltsame Konstrukte aus Torsi und Konfrontationen mit allerlei Fremdkörpern übersteigert. Fühlbar und sichtbar ist Entfremdung durch Verfremdung. Physikalisch simpel kommen noch die Anamorphosen daher, die seit dem 16. Jahrhundert entstehen und mehr oder weniger andeuten, dass das Sehen immer ein vermitteltes ist.
Es braucht den täuschenden Rundspiegel, damit das Bild von Diana und Cupido, die den schlafenden Endymion aufsuchen, unverzerrt gesehen werden kann. Christian Heinrich Weng kreierte das Rundblatt um 1770. Motivisch organisiert Doosry André Steiners „Anamorphose III“ (1933) aus der höchst qualitätsvollen Sammlung von Dietmar Siegert, der fast alle Fotografien beisteuerte, hinzu. Das Gummiband im Bild mit der schrägen Perspektive soll der Ariadnefaden sein, doch der Blick bietet keine Übersicht, das Auge dreht Schleifen zwischen Vordergrund und dem Spiegelbild im Hintergrund. Oder ist es umgekehrt?

Christian Heinrich Weng: Diana und Cupido suchen den schlafenden Endymion auf, ca. 1770. Foto: Matthias Kampmann
Es gibt in der Schau Exponate, die einfach Freude bereiten, selbst wenn ihr künstlerischer Wert weniger bedeutend ist. So bietet sich hier für viele Menschen vielleicht das erste Mal die Gelegenheit, einen originalen „Cadavre exquis“ zu betrachten. Dieser hier stammt aus dem Jahr 1935. Mitgewirkt haben Óscar Domínguez, Hans Bellmer, Georges Hugnet und Marcel Jean. Mit Blei- und Farbstiften zeichneten sie auf das einen halben Meter lange und 32,8 Zentimeter breite Papier. Jeder beackerte einen Teil des Blatts, den die anderen jedoch nicht sehen konnten. Dann falteten sie den Streifen, und der nächste war dran. Wer dabei was gezeichnet hat, lässt sich nur mutmaßen. Auseinandergefaltet ergibt sich das verrückte Erzeugnis.
Das Erstellen des Cadavre ist eine Form gemeinschaftlicher Kreativität, die immer zu überraschenden Ergebnissen führt. Hier stoßen Schriftwolken mit den Künstlernamen auf Formen, die wie Organe anmuten, und die ganze absurde Zeichnung wächst aus einem Vulkan, der sich aus einer ovalen Blase speist. Erotische Konnotationen erwünscht. Aber das ist ja so üblich bei den Surrealisten. Schließlich atmeten ihre Helden Siegmund Freud und entließen ihre Einfälle durch die „Steigrohre des Unbewussten“.
Es ist definitiv nichts Neues, den Surrealismus in eine verwandtschaftliche Beziehung mit früheren Künstlern zu setzen. Kuratorin Doosry bezieht sich hier ganz bewusst auf die 1937 im New Yorker Museum of Modern Art gezeigte Surrealisten-Schau, in der der legendäre Gründer Alfred Barr eine solche Kombination erstmals realisierte. Der Blick auf die Fantastik durch die Brille des Surrealismus ist ja so naheliegend, dass derzeit auch eine Ausstellung des Frankfurter Städelmuseums mit „Schwarze Romantik“ einen ähnlichen Fokus setzt. Allerdings ist es in Nürnberg ausschließlich Grafik in Kombination mit der Fotografie, die zu motivischen und inhaltlichen Vergleichen anregt.
Das Nürnberger Vorhaben bleibt bei der Kunst und begeht nicht den Fehler, der in den 90er Jahren Methode war, Kunstgeschichte als psychoanalytisch motivierte Theorie-Illustration zu betreiben. Hier bleibt man auf dem Teppich. Abheben sollen andere. Sehr schön ist etwa die Kombination der Rötelzeichnung „Eine Art zu fliegen“ von Francisco de Goya mit der gleichnamigen Radierung, veröffentlicht nach dem Tod 1864 als eine der 18 „Torheiten“, damals unter dem Titel „Sprichwörter“. Was dieser seltsame Otto Lilienthal und seine Mitflieger in Vogelflug imitierenden Apparaten da machen, entzieht sich zum Glück der finalen Deutung – wie das meiste in dieser Ausstellung.
Es öffnen sich zudem andere, ungedachte Fenster, die leider in der Schau keine Berücksichtigung finden. Yasmin Doosry erzählt, dass „Aqua“, eine Arcimboldo nachempfundene Kompositfigur aus Meerestieren von 1580 aus dem Nachlass von Vincent Van Gogh stammt. Von dem sicher das eine oder andere Fantastische hätte gezeigt werden können. An sich ist es eine durchaus attraktive Vorstellung von einer vielleicht fantastischen Ausstellung. Und dass ein Museum seine eigenen Grenzen überschreitet und wie im Fall des Germanischen Nationalmuseums ausnahmsweise nicht nur Kunst aus dem deutschsprachigen Raum zeigt, ist angesichts des Themas notwendig.
Doch natürlich trifft man in der Hauptsache die üblichen Verdächtigen. Salvadore Dalí, Max Ernst, Paul Klee, Pablo Picasso, Man Ray, Yves Tanguy, bei den Älteren dann Giovanni Battista Piranesi, Goya, und natürlich kann eine solche Ausstellung an diesem Ort „nicht ganz Dürer-frei“ bleiben, wie Generaldirektor Ulrich Großmann trocken feststellt. Vom übermächtigen Altmeister ist einmal mehr die „Melancolia I“, der unglaublich berühmte wie rätselhafte Kupferstich aus dem Jahr 1514 zu sehen. In jedem Fall bekommen die Besucher eine Menge zu tun, eine weite Übersicht und viele motivische Bezüge vom Auftakt mit dem Blick des inneren Auges über die weiteren zehn Stationen. Wer wollte sich dem widersetzen.
Die Ausstellung ist vom 25. Oktober bis 3. Februar 2013 zu sehen. Öffnungszeiten: Di, Do, So 10 bis 18 Uhr, Mi 10 bis 21 Uhr. Der Katalog kostet 28,50 Euro im Museumsshop, im Buchhandel 38 Euro. Ein besonderes Highlight im Beiprogramm ist die Kooperation mit dem Filmhaus Nürnberg. Es werden dort unheimliche und fantastische Filme aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, etwa „Nosferatu. Eine Symphonie des Grauens“ (1922) von Friedrich Wilhelm Murnau, gezeigt (25.11., 19.15 Uhr).
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
Hagens Osthaus-Museum nimmt jetzt die eigene Geschichte in den Blick – von den Uranfängen anno 1902 bis heute. Doch man geht dabei nicht streng geordnet vor, sondern gleichsam essayistisch, kursorisch, nach Art von Flanierenden.
Damit macht man aus der Not eine Tugend. Denn weite Teile der ursprünglichen Bestände sind ja nicht mehr zur Hand, so dass in einer bloßen Chronologie arge Lücken klaffen müssten. Bekanntlich sind die hochbedeutenden Kernbestände der Sammlung im Jahr 1922, nach dem Tod des Hagener Mäzens und Museumsgründers Karl Ernst Osthaus (1874-1921), nach Essen gelangt. Sie bildeten dort den reichen Fundus des heutigen Folkwang-Museums. In Essen frohlockten sie über den immensen Zuwachs, denn Osthaus hatte mit den Bilderschätzen (u. a. Renoir, Van Gogh, Cézanne) in Hagen ab 1902 das weltweit erste Museum für zeitgenössische Kunst begründet, und zwar gegen den herrschenden Ungeist der Zeit, in der Kaiser Wilhelm II. die Werke der Franzosen als „Rinnsteinkunst“ bezeichnete.
Die wirtschaftsmächtigen Essener konnten Osthaus’ Erben einfach mehr Geld bieten, als Hagen es vermochte. Auch Gerichtsprozesse ums Kunsterbe fruchteten nichts. Es war ein gigantischer Verlust, im Grunde bis heute nicht völlig zu verschmerzen. Hagen verfiel damals für Jahre in eine Art Schockstarre. Erst 1930 wurde mit dem Rohlfs-Museum wieder nennenswertes Neuland betreten. Doch diesen Künstler wiederum verfemten die Nazis bald darauf als „entartet“. Den Hagenern gingen in der Folgezeit rund 400 Werke von Christian Rohlfs verloren – nicht zuletzt durch Plünderung. Eine Sammlungsgeschichte mit Verlusten und Verwundungen.

Ferdinand Hodler: "Der Auserwählte" (1903, zweite Fassung), Öl auf Leinwand, © Osthaus Museum Hagen.
Den zentralen Platz im Entrée der Ausstellung „Der Folkwang Impuls. Das Museum von 1902 bis heute“ nimmt nun Ferdinand Hodlers grandioses Gemälde „Der Auserwählte“ (1903) ein, das gottlob noch zum Hagener Besitz zählt. In diesem Kontext wird noch einmal überdeutlich: Das Werk sollte nie und nimmer verkauft werden dürfen, so sehr steht es für den lebensreformerischen Impuls der Anfangszeit. Zwischenzeitlich hatte es ja Gerüchte gegeben, dass Lokalpolitiker der überschuldeten Stadt Hagen auf einen namhaften Millionenerlös bei britischen Versteigerern spekulierten.
Karl Ernst Osthaus hat keineswegs nur Impressionisten und später Expressionisten gesammelt. Das Hagener Folkwang-Museum hat er sich ungleich vielfältiger vorgestellt. Er war offen auch für außereuropäische Schöpfungen. Von ausgedehnten Reisen, insbesondere in den Orient, hat er zahlreiche Kunstgegenstände mitgebracht, die jetzt großzügig präsentiert werden.
Gebrauchskunst in Handel und Gewerbe sowie Architektur gehörten gleichfalls zu seinen Vorlieben. Überdies hegte der Mann, der durch eine Erbschaft (nach heutigem Wert ca. 30 Millionen Euro, bei relativ moderaten Preisen auf dem Kunstmarkt) unabhängig geworden war, naturwissenschaftliche Interessen. Er besaß eine heute verschollene Kollektion mit Abertausenden von Schmetterlingen und Käfern. Besonders die Farbenpracht der Schmetterlinge hat Osthaus fasziniert. Mit all dem verfolgte er – im Zeichen eines gehörig erweiterten Kunstbegriffs – durchaus pädagogische Absichten. Kunst sollte das ganze Leben ergreifen und die Menschen durch Schönheit veredeln. Welch ein Impuls, welch eine Vision, welch eine Utopie!
Osthaus’ Lebensstationen und seine staunenswert vielfältigen Interessen werden nicht nur mit Kunstwerken, sondern auch anhand von zahlreichen Archivalien (Briefe, Dokumente, Fotos, Plakate etc.) belegt, denn immerhin zählt seit 1963 das Osthaus-Archiv zum Hagener Bestand. Wohl noch nie wurde es für eine Ausstellung derart gründlich ausgewertet wie jetzt durch den emsigen Kurator Christoph Dorsz.
Mit der auf 2300 Quadratmetern in Alt- und Neubau weit ausgreifenden Schau würdigt man zwar zwangsläufig auch die großen Gründungsjahre von 1902 bis 1922, als hier ein veritables Weltmuseum entstand, doch weitet man die Perspektive. Schließlich ist auch in den „restlichen“ 90 Jahren seither weiter gesammelt worden; nicht immer, aber doch wesentlich den frühen Folkwang-Impulsen folgend. Die bringen vor allem die Verpflichtung mit sich, ein waches Augenmerk auf die jeweilige Gegenwartskunst zu haben und dabei auch die örtliche und regionale Szene nicht zu vernachlässigen.
Nach 1945 hat die damalige Osthaus-Chefin Herta Hesse-Frielinghaus die verbliebenen Bestände durch Neuerwerbungen nach Kräften verdichtet. Nun wurden beispielsweise auch Arbeiten der Informel-Künstler, darunter natürlich der Hagener Emil Schumacher, gesammelt. Schritt für Schritt kann man an ausgesuchten Beispielen die Genese des heutigen Eigenbesitzes verfolgen.
Hier kommt einiges am passenden Platze zusammen. Es wird etwas vom Geist des Gründervaters spürbar, je mehr man in die Dokumente eintaucht. Auch Facetten des allgemeinen Zeitgeistes lassen sich erahnen. Und schließlich waltet der Geist des Ortes, vor allem im imposanten Brunnensaal des Museums, dessen historische Zusammenhänge hier gleichfalls beleuchtet werden.
Die Ausstellung ist somit auch eine Selbstvergewisserung des jetzigen Teams um Museumsleiter Tayfun Belgin. Dem Bezug zur lokalen Szene etwa kommt man nach, indem auf Bilder der weltkriegszerstörten Stadt Hagen die Schwarzweiß-Fotos des jungen Hagener Fotokünstlers Andy Spyra folgen. Er hat den Folgen des irakischen Bürgerkriegs für die verbliebenen Christen nachgespürt. Was als thematischer Bruch erscheinen könnte, gehört in Wahrheit hierher. Auch die Dialoge mit den Rändern des Kontinents und mit nicht-europäischer Kunst will man bewusst weiterführen. 2010 war die Türkei an der Reihe, 2013 wird Korea folgen.
Mit dieser Ausstellung begibt sich das Museum auf Spurensuche nach seiner Identität. In Essen (das einige Leihgaben zu den 300 Exponaten beisteuert) hätten sie das wohl nicht in diesem Maße nötig. Aber gerade solche schweifenden Suchbewegungen können ja neue Wege im Gefolge der Traditionen weisen.
„Der Folkwang Impuls. Das Museum 1902 bis heute“. 21. Oktober 2012 bis 13. Januar 2013. Osthaus Museum Hagen. Museumsplatz 3 (Navigation: Hochstraße 73). Geöffnet Di/Mi/Fr 10-17, Do 13-20, Sa/So 11-18 Uhr. Katalog 19, 90 Euro. Eine Reproduktion der 1912 – also vor 100 Jahren – erschienenen ersten Hagener Folkwang-Katalogbroschüre kostet 4 Euro.
Internet: www.osthausmuseum.de
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
Zu Van Gogh und Rubens können auch alle Kunstfernen was ausposaunen: Der eine hat sich ein Ohr abgeschnitten, der andere vorzugsweise üppige Frauen gemalt. Und fertig.
Was gleichfalls im populistischen Sinne bestens ankommt: Rubens war zu seinen Lebzeiten der weltweit teuerste Maler, auch heute würde er – käme überhaupt etwas auf den Markt – mit vorn liegen. Wuppertals Von der Heydt-Museum kann also schon mal auf einen Berühmtheits-Bonus bauen, wenn es nun rund 50 Gemälde und Skizzen von Peter Paul Rubens (1577-1640) zeigt. Museumschef Gerhard Finckh und sein Team wissen solche günstigen Vorgaben zu nutzen und peilen die magische Marke von 100 000 Besuchern an. Inhaltlich gehen sie aber deutlich über solche Äußerlichkeiten hinaus und treten mit ordnendem Konzept an.

Peter Paul Rubens: "Dianas Heimkehr von der Jagd" (um 1616) (© Gemäldegalerie Alter Meister, Dresden / Staatliche Kunstsammlungen Dresden / The Bridgeman Art Library Nationality)
Ein Schwerpunkt der Wuppertaler Ausstellung, die alle Lebensphasen des barocken Meisters seit dessen italienischer Frühzeit umfasst, liegt auf Rubens’ diplomatischem Wirken. Die Bilder um Macht und Pracht, aber auch um das Leiden an den Zeitläuften werden geradezu schwellend in Szene gesetzt. Da wallen eingangs schwere rote Vorhänge, einladend beiseite gezogen. Die Gemälde prangen nicht nur auf dem heute museumsüblichen weißen Grund, sondern sind hie und da auch von stilisierten Tapetenmustern hinterfangen – hinreichend diskret, versteht sich. Mit etwas blühender Phantasie kann man sich gar vorstellen, man würde in Rubens’ prächtigen Gemächern empfangen. Porträts des Hausherrn und ein eigenhändiger Brief (verfasst in diplomatischer „Geheimsprache“, wobei „Bäume“ für Bestechungsgeld stehen) tun das Ihre hinzu.
Doch halt! Ohne historische Hintergründe geht es nicht: Nach der Glaubensspaltung wütete viele Jahrzehnte lang Krieg in Europa. Bald ging es nicht mehr allein um Protestantismus und Katholizismus, sondern der religiöse Konflikt wurde überlagert vom Widerstreit der Großmächte.
Der im evangelischen Siegen geborene Rubens war von Haus aus protestantisch, konvertierte aber in Köln zum Katholizismus. Sein Lebtag hat er ringsum nur kriegerische Zeiten gesehen. Die Motivation des hochgebildeten, belesenen Mannes, nach Kräften Friedensschlüsse zu vermitteln, war enorm. Als Hofmaler, der in allerhöchsten Kreisen verkehrte und selbst einen veritablen Palast in Antwerpen unterhielt, hatte er auch entsprechende Verbindungen.

Peter Paul Rubens: "Thetis empfängt die Waffen für Achill (1630-35) (© Musée des Beaux-Arts, Pau, France, Giraudon, The Bridgeman Art Library)
Den Wohnort Antwerpen hat er sicher mit Bedacht gewählt. Als Maler fand er in den katholischen Südniederlanden (heutiges Belgien) bessere Bedingungen vor als in den protestantisch gewordenen und somit eher bildabstinenten Nordprovinzen (heutiges Holland). In Antwerpen betrieb er ein Atelier mit zeitweise rund 100 Mitarbeiten. Für seine Werkstatt malten Spezialisten jedweder Richtung, darunter vorübergehend auch Anthonis van Dyck oder Jacob Jordaens. Nicht erst Andy Warhol hat im „Factory“-System produziert.
Rubens’ fulminante Skizzen für die Ausschmückung der Antwerpener Jesuitenkirche sind Beispiele für vitale Ideenfülle und Bilderlust. Da kann es sogar geschehen, dass eine Helferin der Heiligen Klara von Assisi (1620) dem Betrachter durch perspektivische Verzerrung ein monströses Hinterteil vorweist. Überhaupt ist es ein Vorzug der Skizzen, gelegentlich „frecher“, experimenteller und näher am Aufleuchten der ursprünglichen Einfälle zu sein als ausgeführte Gemälde, die meist offiziellen, repräsentativen Anforderungen zu genügen haben.
Als Diplomat operierte Rubens mit wechselndem Geschick. Nach mehreren anderweitigen Fehlschlägen gelang es ihm immerhin, 1630 einen Friedensschluss zwischen Spanien und England herbeizuführen. Manche wollen in Rubens gar einen frühen Vorläufer des europäischen Gedankens sehen. Gemach! Nicht, dass man ihm noch posthum den Friedensnobelpreis zuerkennt…
Gleichviel. Die Tätigkeit auf politischem Felde bleibt jedenfalls nicht ohne Auswirkung auf die Malerei. Anhand vieler Werke erhält man Einblick in die weltlichen und kirchlichen Sphären, in denen sich Rubens bewegte. Seidig schimmernde Herrscherporträts aus dem Umkreis der Medici-Zyklen (die großformatigen Medici-Originale verbleiben natürlich im Louvre) zeigen, zu wem Rubens Zugang hatte. Auch kündet das Bildprogramm etlicher Arbeiten von (philosophisch und mythengeschichtlich solide unterbauter) Friedensneigung und der Suche nach „dritten Wegen“ zwischen Konfessionen und Kriegsparteien.

Peter Paul Rubens: "Abraham und Melchisedek" (um 1615-18) (© Musée des Beaux-Arts, Caen, France / Giraudon / The Bridgeman Art Library Nationality)
Leitgedanken der Überparteilichkeit entnahm Rubens den Werken der Antike, speziell von Heraklit, Lukrez oder Seneca. Auf solche Lektüre deutet ein ungemein lebendiges Bildnis des Seneca (1614/15) hin, das den antiken Skulpturen gleichsam neuen Atem einhaucht und sie in die damalige Gegenwart holt. Auch „Herkules besiegt die Zwietracht“ (1615-20) gehört in diesen Zusammenhang. Bei Bedarf verwandelte Rubens selbigen Helden des Altertums allerdings auch schon mal zum Christophorus.
Die Allegorik der Bilder mag damals den gebildeten Ständen gleich eingeleuchtet haben, heute muss sie erst entschlüsselt werden. Überdies erscheint manches doppeldeutig und hintersinnig. So kann man etwa bei näherer Untersuchung der „Allegorie der guten Regierung“ (1625) stutzig werden. Die scheinbar umstandslos gepriesene Herrscherin Frankreichs, Maria de Medici, lässt die Waage der Gerechtigkeit denn doch sehr lässig baumeln, und eine Mauer, die sich hinten durchs Bild zieht, könnte sehr wohl auf unfreie Verhältnisse hinweisen.

Peter Paul Rubens: "Wildschweinjagd" (um 1615/16) (©Musée des Beaux-Arts, Marseilles, France / Giraudon / The Bridgeman Art Library Nationality)
Die Ausstellung zeichnet zwar auch diplomatische Wege nach, schwingt sich aber vielfach zu grandiosen, genuin künstlerischen Momenten jenseits aller politischen Bedeutungen auf. Ein Bild wie „Wildschweinjagd“ (um 1615/16) dient zwar der Verherrlichung eines wohltätigen Regenten, doch nimmt die dramatische Zuspitzung der Szene über allen Anlass hinaus gefangen. Wollte man noch einen Anachronismus anfügen, so müsste man hier fast schon einen Urahnen filmischer Sichtweisen vermuten. Anderes Beispiel der Überzeitlichkeit: Eine schreiende Frau, die ob der Schlachtengreuel verzweifelt die Arme in die Luft reckt, soll in weite historische Ferne gewirkt und Picasso zu einem Motiv seines Antikriegsbildes „Guernica“ angeregt haben.
Der Wuppertaler Reigen vielfach aufregender Bilder reicht bis in die Londoner Zeit. „Krieg und Frieden“ ist leider nur als Reproduktion zu sehen. Da fällt die Weisheitsgöttin Minerva dem Kriegsgott Mars entschieden in den Arm. Eine buchstäblich ergreifende Utopie in gewaltsamen Zeiten.
Peter Paul Rubens. Von der Heydt-Museum, Wuppertal (Elberfeld, Turmhof 8). Vom 16. Oktober 2012 bis zum 28. Februar 2013. Geöffnet Di/Mi 11-18, Do/Fr 11-20, Sa/So 10-18 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, Familie 24 Euro. Katalog 25 Euro.
Info-Hotline: 0202/563-2626
Internet: www.von-der-heydt-museum.de
Am Rande: Selbstverständlich hat das Wuppertaler Museum nicht alle Wunschbilder ausleihen können. Bemerkenswert vor allem, dass der Fürst von Liechtenstein, der eine der größten privaten Rubens-Kollektionen besitzt, alle Verhandlungen strikt verweigerte – wegen der von deutschen Behörden angekauften CDs und DVDs mit Daten von Steuersündern…
geschrieben von Eva Schmidt | 6. September 2013
Im schwarzen Wasser schwimmt vereinzelt bunter Müll, ein wenig unter der Oberfläche, es könnten auch fernöstliche Blumen sein. Das Innere des Flüssiggas-Tanks in Katar ist gleißend golden, der Teppich der Düsseldorfer Kunsthalle dagegen einfach nur grau.
Doch möchte man gerne mit der Hand darüber streichen, um zu testen, ob er sich vielleicht rau anfühlt, aber das geht nicht: Denn der Teppich ist bloß fotografiert, der Fluss in Bangkok und der Gas-Tank sind auf großformatigen Fotos zu sehen. Sie zeigen die Dinge, wie sie sind, aber nicht, wie wir gewohnt sind, sie zu sehen. Das macht sie magisch: Höchste Realität schlägt in größtmögliche Poesie um. Der Magier heißt Andreas Gursky; ebenso wie die neueste Ausstellung im Museum Kunstpalast in Düsseldorf.
Man müsste nun referieren über die Becher-Schule, Gurskys Zeit an der Folkwang-Universität und der Düsseldorfer Kunstakademie, deren Professor er heute ist. Man müsste sprechen über „Struffsky“, unser Synonym für Thomas Struth, Thomas Ruff und Andreas Gursky, das wir spaßeshalber verwendeten, wenn wir eine der Ausstellungen der „Düsseldorfer Photoschule“ besuchten. Doch im Grunde kann man all dies ohnehin im Katalog nachlesen. Sinnvoller ist es, einfach in die Ausstellung zu gehen. Denn hier mischen sich neue Werke wie die „Bangkok-Serie“ oder „Katar“ mit früheren Arbeiten wie „99 Cent“ von 1999, das die erschlagende Billigwarenfülle in einem amerikanischen Supermarkt zeigt oder Angler am grünen Ufer der Ruhr in Mülheim 1989. Mein Lieblingsbild in diesem Zusammenhang ist der dreiflämmige Gasherd von 1980, wie er so unscheinbar in seiner Ecke steht – ein Küchenmöbel, sonst nix.

Bangkok IX, 2011, Copyright: Andreas Gursky / VG Bild-Kunst, Bonn 2012
Bewusst herrscht bei der Hängung weder Chronologie noch Themenzwang, das macht die Ausstellung zu einer Entdeckungsreise, einer Art Memory-Spiel, welches Foto wohl zu welchem gehören möge. Schnell ausgemacht sind die C-Prints der Ocean-Serie von 2010 in ihrem unendlichen Blau und der Aufforderung zum Inselraten – ich habe Lanzarote gefunden. Außerdem das Publikum eines Madonna-Konzerts und ein Prada-Schuhregal. Nebst Börsen-, Flughafen- und Rennstrecken-Bildern, die auf den ersten Blick realistischer scheinen als sie sind. Doch ihre digitale Bearbeitung bzw. Komposition gilt nicht umsonst als das Stilmittel Gurskys, das ihn in die Nähe der Malerei rückt. Mit der beschäftigt er sich in der „Ohne Titel“-Serie, zu der nicht nur das Foto des Teppichs der Kunsthalle gehört, sondern auch extreme Nahansichten von Gemälden von Vincent van Gogh oder John Constable oder das bekannte Foto von einem Gemälde Jackson Pollocks im Museum of Modern Art in New York.
Nun also Bangkok: Schwarzes Wasser, das ein Geheimnis birgt. Schwarzes Wasser, das aussieht wie gemalt, das grün wird, die Lichtreflexe nahezu weiß. Nach dem tiefen Blau des Ozeans, auf dessen Inseln wir in Vogelperspektive schauen, folgt jetzt die Umkehrung in die extreme Nahansicht, doch ohne die Oberfläche zu durchdringen. Nur in Schemen sehen wir Fetzen des Wohlstandsmülls vorbeigurgeln. Vielleicht hat jemand im Supermarkt eine Kekspackung aufgerissen. Sie hat 99 Cent gekostet…
Bis 13. Januar 2013 im Museum Kunstpalast, Düsseldorf
Internet: www.smkp.de

Katar, 2012, Copyright: Andreas Gursky / VG Bild-Kunst, Bonn 2012
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
Von Zeit zu Zeit schwingt sich das Essener Museum Folkwang immer mal wieder auf, mit kräftiger Sponsorenhilfe die Spitzenposition im Ruhrgebiet zu behaupten. Das geht schon seit Jahrzehnten so. Diesmal heißt das Ereignis (eigentlich wenig originell) „Im Farbenrausch“.
So oder ähnlich tauft man eben jene populären Ausstellungen, deren Macher mit Besucherzahlen weit oberhalb der 100 000 kalkulieren können. Sei’s drum. Dass sich die Farbe irgendwann vom umrissenen Gegenstand gelöst hat und vorwiegend Stimmungsträger wurde, gehört zum bildnerischen Basiswissen. Hier kann man’s vielfach sinnlich nachvollziehen und dabei ins Schwärmen geraten.
Davon abgesehen, eröffnet sich immerhin die Chance, Teile des Essener Eigenbesitzes im ungewohnten Kontext neu zu bewerten. Denn 24 von 153 Exponaten gehören zum Essener Fundus. Die Schau, die sich im Kern auf die Jahre 1905 bis 1911 beschränkt, ist also sozusagen in den Beständen verankert. Deren Anfangsgründe gehen bekanntlich auf den Hagener Mäzen Karl Ernst Osthaus zurück, der sehr vorausschauend Arbeiten seiner Zeitgenossen gesammelt hat und dessen Kunstschätze 1922 nach Essen wanderten.
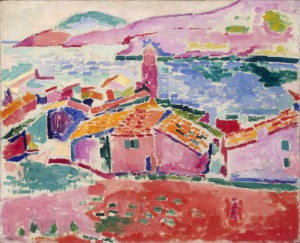
Henri Matisse: "Les toits de Collioure / Die Dächer von Collioure", 1905 (Staatliche Eremitage, St. Petersburg / © Succession H. Matisse / VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / © Foto: Staatliche Eremitage, Vladimir Terebenin, Leonard Kheifets, Yuri Molodkovets)
Der Untertitel lautet „Munch, Matisse und die Expressionisten“, es werden also zwei geniale Anreger namentlich genannt. Etwas wolkig sprechen die Kuratoren (Sandra Gianfreda, Mario-Andreas von Lüttichau) von geistiger Verwandtschaft und daraus entspringender subjektiver Empfindung, welche die Bildsprache(n) geprägt hätten.
Punktuell oder auch streckenweise gibt es tatsächlich frappierende Anklänge. Marianne von Werefkin hat mit „Die Landstraße“ (1907) ganz offenkundig Munch nachgeeifert. Heckels „Die Elbe bei Dresden“ scheint aus dem Geiste Van Goghs zu fließen, Pechsteins „Seine-Brücke“ sich den Anstößen der Fauves zu verdanken. Überhaupt hat besonders Pechstein hier einige grandiose Auftritte, etwa mit „Sitzendes Mädchen“ oder „Liegendes Mädchen“, beide von 1910.

Edvard Munch: "Sitzender Akt auf dem Bett", 1902 (Staatsgalerie Stuttgart / © The Munch Museum / The Munch Ellingsen Group / VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / © Foto: Staatsgalerie Stuttgart)
Doch vielfach kann man auch und gerade die Unterschiede besichtigen. Vor allem Munch hebt sich von allen anderen deutlich ab. Zwar wird das eine oder andere seiner Sujets etwa von deutschen Expressionisten aufgegriffen, doch Bildsprache und Atmosphäre sind unvergleichlich.
Eine finanziell derart gut gepolsterte, eher auftrumpfende und prunkende als feinjustierte und konzentrierte Ausstellung (der RWE-Konzern tritt als Sponsor an) wartet selbstverständlich mit vielen Berühmtheiten, etlichen Schauwerten und strahlender Schönheit auf. Etwas name dropping, beinahe schon lexikalisch: Munch, Matisse, Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Derain, Signac, de Vlaminck, Braque, Kandinsky, Jawlensky. Dazu deutsche Künstler wie Kirchner, Pechstein, Heckel, Schmidt-Rottluff, Marc, Nolde, Münter. Wenn das nichts ist…

Ernst Ludwig Kirchner: "Mädchen unter Japanschirm", um 1909 (Kunstsammlung NRW, Düsseldorf / © Foto: Walter Klein, Düsseldorf)
Allein was hier an Aktbildern, Badenden, Damen mit Hut oder auch an Fluss- und Bootsbildern zusammengetragen wurde, nötigt Bewunderung ab. Die Schar der hochmögenden Leihgeber reicht bis Canberra (Australien), auch gibt es noch nie öffentlich gezeigte Raritäten aus Privatbesitz zu sehen, so etwa Kirchners „Torhaus“ (1910).
Die Hängung folgt mal chronologischen, mal thematischen oder auch biographischen Ansätzen. In verschiedenen Grautönen gehaltene Säle, teils schwelgend und nicht allzu trennscharf benannt („Aufbruch zur Farbe“, „Orgie der reinen Farbtöne“, „Die Suche nach dem Beständigen“, „Streben nach künstlerischer Synthese“), bündeln, gliedern oder verstreuen die Werke. Da wird unterwegs zwischen erlebtem und ersehntem Arkadien unterschieden, als ergäbe das auf dem Felde der Kunst einen Sinn. In einem finalen Bereich werden kurzerhand Stillleben und Figurenporträts miteinander präsentiert, als hätten sie sonst nirgendwo mehr Platz gefunden.

Erich Heckel: "Badende am Waldteich", 1910 (Museum Folkwang, Essen, Dauerleihgabe aus Privatbesitz, seit 2005 (© Nachlass Erich Heckel, Hemmenhofen / © Foto: Museum Folkwang)
Natürlich haben sich Größen wie Matisse, Munch und andere damals weithin ausgewirkt. Wer sie überhaupt nicht rezipiert hätte, wäre ein Ignorant gewesen. Übrigens können die „jungen Wilden“ des deutschen Expressionismus im internationalen Vergleich recht gut bestehen, sie haben das Spektrum des Kontinents bereichert, wenn auch nicht so grundlegend wie die Franzosen.
Beim Rundgang wird man auch finden, wie sehr sich nördliches vom südlichen Licht abhebt und die Bilder der Deutschen mitbestimmt. Ein banaler, jedoch oft unabweislicher Befund. Hin und wieder wird man gar versucht sein, die in Deutschland vorherrschende Malweise „kantiger“ und weniger fließend zu finden, womit man bei Uralt-Klischees angelangt wäre. Vorsicht also mit vorschnellen Schlüssen. Lieber den prächtigen Parcours noch einmal absolvieren, den Katalog studieren und jeden Künstler, jedes Bild auch für sich selbst gelten lassen. Um das Einzigartige zu bewahren, was beim Vergleichen zu entgleiten droht.

Max Pechstein: "Flusslandschaft", um 1907 (Museum Folkwang, Essen / © 2012 Pechstein, Hamburg/Tökendorf / © Foto: Museum Folkwang)
„Im Farbenrausch“ Munch, Matisse und die Expressionisten. Museum Folkwang, Essen, Museumsplatz 1. Bis 13. Januar 2013. Geöffnet Di-So 10-20, Fr 10-22.30 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 12 (ermäßigt 7) Euro, Katalog 35 Euro.
Internet:
http://www.museum-folkwang.de
http://www.folkwang-im-farbenrausch.de
P. S.: Wer der klassischen Moderne noch mehr auf den Grund gehen will, reist weiter nach Köln und besucht im Wallraf-Richartz-Museum die Ausstellung „Mission Moderne. Die Jahrhundertschau des Sonderbundes“ (bis 30. Dezember 2012), Katalog 39,90 Euro.
geschrieben von Frank Dietschreit | 6. September 2013
Seit 10 Jahren verteidigen deutsche Truppen unsere Freiheit am Hindukusch. Doch der Einsatz der Bundeswehr ist hierzulande umstritten und wird mit jedem toten Soldaten in Frage gestellt. Ob das Buch, das jetzt unter dem Titel „Wave and Smile“ erschienen ist, eine Argumentationshilfe in der Debatte um das Für und Wider des Bundeswehr-Einsatzes sein kann, scheint auf den ersten Blick zweifelhaft. Denn der Autor und Zeichner Arne Jysch thematisiert den Afghanistan-Krieg mit den Mitteln der Graphic Novel und der Ästhetik von Comics.
„Wave and Smile“ („Winken und Lächeln“), das war lange Zeit die Strategie der ISAF-Truppen in Afghanistan, wenn sie ihre militärischen Camps verließen und sich unters afghanische Volk mischten: Das hat sich als ziemlich naiv und tödlich erwiesen, denn die Taliban sind längst nicht besiegt. Im Gegenteil. Die Sicherheitslage hat sich dramatisch verschlechtert, auch im nördlichen Afghanistan, in der Region um Kunduz, also dort, wo die Geschichte der Graphic Novel spielt und die Bundeswehr stationiert ist, die sich heute nur noch in gepanzerten Wagen und schwer bewaffnet vor die Tür wagt und ein ständiges Ziel von terroristischen Attacken ist. Schon der Titel „Wave and Smile“ ist ein ironischer Abgesang auf die verlogene Kriegsstrategie und ein erster Hinweis, dass da etwas schief läuft mit der Bundeswehr in Afghanistan.
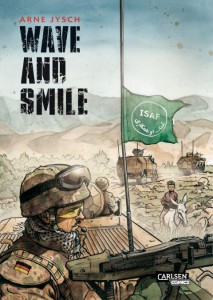
Arne Jysch hat sich eine dramatische, von Tod und Terror, von Liebe und Verrat handelnde Geschichte ausgedacht. Die drei Hauptpersonen, Hauptmann Chris, Hauptfeldwebel Marco und Fotoreporterin Anni, erdulden die Tristesse und Einsamkeit des Alltags im Bundeswehrcamp in Kunduz und werden bei ihren Einsätzen in blutige Kampfhandlungen verwickelt. Bei einem Gefecht wird Marco von den Taliban entführt, Chris traumatisiert und zur Heilung nach Deutschland geschickt. Doch dort wartet nur die Scheidung von seiner Frau auf ihn und die quälende Frage, was aus seinem Freund geworden sein mag. Also entschließt sich Chris, als Privatperson nach Afghanistan zurückzukehren und auf eigene Faust und mit Hilfe von Fotografin Anni nach Marco zu suchen.
Jysch erzählt in der Bildsprache eines realistischen Comics: die Zeichnungen der Soldaten, der Waffen, der Saufgelage im Camp und des Verhaltens Kampf wirken authentisch, jede Figur hat eine eigene Kontur, man merkt deutlich: Jysch hat sich Rat geholt bei Fotografen und Filmemachern. Auch hat er wohl viele Informationen bekommen von der Presseabteilung der Bundeswehr. Die immer wieder eingeflochtenen Debatten über die Kampfstrategien und Kriegsziele versuchen ein möglichst großes Argumentationsspektrum abzudecken und verzichten auf billige Phrasen. Der Comic versammelt ca. 1000 einzelne Bilder, bietet knallige Sprechblasen, deftige Wortfetzen und Lautmalereien. Vor allem wenn geschossen wird und Bomben krachen, fliegen riesige Buchstaben mit viel Krawomm, Tatatat und Zischzasch durchs Bild.
Aber eine Auftragsarbeit oder ein Gefälligkeitsbuch ist es nicht, denn der Einsatz der Bundeswehr und die Gesamtstrategie der ISAF wird in all ihren Widersprüchen und Ungereimtheiten geschildert. Wer sich als potentieller Rekrut am Ballern labt, kommt zwar auf seine Kosten, muss aber mit ansehen, dass er als Soldat für politisch zweifelhafte Zwecke missbraucht und verheizt wird. Und wenn Hauptmann Chris einem an seiner Mitarbeit interessierten Amerikaner entgegnet: „Nein, Ihren Krieg, den dürfen Sie ohne mich verlieren“, ist die Anti-Kriegs-Botschaft des Comics auch mehr als deutlich. Jysch hat kein geschmackloses Rekrutierungspamphlet verfasst und gezeichnet, sondern einen durchaus kritischen, wenn auch nicht klischeefreien Comic zum Krieg in Afghanistan. Auf welche Leserschaft er abzielt, ist allerdings ein kleines Rätsel.
Arne Jysch: „Wave and Smile“. Carlsen Verlag, Hamburg. 208 S., 24,90 €
geschrieben von Katrin Pinetzki | 6. September 2013

Kunst zum Kichern bei der Ausstellung "12 Rooms" im Essener Folkwang Museum.
Eine Kinder-Jury begleitet die Ruhrtriennale und verleiht zum Ende des Festivals jeder Produktion einen Preis – die Awards heißen „Die beste Hose“, „Die beste Pose“ oder „Das verrückteste Stück“. Sie werden Abend für Abend wie Superstars behandelt: Chauffeur, roter Teppich, Blitzlichtgewitter. Über die Künstler, die Stücke, die Hintergründe wissen die Kinder – nichts. Was soll das sein: Kulturvermittlung? Oder tatsächlich die angekündigte „kritische Prüfung zeitgenössischer Kunst“ durch eine „unverbildete Jury“? Und: Kann das gut gehen?
Bochum, 17. August, kurz vor 20 Uhr. Internationales Stimmengewirr im Foyer der Jahrhunderthalle. Aus ganz Deutschland und dem Ausland sind Opernliebhaber angereist, um „Europeras 1 & 2“ zu erleben. Die Gelegenheit ist selten, seit der Uraufführung 1987 war John Cages Opern-Dekonstruktion kaum mehr zu sehen. Vom Parkplatz bis zur Halle stehen Verzweifelte auf der Suche nach Karten – alle Termine sind ausverkauft. Es wird eine Wahnsinns-Produktion, die den Sängern und Musikern alles abverlangt.
Zwei Vans fahren vor; selbstmalte Glitzer-Schilder weisen sie als „VIP“-Fahrzeuge aus. Kaum sind die Mitglieder der Kinderjury, heute Abend alles Mädchen, aus den Autos geklettert und unter dem Applaus der Umstehenden verlegen über den roten Teppich in die Jahrhunderthalle gegangen, werden ihnen Mikrofone unter die Nase gehalten. „Was erwartest du dir heute Abend?“, will eine Radio-Reporterin wissen. „Viel! Dass es nicht langweilig wird. Und dass es … spannend wird“, antwortet ein Mädchen. Kurz vor Beginn der Vorstellung macht Jana Eiting von „Mammalian Diving Reflex“ letzte Ansagen. Die kanadische Künstlergruppe wurde von der Ruhrtriennale für das Kinderjury-Projekt engagiert. „Also, wenn es langweilig wird, und das kann passieren, dann beschäftigen wir uns irgendwie, ihr könnt ja was malen“, sagt sie. Als der Zuschauerraum schon bis auf den letzten Platz gefüllt ist, nehmen die Mädchen unter wohlwollendem Applaus des Publikums in der ersten Reihe Platz.
Gelsenkirchen, 27. Juni, 8.30 Uhr. „Wir wollen mal ein bisschen über Kunst reden“, sagt Jana Eiting. Sie steht in einem Projektraum der Gesamtschule Ückendorf in Gelsenkirchen, um sie herum 21 Schülerinnen und Schüler, die sich für das Kinderjury-Projekt gemeldet haben. Die Gelsenkirchener Schule ist eine von dreien, die am „Children’s Choice Award“ teilnehmen; auch in Bochum und Duisburg wird es noch Treffen geben. Insgesamt sind um die 60 Kinder dabei; jedes wird sich ein paar Produktionen der Ruhrtriennale anschauen. Jury-Sitzungen gibt es nicht, die Preisträger werden anhand der Evaluationsbögen ausgezählt, die jedes Kind am Ende einer Show ausfüllen wird. Doch das wissen die Kinder noch nicht, der Workshop heute ist der erste.
In die 5. oder 6. Klasse gehen die Kinder, die im Stuhlkreis sitzen und sich immer wieder vom Kameramann der Ruhrtriennale ablenken lassen. Vom Alter her sei für das Jury-Projekt „alles zwischen Milchzähnen und Schamhaaren“ okay, hatte Darren O’Donnel, der künstlerische Direktor der Gruppe, gesagt. Das hat in diesem Fall nicht ganz geklappt. Einige stecken schon schwer in der Pubertät, offenbar mussten sie die eine oder andere Klasse wiederholen. Die Gesamtschule Ückendorf hat trotz guter Ausstattung und eines engagierten Kollegiums keinen besonders guten Ruf bei bildungsorientierten Eltern, was vermutlich allein daran liegt, dass Kinder deutscher Eltern dort seit langem in der Minderheit sind. So auch im Jury-Workshop. „Wir machen soziale Kunst“, sagt Jana Eiting und fragt, was das wohl bedeutet: sozial. „Mit Geld irgendwas?“, schlägt ein Schüler vor. „Sozialamt!“, fällt einem anderen ein. Was eine Jury ist, das muss den Kindern niemand erklären. „Deutschland sucht den Superstar“ kennen nun wirklich alle. „Sehen wir auch Stars?“, will ein Mädchen wissen. Als eine Mitarbeiterin des Mammalian Diving Reflex erzählt, dass sie in Kanada aufgewachsen sei, nicht allzu weit entfernt von Teenie-Schwarm Justin Bieber, da weichen zwei Mädchen nicht mehr von ihrer Seite. In der Pause muss sie Autogramme geben.

Roter Teppich für die Youngster-Jury der Ruhrtriennale.
Essen, 17. August, 12 Uhr. Die Ruhrtriennale eröffnet mit der Performance-Ausstellung „12 rooms“ im Museum Folkwang. Damien Hirst, Marina Abramivic, Jon Baldessari sind mit ihren Arbeiten vertreten – doch die Stars der Eröffnung sind die Kinder. Vorfahrt mit dem Van, roter Teppich, Applaus – das volle Aufmerksamkeitsprogramm. Auch Darren O’Donnel, der künstlerische Leiter von „Mammalian Diving Reflex“, ist dabei. Er hat „The Children’s Choice Awards“ auf Festivals in vielen Städten auf der Welt initiiert und begleitet, und er ahnt wohl, wie die Kinder sich fühlen, wenn sie plötzlich in einer fremden Stadt vor einem Kulturpalast inmitten fein gekleideter Menschen stehen. Mit sicherem Blick geht er auf die schüchternsten Schüler zu, steckt ihnen eine Löwenzahn-Blume hinters Ohr, stellt seine Kaffeetasse auf ihren Köpfen ab, bringt sie mit Faxen zum Lachen. Schnell ist die Scheu dahin, nur ein Mädchen klammert sich an den Arm ihres Lehrers. Schon bald bewegen sich die Kinder alleine und sicher durch die Schau, öffnen Türen, machen sich Notizen.
Während die erwachsenen Vernissage-Besucher zumeist zurückhaltend an den Turen der zwölf Kunst-Kojen stehen bleiben und erst einmal beobachten, sehen die Schüler die Live Art als eine Art Streichelzoo: Sie gehen nah ran an die Statisten, fassen sie an, stellen ihnen Fragen, lachen. Zögerlich treten nun auch die erwachsenen Besucher näher, einige machen es den Kindern nach.
Diese Schüler waren noch nie in einem Kunstmuseum; was denken sie, wenn das Kunstwerk aus einem Mann in KFOR-Uniform besteht, der in der Ecke steht und die Wand anstarrt? „Cool“, sagt Hasan, „der Soldat hat mir am besten gefallen.“ Warum? „Ich mag Krieg.“ Später in seiner Pause erzählt der Soldat-Darsteller den Kindern, dass er tatsächlich ein Kriegsveteran ist. Der Künstler Santiago Sierra wolle, erklärt er, mit der Performance darauf aufmerksam machen, dass Kriegseinsätze für die Soldaten oft psychische Folgen haben. Dann dürfen die Kinder Fragen stellen. „Sind die Waffen schwer?“, fragen sie, und „Haben Sie schon mal jemanden erschossen?“
Bochum, 17. August, 20.05 Uhr. „Puh, geschafft“, sagt Samira, als sie endlich in der ersten Reihe Platz nimmt und ihre 1,5-Liter-Wasserflasche aus der Tasche packt, „das Schlimmste hab’ ich überstanden.“ Das Schlimmste: Der Walk über den roten Teppich, die Interviews, der Gang vor der Augen hunderter Zuschauer zum Sitzplatz. Jetzt heißt es nur noch, die Oper zu überstehen, zweieinviertel Stunde Neue Musik. Samira war noch nie im Theater. Sie hat sich schön gemacht und erwartet, schöne Dinge zu sehen. Sie wird nicht enttäuscht werden: Heiner Goebbels Inszenierung ist eine Materialschlacht, eine Show der Effekte, es gibt Tier-Masken, Rokoko-Kleider und Männer in Frauenkleidern, es brennt und schneit auf der Bühne, Kulissen werden hineingerollt oder von oben herabgelassen. „Bor!“ entfährt es Samira, als ein schwerer roter Samtvorhang unvermittelt vor einer Sängerin auf den Boden donnert. Nach einer Stunde kramt Samira ihr Notizheft hervor, beginnt zu schreiben – und hört nicht mehr auf. „Wie hat es mir gefallen“, schreibt sie als Überschrift oben aufs Blatt, und notiert: „Dass Männer und Frauen zusammen singen. Dass viele verschiedene Orte gezeigt werden. Dass man sieht, wie sie auf der Bühne arbeiten und aufbauen.“ Am Ende klatscht sie, bis ihre Hände weh tun. Anstrengend war es, langweilig, aber auch ein einzigartiges Erlebnis.
Nach der Vorstellung dürfen die Kinder noch Mezzosopranistin Karolina Gumos treffen. „Wir haben mehr als hundert Arien gesungen, habt ihr eine erkannt?“, fragt die Sängerin in ahnungslose Gesichter: Was bitte ist eine Arie? Dennoch hängen die Mädchen an den Lippen der Künstlerin, die mit Turm-Frisur und ausladendem Reifrock direkt vom Schlussapplaus zu ihnen geeilt ist.
Wenn die Jury-Kinder am 30. September auf großer Bühne ihre Awards vergeben, dann haben sie auf den teuersten Plätzen und unter exklusiven Bedingungen Kulturveranstaltungen erlebt. Sie wurden aus ihrem Klassenzimmer einmal ins große Kulturleben geschubst. Dass sie aber keine Erklärungen bekamen, dass es kein Lern-Ziel gab, dass Vor- und Nachbereitung komplett fehlten – das muss man erst einmal verdauen. „No education“ heißt die Programmlinie der Ruhrtriennale für junge Leute, keine Erziehung, keine Bildung. Das Konzept dahinter: Man kann Kultur nicht vermitteln, man muss sie einfach erleben. „Komplett informiert zu sein, hilft auch nicht immer“, sagt Darren O’Donnel, „manchmal bringt es einen vielleicht weiter, verwirrt zu werden.“ Wichtig sei, dass die Kinder ins Zentrum rücken. Dass sie dabei sind, anstatt in kindgerechte Veranstaltungen abgeschoben zu werden.
Samira wird also nach wie vor mit dem Namen „John Cage“ nichts anfangen können, und Hasan ist vielleicht enttäuscht, wenn beim nächsten Besuch in einem Kunstmuseum nur Plastiken und keine Soldaten in der Ecke stehen. Vielleicht, wahrscheinlich sogar war es auch ihr erster und einziger Ausflug in die Hochkultur. Kulturvermittlung ist „The Children’s Choice“ also nicht. Eine kritische Prüfung zeitgenössischer Kunst sicher auch nicht. Letztlich waren die Schüler Teil eines Kunstprojekts: So wie der Kriegsveteran für Santiago Sierra im Museum Folkwang die Wand anstarrt, so schaut Hasan für die Ruhrtriennale den Veteranen an. Sie werden ihre Erlebnisse vermutlich beide so schnell nicht vergessen.
Der Text erschien in der September-Ausgabe des Kulturmagazins K.WEST.
geschrieben von Werner Häußner | 6. September 2013

Ein Selbstbildnis Herbert Falkens aus dem Bestand des Museums am Dom Würzburg. Foto: Museum
Nein, mit „christlicher Kunst“, wie sie von frommen Vereinigungen betrieben wird, wollte Herbert Falken nichts zu tun haben. Von diesem Begriff hat er sich immer distanziert – obwohl er Priester der römisch-katholischen Kirche ist. Er malte auch wenig für Kirchen; die meisten seiner dunkel-grüblerischen, anspruchsvoll-anstößigen oder auch virtuos hingezeichneten Bilder und Grafiken hängen in Museen. Ein „Malerpriester?“ Nein. Aber ein Maler und ein Priester mit Herz und Seele. Zu beidem hat er sich berufen gefühlt, und darunter oft gelitten. Am 11. September wird Herbert Falken 80 Jahre alt.
1932 in Aachen geboren, kam Falken schon als Jugendlicher, dann über eine Lehre als Reklamemaler und über autodidaktische Studien zur Kunst. 1952 wurden Werke Falkens erstmals in einer Ausstellung im Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen gezeigt. Die Teilnahme an der Documenta VI (1977) machte ihn überregional bekannt.
Anlässlich seines Geburtstags wird der Maler, Grafiker und Zeichner mit zahlreichen Ausstellungen geehrt. Er gehört zu den prominenten deutschen Vertretern einer christlich inspirierten Kunst. Im Mittelpunkt steht der Mensch, in seiner Abgründigkeit, Verletzlichkeit, Größe und Hinfälligkeit: Auf der einen Seite Abbild Christi, auf der anderen der Erlösung bedürftig.
Herbert Falken ist Priester (1964 geweiht) und war lange als Seelsorger tätig, zuletzt in der Pfarrei St. Josef in Stolberg-Schevenhütte. Die Pfarrkirche besitzt einen Kreuzweg aus seiner Hand (1985) – und einen Zyklus von Glasfenstern von Georg Meistermann, den Falken nach dessen Tod 1990 weitergeführt hat. Heute lebt der Künstler nahe des langjährigen Wohnsitzes seines Freundes Heinrich Böll in Kreuzau-Langenbroich. Aus gesundheitlichen Gründen ist er nicht mehr künstlerisch aktiv.

In der Katholischen Akademie in München zu sehen: Herbert Falken, "Ohne Titel" (2009). Foto TreitnerDesign/Katholische Akademie Bayern
Am 11. September 2012 findet um 19 Uhr die Vernissage einer Ausstellung in der Katholischen Akademie Bayern statt. Bis 13. November sind im Kardinal Wendel Haus im Münchner Stadtteil Schwabing grafische Werke zu sehen. Parallel dazu eröffnet die Galerie der Deutschen Gesellschaft für Christliche Kunst ihre neuen Galerieräume in der Münchner Türkenstraße – gegenüber der Pinakothek der Moderne – am 14. September mit einer Ausstellung „Herbert Falken. Malerei und Zeichnungen“.
Ab 15. September zeigt „Kolumba“, das Kunstmuseum des Erzbistums Köln, im Rahmen seiner 6. Jahresausstellung dreizehn großformatige Bilder aus 25 Schaffensjahren Falkens im zentralen Ausstellungsraum 13. Die neue Ausstellung „Art is Liturgy. Paul Thek und die Anderen“ widmet sich vor allem dem 1988 gestorbenen Amerikaner Paul Thek. Falkens Bilder sind eine der Werkgruppen, die sich im Dialog mit Theks Arbeiten dem Verhältnis von Liturgie und Kunst nähern. Andere gezeigte Künstler sind Rebecca Horn, Chris Newman und der Kölner Künstler Michael Buthe (1944 bis 1994).

Eine Studie Falkens zur unvollendeten "Pietá Rondanini" Michelangelos. Foto: Museum Kolumba Köln
Das Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen hat eine Reihe bedeutender Schöpfungen Falkens in seinem Bestand, unter anderem den 1968/69 entstandenen Zyklus „Scandalum Crucis“. Am 16. September gibt der Aachener Kunstverein im Kaminsaal des Museums einen Empfang zu Ehren des Jubilars. Das Bistum Aachen ehrt seinen ehemaligen Beauftragten für Kunst mit einer Ausstellung in der Bischöflichen Akademie in Aachen. Dort wird ab 4. November neben anderen Werken aus dem Besitz der Bildungseinrichtung der Zyklus „Apokalypse“ aus dem Jahr 1961 gezeigt. Er gilt als einer der Hauptwerke von Herbert Falken.
Auch die Akademie Franz Hitze Haus in Münster zeigt Arbeiten von Herbert Falken in einer Ausstellung, die am 27. November, 20 Uhr, eröffnet wird. Sie zeigt Arbeiten auf Papier aus den letzten dreißig Jahren.
Bereits seit Juni ist im Leopold-Hoesch-Museum und Papiermuseum Düren eine Hommage an Herbert Falken zu sehen. Dort hatte er schon 2007 aus Anlass der Verleihung des Kunstpreises des Kreises Düren eine Einzelausstellung. Die künstlerischen, theologischen und autobiografischen Bedeutungslinien, die sich in Falkens Werk kreuzen, sind Thema eines „Museumsdialogs“ im Leopold-Hoesch-Museum am 8. November, 19 Uhr, mit Museumsdirektorin Renate Goldmann.
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
Unter dem Titel „Mannsbilder“ zeigt der Kreis Unna jetzt im idyllisch gelegenen Haus Opherdicke 110 Kunstwerke, auf denen Männer dargestellt werden. Die Schau folgt einer ähnlich gelagerten namens „Frauenansichten“ mit Bildern, auf denen… Richtig. Das klingt nicht gerade nach ausgefeiltem oder angestrengtem Konzept.
Doch es ist wohl ein gangbarer Weg, will man Schneisen durch eine Kunstsammlung schlagen, mit der die Besucher noch nicht vertraut sein können. Der Kreis Unna möchte die Sammlung Brabant dauerhaft an sich binden. Verhandlungen mit dem Wiesbadener Sammler Frank Brabant über eine Stiftung sind offenbar auf gutem Wege, auch das Land NRW ist eingebunden. Sukzessive wird gezeigt, was es mit Brabants Ankäufen auf sich hat. 2013 sollen noch Neue Sachlichkeit bzw. Kritischer Realismus mit Dix, Grosz und vielen anderen an der Reihe sein, 2014 kommt das Konvolut gegenstandsloser Kunst in Betracht.

Karl Hofer, Selbstbildnis, 1928, Öl auf Leinwand (Bild: Katalog/Sammlung Brabant)
Brabants Kollektion umfasst mittlerweile rund 480 Stücke und wächst permanent weiter. Auch etliche große Namen wie Beckmann, Jawlensky oder Pechstein sind vertreten. Doch vorwiegend sammelt Frank Brabant Arbeiten des Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit aus der „zweiten Reihe“, sprich: von Künstlern, die nicht so bekannt geworden sind, es meistenteils nicht werden konnten. Viele von ihnen wurden in der NS-Zeit verfemt und konnten sich auch nach dem Krieg – sofern sie überlebt hatten – nicht auf einem Markt durchsetzen, der praktisch nur noch Abstraktion gelten ließ.

Immanuel Knayer, "Arbeiter bei der Frühstückspause", 1925, Öl auf Leinwand (Bild: Katalog)
Eine „verschollene Generation“ hat man sie genannt. Es ist nur recht und billig, dass man an sie erinnert und ihre Bilder zeigt. Doch nicht jedes Werk und jeder Künstler müssen nachträglich um jeden Preis aufgewertet werden. Darum geht es ja auch nicht.

Conrad Felixmüller "Bildnis Hermann Kühn", 1923, Öl auf Leinwand (© VG Bild-Kunst, Bonn 2012)
Überdies ist es spannend zu verfolgen, wie Brabant mit relativ begrenzten Mitteln gleichwohl eine ordentliche bis beachtliche Sammlung mit nur wenigen Fehlgriffen aufbaut, indem er etwa antizyklisch kauft, frühzeitig auf unterschätzte Richtungen aufmerksam wird und sich längst nicht nur auf Ölbilder kapriziert, sondern Schwerpunkte bei der nicht ganz so kostspieligen Druckgraphik und den Arbeiten auf Papier setzt. Keine Frage: Auch Aquarelle, Holzschnitte, Lithographien oder Radierungen können exzellent sein.
„Mannsbilder“ also. Ein fast schon flapsiger Titel angesichts einiger Kriegs- und Elendsdarstellungen, die auch dazugehören (z. B. Immanuel Knayer „100% erwerbsunfähig“, ca. 1925). Es zählt auch das eine oder andere Paarbild hinzu, welches folglich auch bei den „Frauenansichten“ hätte hängen können. Ja, ein Werk ist sogar von dort hierher gewandert, denn zwischenzeitlich hat man herausgefunden, dass William Straubes Pastell von 1913 keine Frau, sondern den Maler Helmut Macke zeigt.

Karl Hofer, "Die törichten Männer", 1940, Öl auf Leinwand (Bild: Katalog/Sammlung Brabant)
Die Ausstellung der Frauenbilder hatte noch einen Untertitel getragen („Mutter, Muse, Femme Fatale“). Auf derlei Zuschreibungen verzichtet man diesmal. Generell wird hier allerdings in groben Zügen erkennbar, dass das Bild des Mannes als Held oder Beherrscher zusehends im Schwinden begriffen war. Das Maskuline steckt tief in der Krise, ist vielfach gezeichnet von Alter, Krankheit, Todesnähe oder auch unfreiwilliger Lächerlichkeit. Symptomatisch Karl Hofers Bild „Die törichten Männer“ (1940), ein Quartett, das nur noch unbeholfen groteske Posen einnimmt.
Geht man mit dem Sammler durch die Ausstellungsräume, hält der Autodidakt keine hochgestochenen kunstgeschichtlichen Vorträge, auch sinniert er nicht über leitende Ideen. Zu fast allen Künstlern fallen ihm jedoch prägnante Lebensgeschichten ein, zumeist sehr betrübliche bis hin zu Verfolgung, Wahnsinn und Freitod. All die Schattierungen menschlichen Unglücks… Auch das ist ein legitimer Zugang zur Kunst, ein Anstoß, sich mit einzelnen Malern eingehend zu befassen. Zu einem eher unscheinbaren, spätimpressionistischen Kinderbildnis im Kleinformat von Louis Valtat („Enfant“, 1912) bemerkt Brabant, es sei ein Lieblingsbild von Greta Garbo gewesen. Beinahe schon ein boulevardesker Ansatz. Aber bitteschön, warum nicht? Wenn es der Kunstfindung dient.

Oskar Kokoschka, Walter Hasenclever, 1918, Lithographie auf Papier (Bild: Katalog/Sammlung Brabant)
Intensivere Studien mag man vor den zahlreichen (Selbst)-Porträts betreiben. Man kann gar Max Liebermanns Selbstbildnis aus den 20er Jahren mit Conrad Felixmüllers Liebermann-Bildnis von 1926 vergleichen. Oder man geht solchen speziellen Fragen nach: Wie hat Kafkas heute unbekannter Freund Friedrich Feigl gemalt? Und wie sieht ein surrealistisches Bild von Michael Endes Vater Edgar („Die aus der Erde Kommenden“, 1931) aus? Doch Spekulationen, die über allgemein phantastische Anregungen für den Sohn hinausgehen, die sollte man sich füglich nicht erlauben. Dies ist dies und das ist das.
„Mannsbilder“. Die Darstellung des Mannes in der Klassischen Moderne. Werke aus der Sammlung Brabant. Ab 2. September (Eröffnung 11.30 Uhr) bis 25. November 2012. Haus Opherdicke, Dorfstraße 29, Holzwickede (Tel. 02301/918 39 72). Geöffnet Di-So 10.30-17.30 Uhr. Eintritt 4 Euro, Familie 8 Euro, Jahreskarte 20 Euro. Katalog 24 Euro.
Ergänzende Informationen:
Haus Opherdicke hat im ersten Jahr als Ort der Kunst immerhin etwa 15000 Besucher angezogen.
Zum Vergeich: Die zweite Kunststätte des Kreises Unna, das Schloss Cappenberg (Selm), verzeichnete im selben Zeitraum rund 50000 Besucher.
Beim bisher kostenlosen Zutritt zu den Cappenberger Ausstellungen wird es wohl nicht mehr lange bleiben. Das sagt der Kämmerer und Kulturdezernent des Kreises, Rainer Stratmann. Opherdicke nimmt schon jetzt einen Obolus.
Rund um das Haus Opherdicke, ohnehin schon ein naturnahes Ausflugsziel, soll nach und nach ein Englischer Garten entstehen.
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
In Hagen kann man jetzt malerischen Energieströmen nachspüren – zwischen Fließen und Stocken, spontaner Bewegung und Innehalten der Linienführung, zwischen schützender Versiegelung und vehementer Durchbrechung der Bildoberflächen. Von den zahllosen weiteren Nuancen gar nicht zu reden.
Der Ausstellungsanlass ist gewichtig: 100 Jahre alt wäre der aus Hagen stammende Maler Emil Schumacher (1912-1999), ein Künstler von anerkanntem Weltformat, am 29. August geworden. Ursprünglich hatte man in seiner Himatstadt eine umfangreiche Retrospektive ausrichten wollen, die sich aufs Emil-Schumacher-Museum und das benachbarte Osthaus-Museum erstreckt hätte.

Emil Schumacher "Temun" (1987), Öl auf Holz (Emil Schumacher Stiftung, Hagen / © VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / Emil Schumacher)
Dann aber, so Emil Schumachers Sohn Ulrich (langjähriger Leiter des Bottroper Museums, dann spiritus rector des Emil-Schumacher-Museums), sei man zu der Einsicht gelangt, dass eine solche Werkschau einigermaßen unsinnig wäre. Denn das nun von Rouven Lotz geleitete Haus zeigt ja ohnehin unentwegt Schumacher-Bestände vor, wenn auch sukzessive und in wechselnden Zusammenhängen.
Nun also sind ausgewählte Bilder Schumachers im internationalen Vergleich mit Werken einiger Zeitgenossen zu sehen. Der Titel geht auf ein abgewandeltes Schumacher-Zitat zurück: „Malerei ist gesteigertes Leben“. Die von Gastkurator Prof. Erich Franz eingerichtete Schau konzentriert sich auf 62 Arbeiten. Hochkarätige Künstlerliste: Außer Schumacher stehen darauf Jean Dubuffet, Lucio Fontana, Franz Kline, Willem de Kooning, Robert Motherwell, Emil Nolde, Pierre Soulages, Antoni Tàpies, Cy Twombly, Emilio Vedova und Wols. Und noch ein paar weitere Namen. Dies und das reichhaltige Beiprogramm sind nur mit Sponsoren möglich, die der Katalog getreulich verzeichnet.

Emil Schumacher "Documenta II", 1964, Öl auf Leinwand (Osthaus-Museum, Hagen / © VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / Emil Schumacher)
Kurator Franz vertraut darauf, dass auch Menschen ohne sonderliche Kunstkenntnis hier manche Zusammenhänge erkennen werden, weil die Formen für sich selbst sprechen. Doch man muss wohl schon einige Seherfahrungen mitbringen, um mit der nötigen Feinheit unterscheiden zu können. Wer etwa die Urkräfte eines Wols-Bildes mit jenen vergleichen will, die bei Emil Schumacher walten, sollte möglichst kein Museumsneuling sein. Andererseits ist es mit elaboriertem Kunstwissen allein nicht getan. Hier ist – vielleicht mehr als sonst – auch einlässlich emotionales Schauen gefragt.
Emil Schumacher hat die scheinbar urwüchsig „wilde“ Linien-Dynamik immer wieder ganz bewusst mitten im Schwung angehalten oder jäh umgelenkt, weil ihm ungehemmte Spontaneität nicht geheuer war. Trotzdem gibt es laut Erich Franz „keine ruhige Stelle in seinen Bildern“. Er wollte den Betrachter sinnlich und existenziell berühren, ja mit der Materialität des Farbauftrags gleichsam anspringen. Darf die Linie nicht frei fließen, sondern muss sich mühsam Wege bahnen, muss sie Hindernisse und Widerstände überwinden, so resultiert daraus eine noch ungleich heftigere Energie. Auch führt das Liniengeflecht dann mehr Spuren des Erlebens und Erleidens mit sich – und nicht zuletzt errungenes Glück.
Franz hat die Exponate weitgehend chronologisch gehängt, meidet aber klugerweise Direktvergleiche, die zwischen je zwei Bildern womöglich flach ausfallen würden. Man wird hier beständig hin und her gehen und etliche Blickachsen erproben müssen, um Querbezüge oder auch energetische Abstoßungen zu entdecken.
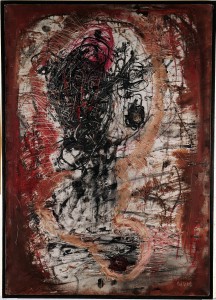
Wols, o. T. (um 1946/47), Grattage auf Leinwand (Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg / © VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / Wols)
Früheste Anregungen, die nachvollziehbar ins Werk der 1930er Jahre eingeflossen sind, empfing Schumacher von Christian Rohlfs und Emil Nolde, sodann auch von Matisse, dessen Schaffen er anfangs nur aus Büchern kannte. So scheint noch Schumachers „Strandbild“ (1950) von Matisse-Bildern wie „Das blaue Fenster“, 1913) inspiriert zu sein.
In den 1950er Jahren markieren fulminante Bilder mit sprechenden Titeln wie „Eruption“ (1956) Schumachers künstlerischen Weg, den auch eine singuläre Erscheinung wie Wols (hier mit zwei Bildern von 1946/47 vertreten) gebahnt haben mag. Um 1957 sprengen Schumachers Tastobjekte die Leinwand und wachsen als Reliefs in den Raum, beispielsweise, indem der Farbauftrag mit Nägeln durchschossen wird. Natürlich liegt hier die Assoziation zu Günter Uecker (allzu?) nahe, dessen „Nagelbaum“ von 1962 hier zu sehen ist.

Antoni Tàpies "Graue Tür auf schwarzem Grund" (1961), Mischtechnik auf Leinwand (Sammlung Lambrecht-Schadeberg/Rubenspreisträger der Stadt Siegen im Museum für Gegenwartskunst / © Fondacio Antoni Tàpies und VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / Antoni Tàpies)
In seinen „Hammerbildern“ hat Schumacher die Leinwand denkbar heftig attackiert und verletzt – ganz anders als Lucio Fontana, der seinen Bildträgern nur sanfte Schnitte zugefügt hat. In solchen Fällen lässt eine Gegenüberstellung eher die Kontraste hervortreten.
Gleichviel! Es ist jedenfalls spannend, die teilweise subtilen Bezüge und Eigenheiten nachzuempfinden. Besonders fruchtbar könnten vertiefende Vergleiche zwischen den äußerlich verkrusteten, erdig verhärteten Bildern Schumachers und den schier undurchdringlichen Oberflächen bei Dubuffet oder Tàpies ausfallen. Auch dürfte eine Zusammenschau der Linien- und Flächenverläufe bei Schumacher, Motherwell und Twombly zu feinsten Differenzierungen führen, die an den Ursprung alles Bildnerischen rühren. Doch dies ahnt man ebenfalls: Auf diesem erhabenen Qualitätsniveau ist jeder Künstler letztlich ein Planet für sich.
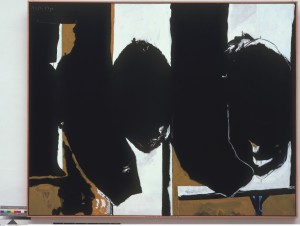
Robert Motherwell "Elegy to the Spanish Republic", No. 133 (1975), Kunstharz auf Leinwand (Bayrische Staatsgemäldesammlung, München - Pinakothek der Moderne / © Dedalus Foundation, Inc. und VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / Robert Motherwell)
Bei all dem hilft die kunsthistorisch eingeübte Begrifflichkeit, derzufolge Schumacher zum vermeintlich formlosen „Informel“ zählt (wahlweise auch zum Tachismus, Action Painting oder zum Abstrakten Expressionismus), nicht wesentlich weiter. Prof. Ernst-Gerhard Güse, der just ein neues Standardwerk über Schumacher verfasst hat, wertet nicht nur das mit über 70 Jahren geschaffene Spätwerk auf, sondern verweist darauf, dass Schumacher selbst sich keineswegs als Vertreter des „Informel“ verstanden hat. Noch die explosivsten Bilder seien immer auf Form und Gegenstand rückbezogen. Nur eine akademische Debatte? Oder der Ansatz zu einer grundlegenden Neudeutung?
„Malerei ist gesteigertes Leben – Emil Schumacher im internationalen Kontext“. 29. August 2012 (Eröffnung nach einem um 19 Uhr beginnenden Festakt mit geladenen Gästen in der Stadthalle Hagen, Festredner Bundestagspräsident Prof. Norbert Lammert) bis zum 20. Januar 2013. Am Eröffnungsabend ist das Museum bis Mitternacht geöffnet.
Reguläre Öffnungszeiten Di/Mi/Fr 10-17, Do 13-20, Sa/So 11-18 Uhr. Eintritt 9 Euro (ermäßigt 2 Euro), Familie 18 Euro, Kinder unter 6 Jahren frei.
Katalog (Hirmer Verlag), 160 Seiten, 29,90 Euro im Museum.
Weitere Neuerscheinung: Ernst-Gerhard Güse „Emil Schumacher. Das Erlebnis des Unbekannten“, Verlag Hatje Cantz. 504 Seiten, 49,80 Euro
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
Jubiläumshalber ist der Komponist John Cage (100. Geburtstag am 5. September) heuer erst recht eine kulturelle Leitfigur. Nicht nur setzt die Ruhrtriennale vielfach bei seinem Werk an, nicht nur hat die Fluxus-Kunst (derzeit im Fokus des Museums Ostwall) ihm Impulse zu verdanken – auch die gedankenreich unterfütterte Ausstellung „Sounds Like Silence“ kommt (parallel im selben Hause Dortmunder „U“) auf ihn zurück. Für die intellektuelle Durchdringung auf hohem Theorie-Plateau sorgt der ortsansässige Hartware MedienKunstVerein (HMKV), dessen Leiterin Inke Arns den Leipziger Medienwissenschaftler Dieter Daniels als Ko-Kurator gewonnen hat.
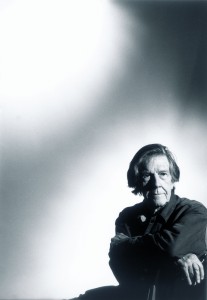
Porträt des großen Anregers John Cage (© Henning Lohner & John Cage / Foto Henning Lohner)
„Sounds Like Silence“. Hört sich an wie Stille. Oder: Geräusche wie Stille. Der auf den Welthit „Sounds of Silence“ von Simon & Garfunkel anspielende Titel kann füglich auch auf Cage bezogen werden. Der hat das berühmte Stück 4’33’’ erschaffen, 4 Minuten und 33 Sekunden vermeintlich völliger Stille. Die Uraufführung war am 29. August 1952, also vor 60 Jahren. Eine Inspirationsquelle: Robert Rauschenbergs „White Paintings“ (ab 1951), monochrom weiße Bilder, die ebenfalls nicht pure Abwesenheit bedeuten. Bloß keine Angst vor der Leere! Am Saum des Nichtseins ist in allen Künsten stets ein Etwas gewesen.
Das Cage-Stück zwischen Sein und Nichts kann sich mitsamt allen Weiterungen in die Hirnwindungen fräsen. Und so kreist auch die Dortmunder Ausstellung gebannt (jedoch alles andere als kopflos, wenn nicht gar kopflastig) um diese Ikone der akustischen Kunst. Wer hätte gewusst, dass von diesem epochalen Werk viele verschiedene Notationen/Partituren sowie über 50 Platten-Einspielungen existieren – und dass keine exakt der anderen gleicht. Denn die vollkommene Stille gibt es nicht. Immer sind da noch so geringe Nebengeräusche, Schwingungen an der Wahrnehmungsgrenze. Selbst in der schalldichten Kammer (die man hier – sofern seelisch gefestigt – erproben kann) hört man, neben der Aufnahme vom angeblich weltweit stillsten Wüstenort, noch das Grundrauschen der eigenen Nerven- oder Blutbahnen. Dass wir nach dem Tode gar nichts mehr hören, ist auch noch nicht ausgemacht…

Blick in einen der Ausstellungsräume von "Sounds like Silence" (© Foto HMKV)
Man schreitet hier durch lauter dunkle Räume, denn man soll sich ja auf Hören konzentrieren. Überall wollen Kopfhörer ergriffen und aufgesetzt sein, auf dass man lausche und zunehmend differenziere. Nun gut, ein paar Filme sind auch zu betrachten – bis hin zur Jux-Aufführung von 4’33’’ durch Helge Schneider in Harald Schmidts Late Night Show (ARD). Mit dem im Internet forcierten Projekt „Cage Against the Machine“ haben es Popmusiker 2010 geschafft, die Stille auf Platz 21 der britischen Charts zu hieven.

Mit Stille in die Charts: Projekt "Cage against the Machine", 2010 (© Courtesy Dave Hillard / Foto Carina Jirsch)
Die anspruchsvolle Ausstellung verfolgt etliche Nachwirkungen der in 4’33’’ berufenen Ideen. Merce Cunningham hat eine experimentelle Tanzversion besorgt. Selbst Heinrich Böll gerät mit seiner Hörfunk-Satire „Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“ (1955) in den Blick, obwohl er sich schwerlich auf Cage bezogen haben dürfte.
Breit ist das Spektrum: Die Formation „Einstürzende Neubauten“ hat mit „Silence is Sexy“ (2000) der Stille gehuldigt. Spezielle Dortmunder Varianten von 4’33’’ gibt es ebenso wie bewusst verfälschende Cage-Aufführungen, die die Frage nach geistigem Eigentum aufwerfen. Als stummer Handy-Klingelton ist das Stück so präsent wie als sukzessive Löschung vormals vorhandener Musik. Studien zur Wahrnehmung der Taubstummen stehen neben einer Videoinstallation von Bruce Nauman, der sein verlassenes Atelier nächtelang filmte. Auch da begab sich noch etwas…
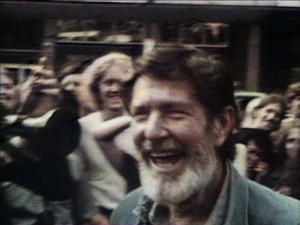
Filmstill aus Name June Paiks Film "A Tribute to John Cage" (1973) (© Nam June Paik)
Kunsthistorisch interessant ist ein genialisches Gipfeltreffen von Nam June Paik und Cage. Wie der Koreaner 4’33’’ filmisch aufbereitet hat, ist für beide Oeuvres aufschlussreich. Ferner wird ein Interview mit Cage (von Vicki Bennett) ebenso sprachlos gemacht wie eine Tagesthemen-Ausgabe mit Ulrich Wickert (von Hein-Godehart Petschulat) oder eine kriegstreibende Rede des George W. Bush (durch Matt Rogalsky).
Am Horizont solcher Darbietungen erscheint eine Ökologie der Geräusche. Eine leisere Welt wäre wohl keine schlechtere.
„Sounds Like Silence“. Cage / 4’33’’ / Stille. 1912-1952-2012. Bis 6. Januar 2012 im Dortmunder „U“, Leonie-Reygers-Terrasse (Navi Rheinische Straße 1). Eintritt 5 Euro, freier Eintritt bis 18 Jahre. Di/Mi 11-18, Do/Fr 11-20, Sa/So 11-18 Uhr. Internet: www.hmkv.de

Helge Schneider (li.) und Harald Schmidt bei der Jux-Aufführung von 4'33'' (© 2010 Courtesy Kogel & Schmidt GmbH, Grünwald / meine Supermaus GmbH, Mülheim)
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
Wer Fluxus definieren oder gar fixieren will, dem entgleitet das Phänomen unweigerlich: Diese diffus ungerichtete Kunstrichtung mit Schwerpunkt in den 1960er Jahren war ja gerade aufs Tanzen der Verhältnisse aus, gleichsam auf Verflüssigung aller Handlungen. Und wie sehr hat man auf den Alltag, aufs Leben der Vielen einwirken wollen! Die politische Zeitstimmung hat derlei Aufbrüche gewiss begünstigt.
Nicht nur der Zufall hat es so gefügt, dass das Dortmunder Museum Ostwall (heute im Dortmunder „U“) beim Sammeln der Fluxus-Reliquien und Relikte in Deutschland einen der Spitzenplätze einnimmt und auch international zu beachten ist. Vor allem hat man das dem Remscheider Sammler Wolfgang Feelisch zu danken, der bereits seit 1968 Fluxus-Objekte in die Stadt brachte und sich seither immer wieder zu großzügigen Schenkungen bereit fand. Gleichsam in seinem Windschatten hat Dortmund auch umfangreiche Dauerleihgaben aus der Düsseldorfer Sammlung Hermann Braun/Holger Lieff erhalten. Und schließlich hat der Freundeskreis des Museums einige Mittel beigesteuert.
Ob weite Teile der Bevölkerung davon Kunde haben oder es gar zu schätzen wissen, das ist eine ganz andere Frage. Jetzt wäre jedenfalls Gelegenheit, sich anhand von rund 300 Exponaten mit den Beständen vertraut zu machen, darunter auch wesentliche Neuerwerbungen.

Allan Kaprow: "Taling a Shoe for a Walk", 1989, Activity, presented for "Fluxus. 1962-1989" Bonner Kunstverein, Bonn, Germany, Courtesy Allan Kaprow Estate and Hauser & Wirth (Sammlung Museum Ostwall, erworben aus der Sammlung Feelisch, Foto: Jürgen Spiler)
Wer nun die Dortmunder Schau „Fluxus. Kunst für alle“ auf der 6. Ebene des Dortmunder „U“ betritt, ist wahrscheinlich frappiert, wenn nicht düpiert, gibt sie sich doch auf den allerersten Blick sperrig, eckig, nahezu abweisend. Man sieht zunächst nur lauter ineinander verschachtelte Holzkisten. Bestenfalls denkt man an Umzug, somit denn doch an Bewegung.
Diese Verschläge enthalten Schriftstücke und Gegenstände aller Art. Es sind just Relikte, Reflexionen oder auch „Partituren“ und Handlungsanweisungen einstiger Fluxus-Aktionen, Restbestände von Happenings und Performances. Das Spektrum reicht vom vollen Aschenbecher bis zum Rollmopsglas, von der Weinflasche bis zum rosigen Sparschwein, vom verfremdeten Kleidungsstück bis zur Papierschwalbe. Genug. Des Aufzählens wäre kein Ende.

Blick in einen Teil der Dortmunder Fluxus-Ausstellung (Foto: Bernd Berke)
Manche Auftritte von damals brachen so entschieden mit eingefahrenen Lebensgewohnheiten, rissen den Erwartungshorizont dermaßen weit auf, dass sie bis heute nachwirken – bis hin zu den flashmobs der Internet-Ära. Alan Kaprow entwarf beispielsweise eine Aktion, bei der ein einzelner Damenschuh quer durch die Stadt gezogen und von Zeit zu Zeit mit Mullbinden und Pflaster versorgt wurde. Auch diesen Schuh darf man hier ehrfürchtig betrachten. Oder auch feixend.

Milan Knížák: "Ein fliegendes Buch" (Flying Book)", 1965/70 (Sammlung Museum Ostwall, erworben aus der Sammlung Feelisch, Remscheid). © VG Bild-Kunst, Bonn 2012, Foto Jürgen Spiler
Widersprüchlich und irritierend genug: Was damals sehr lebendig und lebensnah dahergekommen sein muss, wirkt heute im Museum (wenn nicht Mausoleum) zunächst zwangsläufig stillgestellt, ja fast starr. Man muss sich das aneignen. Besucher sollten Zeit mitbringen, sie müssen sich vor Vitrinen und an Bildschirmen schon ziemlich intensiv in Einzelheiten versenken, um sich das vitale Geschehen der großen Fluxus-Zeit halbwegs zu vergegenwärtigen. Am besten mag dies mit Hilfe der Filme und Tondokumente gelingen, die die Ausstellung anreichern.
Die Fluxus-Protagonisten waren um 1962 (also vor 50 Jahren) angetreten, zwischen Spiel, Provokation und Ironie „Kunst für alle“ hervorzubringen. Allseitige Offenheit in jedem Moment war eine Leitlinie. Alles ist im Fluss. Ein gewichtiger geistiger Vorvater ist John Cage, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre und zu Lebzeiten die Grenzen zwischen den Kunstgattungen sprengte, den (kalkulierten) Zufall als kreative Ur- und Triebkraft fruchtbar machte und alle etwaigen Hierarchien auf diesen Feldern einebnete. Sein „Untitled Event“ (1952) gilt als Grundmuster späterer Experimente. Viele Künstler haben seine Seminare besucht. Es kommt nicht von ungefähr, dass sich auch die Ruhrtriennale dem Nachhall seines Oeuvres widmet und dass das Museum Bochum sich derzeit ebenfalls Fluxus auf die Fahnen schreibt.

Robert Watts: "Chrome Hamburger", 1963 (Dauerleihgabe Sammlung Braun/Lieff, Düsseldorf) © Robert Watts Estate, New York, 1963/2012 / Foto: Jürgen Spiler
Wir werfen mal ein paar Namen aus der Dortmunder Ausstellung in die Luft: Allan Kaprow, Wolf Vostell, Milan Knížák, George Brecht, George Maciunas, Daniel Spoerri, Alison Knowles, Robert Watts, Dick Higgins, Robert Filliou. Sie alle zählten zum internationalen Netzwerk der Künstler, die dem Fluxus zugerechnet wurden und vielfach miteinander befreundet waren. Joseph Beuys gehörte dann irgendwie auch hinzu, geradezu unvermeidlich.
Bemerkenswert: Die meisten von ihnen hatten keine künstlerische Ausbildung im akademischen Sinn, es gab etliche Quereinsteiger wie den ehemaligen Ökonomen, den früheren Ingenieur oder Chemiker. Avanti dilettanti? Nun, das wäre zumindest aus heutiger Sicht eine Beleidigung. Fluxus steht nicht zuletzt für luzide, ausgeklügelte Konzepte.
Der Originalitätsbegriff gerät freilich ins Wanken. Man sieht in Dortmund Bruchstücke von Alan Kaprows früherer Installation „Fresh air“ (Frischluft): Da darf man sich vor einen Tischventilator setzen und sich dabei im Handspiegel betrachten, es soll dabei bewusstes Atmen erfahren werden. Es handelt sich um den teilweisen Nachbau eines Remakes der Ursprungsarbeit, also um ein Re-Remake, wenn man’s so verschachtelt will. Viele Fluxus-Überbleibsel sind so genannte Multiples, also Auflagenkunststücke zu anfangs geringen Einstiegspreisen. Alle sollten sich das leisten können. Hat da jemand Kunstmarkt gesagt? Jaja, ist ja schon gut. Aller Anfang war bescheiden.

Robert Filliou/VICE-Versand, Remscheid: "Optimistic Box No. 4 and 5", 1981 Ausführung; Konzept 1968, Multiple (Sammlung Museum Ostwall, erworben aus der Sammlung Feelisch, Remscheid). © VG Bild-Kunst, Bonn 2012, Foto Jürgen Spiler
Auch bewegen wir uns hier im flirrenden Grenzgelände zwischen erklärter Kunst, Alltag und Banalität. Das „Exit“-Schild hoch droben im Raum ist kein Hinweis auf Fluchtwege, sondern ein Kunstobjekt, das auf ständigen Wandel durch Verlassen einer Situation (doch auch auf den finalen Exitus) verweist. Und der blaue Putzeimer, der in der Ecke steht, stammt von Robert Filliou und trägt am Besenstiel ein Schild, das die Allerheiligste der Tafelbildkunst ironisch degradiert: „Bin in 10 Minuten zurück – Mona Lisa“.
Eine Kunst, die bizarre Objekte mit Tischtennisball kreiert (wird er diesmal rechts oder links herausfallen?) oder etwa der Bohne veritable Aktionsreihen widmet (Alison Knowles), hat eben vielfach befreienden Witz. Selbiger muss allerdings hie und da aus den Relikten erst wieder fleißig herausgekitzelt werden. Weiterer Ansatz: George Brecht und Robert Filliou fußen – wie John Cage – je unterschiedlich auf buddhistischem Gedankengut, das alles scheinbaren Paradoxien auflöst.
Wer nach all dem körperlichen Ausgleich braucht, der begibt sich am besten mit bereitgestellten Gummistiefeln in Wolf Vostells Arbeitsfeld „Umgraben“ und schichtet mit einer Schaufel Erdreich um, dabei seltsame Klänge erzeugend. Vostells Denkanstoß zum Tun: „Gefühl umgraben / Gedächtnis umgraben / Zeit umgraben / Ideen umgraben…“

Dortmunds Ostwall-Museumsdirektor Dr. Kurt Wettengl bei der Erdarbeit in Wolf Vostells Installation "Umgraben". (Foto: Bernd Berke)
FLUXUS. Kunst für alle! 24. August 2012 (Eröffnung 19 Uhr) bis 6. Januar 2013. Museum Ostwall im Dortmunder U (Leonie-Reygers-Terrasse / Navi: Rheinische Straße 1), Oberlichtsaal auf Geschossebene 6 (weiterer Fluxus-Eigenbesitz in der Dauerausstellung auf den Ebenen 4 und 5). Eintritt 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Geöffnet Di, Mi, Sa, So 11-18 Uhr, Do/Fr 11-20 Uhr. Umfangreiches Begleitprogramm/Führungen: www.museumostwall.dortmund.de
geschrieben von Frank Dietschreit | 6. September 2013
Am Neuen Markt in Potsdam ist preußische Geschichte allgegenwärtig. In Rufweite liegt Schinkels Nikolaikirche und der Marstall, der heute ein Filmmuseum beherbergt. Der Blick schweift von hier aus zum Wiederaufbau des im Krieg arg mitgenommenen und von den Baubrigaden der DDR abgerissenen Hohenzollernschlosses. In zwei Jahren soll im rekonstruierten Preußenschloss der brandenburgische Landtag einziehen.
Ob bis dahin für die sich derzeit in Potsdam abspielende kultur- und kunstpolitische Provinzposse, die viel über die nach wie vor offenen Wunden der deutschen Vereinigung und die antikapitalistischen Vorurteile in den Neuen Bundesländern erzählt, eine vernünftige Lösung gefunden wird, bleibt abzuwarten. Eine kleine Ausstellung mit gerade einmal 28 Bildern, die jetzt im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte am Neuen Markt präsentiert wird, könnte behilflich sein, die Gemüter etwas zu beruhigen. Im ehemaligen Kutschstall, wo gerade unter dem Titel „Kunst & Kartoffel“ eine Ausstellung zu Friedrich dem Großen und die preußische „Tartuffoli“ läuft, wurde der Konferenz- zum provisorischen Ausstellungsraum umfunktioniert, um „Einblick und Ausblick“ zu geben auf die Werke aus der Sammlung von Hasso Plattner.

Werner Tübke: "Der Narr und das Mädchen", Öl auf Leinwand, 1993/94 (Foto: Galerie Schwind/Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte)
In der viel zu eng und unübersichtlich gehängten Bilderschau sind vor allem Werke des realsozialistischen Spätexpressionismus zu sehen, grelle Farbballungen von Bernhard Heisig, naive Romanzen und Idyllen von Wolfgang Mattheuer, auch Plakatives von Willi Sitte, Altmeisterliches von Werner Tübke, Mythologisches von Arno Rink, also Bilder von Künstlern, die der „Leipziger Schule“ angehören und zu Repräsentanten der DDR-Kunst wurden. Dazwischen geschmuggelt ist aber auch ein erst 2004 gemaltes abstraktes Bild von Gerhard Richter, der einst von Dresden nach Düsseldorf floh und heute der bedeutendste zeitgenössische deutsche Künstler ist. Und was ein Bild von dem in Velbert am Rhein geborenen Klaus Fussmann in einer Sammlung zu suchen hat, die sich dem Ziel verschrieben hat, die Kunst der DDR zu dokumentieren, bleibt genauso ein Rätsel wie die Tatsache, dass viele der gezeigten Werke vielleicht noch den Geist des untergegangenen Sozialismus atmen, aber tatsächlich von Heisig, Sitte, Tübke und Co. erst nach der Wende geschaffen wurden. Wie kann es nur sein, fragt sich der aus dem nahen Berlin angereiste Betrachter, dass diese eher stille und gut gemeinte, aber künstlerisch noch unausgereifte Sammlung von ziemlich konventionellen Bildern einen solch lauten Streit hervorrufen kann?

Arno Rink: "Lots Töchter", Öl auf Leinwand, 2007 (Foto: Galerie Schwind / Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte)
Der 1944 in Berlin geborene Unternehmer Hasso Plattner wurde mit seiner in Walldorf beheimateten Software-Schmiede SAP nicht nur zum reichen Mann, sondern auch zum Stiftungsgründer und Mäzen. Der Universität Potsdam hat er ein Institut für Software-Systemtechnik finanziert, für den Wiederaufbau des Potsdamer Schlosses mehrere Millionen Euro locker gemacht. Jetzt wollte Plattner der Stadt nicht nur seine noch im Aufbau befindliche Kunst-Sammlung schenken, sondern auch noch gleich den Neubau des dazu gehörigen Museums bezahlen. In Absprache mit Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) wollte Plattner das Museum dort errichten, wo seit einigen Jahrzehnten ein 17-stöckiger DDR-Plattenbau steht und das historische Ambiente Potsdams verhöhnt. Das architektonische Monster war früher ein „Interhotel“, in dem Gäste aus dem Westen überwacht und abgehört wurden. Doch Plattners Plan, den amerikanischen Investoren das heutige Hotel „Mercure“ abzukaufen und es auf eigene Kosten abreißen zu lassen, rief unerwarteten Widerstand hervor. Die in Brandenburg stark vertretene „Linke“ versammelte DDR-Nostalgiker um sich und machte mit Protestaktionen und Unterschriftenlisten mobil. Auf einer Gegendemonstration – unter dem Motto: „Plattner statt Platte“ – versicherten Prominente wie TV-Moderator Günther Jauch, Schauspielerin Nadja Uhl und Modeschöpfer Wolfgang Joop dem von der „Linken“ als „Kolonisator“ und „Kapitalist“ verunglimpften Sponsor ihre Sympathie. Doch es nützte nichts. Plattner zog sein Angebot öffentlichen Mäzenatentums zurück und verkündete gleichzeitig, er werde auf seinem Privatgrundstück am Potsdamer Jungfernsee eine kleine Kunsthalle bauen und dort allen Interessierten seine Sammlung zugänglich machen.

Erich Kissing: "Claudia", Tempera und Öl auf Hartfaser, 1993/94 (Foto: Galerie Schwind / Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte)
Abgesehen davon, dass der Streit um Plattners Mäzenatentum ein peinliches Licht auf Potsdam wirft, beantwortet auch die Ausstellung „Einblick und Ausblick“ (bei deren Vernissage Plattner demonstrativ fern blieb) nicht, welche Motive und Ziele die Sammlung zur DDR-Kunst eigentlich verfolgt. Wird sie auch Nonkonformisten wie Gerhard Altenbourg und Kunstrebellen wie Cornelia Schleime berücksichtigen? Und neben Gerhard Richter gibt es auch noch „Republikflüchtlinge“ wie A. R. Penck und Georg Baselitz. Fragen über Fragen.

Ausstellungsort: Kutschstall am Neuen Markt in Potsdam (Foto: Hagen Immel / Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte)
Infos:
+ Hasso Plattner wird am 21.1.1944 in Berlin geboren.
+ Zusammen mit Dietmar Hopp und anderen gründet Plattner 1972 das Software-Unternehmen SAP.
+ Seit dem Rückzug aus dem Tagesgeschäft engagiert sich Plattner als Kunstmäzen und Wissenschaftsförderer.
+ 1998 gründet er das Hasso-Plattner-Institut für Software-Systemtechnik in Potsdam.
+ „Einblick und Ausblick – Werke aus der Sammlung Prof. Dr. Hasso Plattner“, bis 16. September im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Am Neuen Markt 9, Potsdam (Di-Do 10-17 Uhr, Fr 10-19 Uhr, Sa-So 10-18 Uhr).
geschrieben von Bernd Berke | 6. September 2013
Nein, eine schöne Kindheit hat er nicht gehabt: Vor den allzeit lautstarken Streits der Eltern flüchtete er, wenn er konnte, zum Radio und wob sich eine Phantasiewelt aus dem Gehörten. Wurden Mutter und Stiefvater zwischendurch auf ihn aufmerksam, dann hagelte es meistens Ohrfeigen. Mindestens.
Wir reden von Sempé. Jean-Jacques Sempé. Wer seine wunderbaren Zeichnungen kennt, weiß, dass wohl kaum jemand sich den Duft und Hauch der trotz allem unbeschwerten, stets zu Streichen aufgelegten Kindheitstage so bewahrt hat und wachzurufen weiß wie dieser aus Bordeaux stammende Mann, der morgen (17. August) 80 Jahre alt wird und immer noch als besessen arbeitsam gilt. Er selbst findet es verstörend, dass und wie er dermaßen der Kindheit verhaftet geblieben ist. Nebenbei bemerkt, war damals das Radio so kultiviert, dass man sich dort bestes Französisch aneignen konnte.
Es gibt jedenfalls genügend Anlass, mit spürbar liebevollem Aufwand einen Bildband wie „Kindheiten“ herauszubringen, der sich als thematisch gewichtete, veritable Werkschau erweist und dabei ohne seine wohl berühmteste Figur, den „Kleinen Nick“ (Petit Nicolas) auskommt, die Sempé einst gemeinsam mit René Goscinny schuf.

Angesichts seiner frühen Jahre, die das Buch in einem langen Sempé-Gespräch mit Marc Lecarpentier in Erinnerung ruft, ist die milde Heiterkeit des Oeuvres überaus erstaunlich. Sempé sagt es mit den Worten eines Schriftstellers, an dessen Namen er sich nicht erinnert: „Der Mensch ist ein Wesen von untröstlicher Heiterkeit.“ (Hausaufgabe: Wer findet den Urheber heraus?)
In diesem Band kann man beispielsweise verfolgen, wie die durchaus wohlgesetzen Worte zu den Zeichnungen nach und nach schwinden, wie also das rein Bildnerische überwiegt. Immer eigener, feingliedriger und feinsinniger wird die Linienführung, sie übermittelt in seismographischer Weise seelische Zustände. Da bedarf der Worte nicht mehr. Es scheinen ganze Existenzen und Charaktere in knappen, meisterlichen Skizzen auf. Oder auch dies: Dauer, Trägheit und Hitze eines Hochsommertags werden atmosphärisch greifbar. Manche Blätter wiederum erfassen haarfein, was Provinz ausmacht. Man schaue nur, wie die Dorfjugend einer Radfahrerin nachstarrt. Auch für Freud und Leid, Groteske und Grazie des Fußballs abseits der großen Stadien hat Sempé ein untrügliches Gespür. In all diesen Zeichnungen schwingt so vieles mit…
Auch wenn Sempé erwachsene Menschen zeichnet, sind sie oft unverkennbar von Kindheit geprägt. Mal sieht man sie in selten schönen Momenten des Leichtsinns, wenn sie sich unbeobachtet glauben und auf einmal wieder sind wie von klein auf. Andererseits sieht man aschfahl ergraute und erstarrte Herrschaften, in denen jegliche Kindheitsahnung erloschen ist. Zuweilen rücken die Lebensalter in komischen Kontrast: Der Schnitt durch ein Haus offenbart, wie die „Großen“ bei Regen ihre Zeit in Zimmern totschlagen, während oben auf der Dachterrasse eine Kinderschar tobend jeden Augenblick der Nässe mit Haut und Haaren genießt.
Schließlich gibt es in dieser vielfältigen Bildwelt auch jene stocksteif ungelenken, früh verzogenen Bürgersöhnchen oder jene Kinder, denen das Kindsein früh ausgetrieben werden soll, etwa mit strengem Klavier- oder Ballettunterricht. Doch siehe da, sie wehren sich mit Phantasie oder auch ganz handgreiflich: Selbst wenn sie mit Heiligenschein aus Pappe zur Weihnachtsaufführung eilen, knuffen und hauen sie sich unterwegs noch mit heißem Herzen. So kann Kalberei ein Hoffnungszeichen sein.
Sempé: „Kindheiten“. Bildband, Hardcover Leinen, 272 Seiten. Mit einem Gespräch zwischen Sempé und Marc Lecarpentier (übersetzt von Patrick Süskind). 39,90 Euro.
geschrieben von Anke Demirsoy | 6. September 2013

Weltgeschichte auf Schilfgras: Für den "Zeitstrahl" von Geoffrey Farmer bilden sich auf der dOCUMENTA Warteschlangen (Copyright: Anders Sune Berg)
Spottet nur, ihr Daheimgebliebenen. Fragt ruhig ironisch, ob schon ein paar selbstbestimmte Erdbeeren oder herrschaftsfreie Hunde aufgetaucht seien, die von der dOCUMENTA-Chefin Carolyn Christov-Bakargiev als Beispiele für einen Themenschwerpunkt der diesjährigen Ausstellung genannt wurden – was prompt einen kleinen Medienwirbel verursachte. Eure Häme kümmert mich nicht. Mich treibt das dringende Bedürfnis nach intellektueller Herausforderung nach Kassel.
Den vorgefertigten Meinungen vieler Medien, die ihre Leser zunehmend für dumm verkaufen, will ich mich lustvoll widersetzen. Ich will mich Neuem öffnen, und wenn dies dazu gehört, gerne auch ratlos vor Installationen stehen, deren Bedeutung sich mir nicht erschließt. Ich will mich wehren gegen das feiste Grinsen, mit denen die Feinde von Kunst und Kultur auf die Fettecke von Joseph Beuys deuten, um dann mit perfider Grobheit zu fragen: „Is dat Kunst, oder kann dat wech…?“
Ganz alleine scheine ich mit solchen Wünschen nicht zu stehen. Bereits zur Halbzeit konnte die dOCUMENTA (13), diese 100 Tage währende Weltausstellung der Kunst, einen Besucherrekord vermelden. Genaue Zahlen sollen erst zum Abschluss am 16. September verraten werden. Indes wurde bekannt, dass die Verantwortlichen mit rund 750.000 Kunsthungrigen rechnen.
An diesem ersten Samstag im August, der sich trefflich auch im Freibad oder im heimischen Garten verbringen ließe, schwärmen die Menschen vom gesichtslosen Areal rund um den Hauptbahnhof aus in die Stadt. Bald schon bewege ich mich im Kielwasser kleiner Gruppen. Im Laufe des Tages wird der Besucherstrom anschwellen, wird mich zum Hugenottenhaus, zum Brüder Grimm Museum, zur Neuen Galerie, in die Karlsaue, zur barocken Orangerie, zur Documenta-Halle, zum Fridericianum und zum Hauptbahnhof führen. Er wird mich treppauf und treppab laufen lassen, das Verlangen nach Essen und Trinken auf später verschiebend, weil das Angebot bei 300 Künstlern so verlockend groß und vielfältig ist, mein Besuch aber leider auf diesen einen Tag beschränkt.
Neugierde, Spannung, aber auch einige Zweifel begleiten die erste Kontaktaufnahme. Wie werden wir miteinander zurechtkommen, die zeitgenössische Kunst und ich? Die erste Tuchfühlung erfolgt im Hugenottenhaus, einem kleineren Veranstaltungsort der diesjährigen dOCUMENTA. Das historische Gebäude zeigt sich von einer gewöhnungsbedürftigen Seite, befindet es sich doch in einem stark fortgeschrittenen Stadium des Verfalls. Leitungen liegen frei, vergilbte Tapeten schälen sich von den Wänden. Große Löcher in Decke und Wänden legen Schichten aus Stroh, Lehm und alten Balken frei, die dem Blick sonst verborgen bleiben. Das Haus zeigt seine Eingeweide her. Aber es gibt hier mehr zu sehen als Spuren vergangenen Lebens. Der 1973 in Chicago geborene Theaster Gates hat das Gebäude mit einer Gruppe von Auszubildenden aus Kassel und Chicago in Besitz genommen. Sie haben primitive Möbel geschreinert, eine Küche eingerichtet, in einem Freiraum neben der Diele sogar eine große Hollywoodschaukel aufgehängt. Die Schlafzimmer sind für Besucher nicht begehbar, stehen ihren Blicken aber offen. Wie kann man leben in dieser „sozialen Skulptur“, wie die Künstler diese Begegnungsstätte nennen? Gibt es eine Ästhetik des Schäbigen? Wo mögen sich die Künstler und Künstlerinnen tagsüber aufhalten? Der Zufall will es, dass eine von ihnen gerade auf ihrem Bett sitzt. Sie kehrt den Besuchern den Rücken zu, wird aber trotzdem fotografiert, als sei sie ein seltenes Tier in einem Zoo.

Schlafstatt und Ausstellungsraum: Theaster Gates und eine Gruppe von Auszubildenden machten aus dem Hugenottenhaus eine "soziale Skulptur" (Copyright: Nils Klinger)
Kurz darauf tappe ich ins Dunkel. Der Raum, in dem eine Performance des deutsch-britischen Künstlers Tino Sehgal stattfinden soll, ist aber nur auf den ersten Blick stockfinster. Wer vorsichtig voran geht, bemerkt bald einen schwachen Schein von einer indirekten Deckenbeleuchtung, die ein Minimum an Sicht erlaubt. Staunend und langsam bewegen sich Menschen durch diesen Raum, der von einem leisen Summton erfüllt ist. Er stammt unverkennbar aus menschlichen Kehlen. Sind es vielleicht die anderen Besucher, die hier leise vor sich hin summen? Oder vielmehr: Sind die Menschen um mich herum denn überhaupt Besucher? Kaum taucht der Gedanke auf, da bricht auch schon die Hölle los: Die vermeintlichen „Besucher“ beginnen laut zu singen und rhythmische Texte zu skandieren. Dazu tanzen sie im Dunkeln nach einer ausgefeilte Choreographie. Plötzlich wälzt sich ein Tänzer auf dem Boden. Die anderen stampfen und toben rhythmisch durch den Raum. Ich fürchte eine Kollision, werde aber nicht einmal gestreift. Ein Sprecher sinniert verwundert über die existenzielle Unzufriedenheit vieler wohlhabender Menschen in den westlichen Gesellschaften. Und plötzlich ist der Spuk vorbei. Die Tänzer schwanken leise wie Rohre im Wind. Nichts bleibt als das Dunkel und der geheimnisvolle Summton.
Verzaubert kehre ich zurück ins Tageslicht. Wie Atréju aus Michael Endes „Unendlicher Geschichte“ habe ich ein Orakel besucht, einer geheimnisvollen Stimme gelauscht und eine Botschaft empfangen, die ich nur halb verstehe. Ich fühle mich zurückversetzt in Kindheitstage, erinnere mich an aufregende Spiele im dunklen Flur des Kellers, die zur Abendzeit nur durch ein Machtwort der Erwachsenen beendet werden konnten. Um einen Kindheitstraum dreht sich auch die Ausstellung „Knights (and other dreams)“ im Brüder Grimm Museum. Dort beleuchtet der Bulgare Nedko Solakov seine kindliche Faszination für Ritter von denkbar vielen Seiten. Das ist erwartungsgemäß verspielt und auch hübsch anzusehen. Gleichwohl resümiert der Künstler hellsichtig: „Ich hätte sie in meinem Kopf behalten sollen, diese Träume. Dort hätten sie wohl glücklich bis an das Ende ihrer Tage gelebt. Vielleicht.“
Ein erster Höhepunkt ist die Neue Galerie. Hier bewundere ich die teils fragilen, teils kraftvoll-bewegten Bronzeskulpturen von Maria Martins und die fröhliche Farbintensität der Bilder von Gordon Bennett, die Muster und Zitate aus der Kunst der australischen Ureinwohner (Aborigines) aufgreift. Eine leuchtend bunte Jukebox hat die US-amerikanische Künstlerin Susan Hiller aufgestellt: In 100 verschiedenen Sprachen und Varianten bietet sie das Lied „Die Gedanken sind frei“ zur Auswahl an. Die dazugehörigen Texte zieren die Wände bis unter die Decke. Eine lange Warteschlange bildet sich im zweiten Stock vor dem spektakulären „Zeitstrahl“ des kanadischen Künstlers Geoffrey Farmer. Es handelt sich dabei um eine 44 Meter lange Collage aus Ausschnitten des amerikanischen „Life“ Magazins, die von 90 Mitarbeitern in filigranster Arbeit ausgeschnitten und auf Schilfgras geklebt wurden. Bilder von Figuren, Menschen und Gegenständen, 50 Jahrgängen des Heftes entnommen, erzählen die Geschichte der Jahre 1935 – 1985 auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Skulpturen von Maria Martins sind in der Neuen Galerie zu sehen (Copyright: Anders Sune Berg)
Nur selten stehe ich an diesem Tag vollkommen ratlos vor einem Kunstwerk. Sogar das auf den ersten Blick Lächerliche ergibt bei näherer Betrachtung Sinn, lädt ein zum Nachdenken über die Vergangenheit oder über den Alltag in fernen Kulturen. Zum Beispiel gibt die 1949 in Zagreb geborene Sanja Ivekovic einer Sammlung von Stoff-Eseln in einer Glasvitrine den Titel „The Disobedient“ (Die Ungehorsamen). Namensschilder weisen die Plüschtierchen als berühmte Personen der Zeitgeschichte aus: Rosa Luxemburg, Martin Luther King und die Geschwister Scholl sind hier versammelt. Ein historisches Foto aus Kassel im Jahre 1944 bildet den Schlüssel zu dieser vermeintlich niedlich-belanglosen Installation: Es zeigt einen Esel, den die Nationalsozialisten in der Stadtmitte von Kassel in Stacheldraht eingezäunt haben, verbunden mit einer Warntafel, dies sei „ein KZ für alle widerspenstigen Staatsbürger“, die nach wie vor bei Juden kauften. Die zwei toten Fliegen, die der thailändische Künstler Pratchaya Pinthong in einer Vitrine ausstellt, verweisen auf den erbitterten Kampf, den die Menschen in seiner Heimat gegen die Tsetsefliege und die von ihr übertragene tückische Schlafkrankheit führen.
Kühne und zugleich kühle Visionen von Technik und Fortschritt beherrschen die große Documenta-Halle. Der deutsche Künstler Thomas Bayrle zeigt dort ein acht Meter hohes und über 13 Meter breites Schwarz-Weiß-Bild eines Flugzeugs, das aus unzähligen kleinen Flugzeug-Bildern zusammengesetzt ist. Am Eingang steht die „Monstranz“, ein feingliedriger Sternmotor, der einst ein tschechisches Saatflugzeug antrieb. Er ist längs durchgeschnitten, sein Inneres ist bloßgelegt, zusammen mit Lautsprechern ist er auf einen stählernen Fuß montiert. Die Maschine läuft, wenn das Stromkabel angeschlossen ist: Gleich wird ihr gleichförmig arbeitender Originalton mit einer vielkehligen Rosenkranzandacht aus dem Kölner Dom zusammenklingen. Der Motor „betet“.

Technik als Religion: Arbeiten von Thomas Bayrle in der Documenta-Halle (Copyright: Anders Sune Berg)
Vermutlich in dem Versuch, möglichst viele Orte in die dOCUMENTA einzubeziehen, werden die Künstler in der Orangerie in der Karlsaue recht lieblos präsentiert. Ihre Arbeiten drücken sich schamhaft in eine Ecke, werden von den ständigen Exponaten nachgerade erschlagen. Die Weiten der Karlsaue zu durchmessen, ist an diesem einen Tag natürlich ganz unmöglich. So entgeht mir der Hundespielplatz für vierbeinige Documenta-Besucher. Die Hunde, die ich an diesem Tag zu Gesicht bekomme, sind erkennbar nicht „herrschaftsfrei“. Auch die glücklichen Himbeeren und Tomaten an einem „Fair Trade“-Stand machen keinen sonderlich politischen oder selbstbestimmten Eindruck. Was im Vorfeld so viel Anlass zum Spott gab, kann andererseits als der durchaus ehrbare Versuch gesehen werden, von einem Weltbild abzurücken, das den Menschen als Maß aller Dinge sieht.
Nach neun Stunden dOCUMENTA bin ich müde, glücklich, voller neuer Eindrücke. Ein Versäumnis fällt mir auf der Heimfahrt plötzlich doch noch ein: Ich habe Hitlers Badewanne nicht gesehen! Diese wurde von der Fotografin Lee Miller aufgenommen, die im April 1945 als Kriegsberichterstatterin mit den amerikanischen Truppen in München eingezogen war und einige Tage in Hitlers Wohnung am Prinzregentenplatz wohnte. Am Tag seines Selbstmords badete sie dort. Nun ja, es muss ja nicht immer Hitler sein. Und was die dOCUMENTA betrifft: In fünf Jahren treffen wir uns bestimmt wieder. Ganz selbstbestimmt und herrschaftsfrei.
geschrieben von Charlotte Lindenberg | 6. September 2013

Edward Tufte nach Reinhardt; ohne Angaben (Foto web)
Auf Grundlage dieses großzügigen Politik-Verständnisses lässt sich aller menschlichen Aktivität politische Wirksamkeit bescheinigen, darunter auch ökologischen, psychologischen und sozialen Prozessen. Und diese bilden die Basis zahlreicher Beiträge der dOCUMENTA (13), wodurch sie die bislang interdiszplinärste ist.
Jenseits der twenty-somethings
Einzelne Aspekte der Ausstellung fordern zur Nachahmung auf, wie beispielsweise die Anhebung des Altersdurchschnitts von TeilnehmerInnen und Exponaten.

Etel Adnan "untitled, 1959-2010" (Foto A.S.Berg)
So lässt sich der Auftritt der 1925 geborenen Etel Adnan und Aase Texmon Rygh, sowie des ein Jahr jüngeren Gustav Metzgers als Aufruf zur Überwindung der im Kunstbetrieb herrschenden Altershierarchie verstehen, derzufolge vor 1970 Geborene für den Markt nur dann interessant sind, wenn sie sich anhaltenden Erfolgs erfreuen.
Synchronizität der Ereignisse: Abgelegene Modernen
Die dOCUMENTA (13) setzt diese Revision von Formen und Inhalten der Moderne fort, indem sie moderne KünstlerInnen jenseits der üblichen Verdächtigen in Erinnerung ruft.

Maria Martins; Skulpturen aus den 1940er Jahren (Foto A.S. Berg)
So übertragen Hannah Ryggens Webereien die internationale Politik der 1930er Jahre in ein Amalgam der in Europa verfügbaren Formsprachen.

Hannah Ryggen; Ausstellungsansicht (Foto Roman März)
Emily Carrs und Margaret Prestons Gemälde hingegen verbinden Prinzipien der Klassischen Moderne mit denen der Kulturen der amerikanischen Nordwestküste, bzw. der australischen Aborigines.

Emily Carr; Ausstellungsansicht (Foto A.S. Berg)
Die Vermessung der Kunstwelt
Mit der Öffnung des Zeitfensters erweitert sich auch der geografische Rahmen. Die Integration des Geschehens außerhalb von Europa und den USA ist auf Biennalen, und seit der zehnten auch auf der documenta selbstverständlich. Doch angesichts der noch immer von nationalen Interessen bestimmten Ankaufspolitik der Museen und Sammlungen kommt der Aufmerksamkeit für die Kunstgeschichte abseits traditioneller Zentren Signalcharakter zu.
Grenzwertig
Tarnanstriche
Ohne künstlerische Absicht entstandene Exponate fungieren als ästhetische Lockvögel, die die Aufmerksamkeit auf den eigentlichen, nicht-ästhetischen Gegenstand lenken.
Infolge einer regimekritischen Äußerung wird Korbinian Aigner zur Zwangsarbeit in Dachau verurteilt, wo er vier neue Apfelsorten züchtet und sie KZ 1 bis 4 nennt. Der Grund für Aigners Anwesenheit auf der documenta sind demnach nicht die mit wissenschaftlicher Präzision gemalten Äpfel als vielmehr die Geschichte vom inhaftierten Dissidenten, der im Wissen um den morgigen Weltuntergang Apfelbäumchen pflanzt und so die tätige Umsetzung des Prinzips Hoffnung verkörpert.
Auch die Anwesenheit von Mark Lombardis minutiösen Geweben verdankt sich nicht ihrer grafischen Attraktivität. Ihr dekoratives Äußeres diente der Offenlegung geheimer Verbindungen zwischen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern, deren Nebenprodukt die visuell ansprechenden Diagramme darstellen. Dass die Kuratorin deren ästhetischem Reiz erlegen ist, zeigt die Tatsache, dass die Beziehung zwischen Personen, Firmen und Institutionen durch elegant geschwungene Linien markiert, die Art dieser Kontakte aber undefiniert ist.

Goshka Macuga "Of What Is, That It Is; of What Is Not, It Is Not, 1"; 2012 (Foto Roman März)
Anders als im Fall von Aigner und Lombardi, wo Formen allein dem Transport von Inhalten dienen, sind bei Goshka Macuga beide Komponenten gleichermaßen ausdrucksstark. Unterhalb der Ruine des Darulaman-Palastes in Kabul haben sich Angehörige des afghanischen und internationalen Kulturbetriebs eingefunden. Die Situation ist von surrealen Versatzstücken unterbrochen, wodurch die Form der Arbeit auf zweierlei Weise irritiert: Optisch ist das vermeintliche Foto eine Foto-Montage, und materiell ein Gewebe. Auch inhaltlich erweist sich die sich dokumentarisch gerierende Aufnahme als inszeniert und mehrdeutig.
Durch die Kombination inhaltlicher und formaler Vielschichtigkeit steht Macuga in der Tradition Hannah Ryggens, die ebenfalls durch ikonografisch eigenwillige und technisch ausgefeilte Webereien Aufmerksamkeit für ihre politischen Botschaften erzielt. Beide Künstlerinnen setzen somit ästhetische Methoden zur komplexen Darstellung politischer Ereignisse ein.
Eine solche ästhetische Aufbereitung nicht-retinaler Inhalte ist nicht zu verwechseln mit Ästhetisierung. Denn statt Inhalte durch gefällige Formen eingängig zu machen, werden abstrakte Phänomene sinnlich erfahrbar und so politisch aussagekräftig.
HIStory
Nach dem Prinzip, wer seine Vergangenheit nicht erinnert, wiederholt sie, werden zahlreiche Beziehungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart hergestellt.
Eine Chimäre aus Mickey Mouse und Mudschaheddin patrouilliert durch Llyn Foulkes Installation, die als Bühnenbild des posthumanistischen Zeitalters durchgehen könnte: Der Day After all dessen, wovor uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Die Umgebung suggeriert unterschiedliche Lesweisen: Stadt- oder Ruinenlandschaft, unberührtes Geröll oder Trümmerfeld, Vergangenheit oder Zukunft? Durch diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen wird die Taliban Mouse zu Walter Benjamins Angelus Novus:
„Die Janusköpfigkeit der Bilder, die verschiedenen Zeiten anzugehören scheinen, setzt sich in Mariam Ghanis Synchronisation der Geschichte Kabuls und Kassels fort, in der das Innere eines einst, neben dem eines noch immer verwüsteten Herrschaftsgebäudes erscheinen. Die Renovierung, die zwischen dem kriegsversehrten und dem heutigen Fridericianum stattfand, steht dem Darulaman-Palast noch bevor. Doch die in den Details zutage tretende Unterschiedlichkeit beider Bauten verweist auf kulturelle Identitäten, die ihre spezifischen Entwicklungen fordern.
HERstory
Die eingangs erwähnte Identität der privaten und kollektiven Sphäre veranlasste KünstlerInnen der 1970er Jahre zur programmatischen Offenbarung des Unterdrückten im Interesse psychischer und physischer Befreiung. Dieser Tradition der Transparenz als Mittel politischer Emanzipation fühlt sich Ida Applebroog spätestens seit 1969 verbunden, als sie 160 Zeichnungen ihrer Vagina anfertigte, die sie später, zu Plakaten vergrößert, als Rauminstallation präsentierte. Verglichen mit dieser wegweisenden Geste nimmt sich die Veröffentlichung einzelner Tagebuchseiten eher schüchtern aus. Ziel jedoch ist nicht eine weitere Grenzüberschreitung als vielmehr die abermalige Integration der privaten in die öffentliche Dimension.

Ida Applebroog "I See by Your Fingernails that You Are My Brother"; 1969-2010 (Foto Roman März)
Ein vergleichbares Angebot von Transparenz stellt Lori Waxmans Angebot dar, mitgebrachte Arbeiten der BesucherInnen 25 Minuten lang zu begutachten, um anschließend vor aller Augen eine Kritik von 100 bis 200 Wörtern zu verfassen, und so eine undurchsichtige Prozess unter Einschluss der Öffentlichkeit nachvollziehbar zu machen.
Tunix
Zivilisationskritik äußert sich auch in Andrea Büttners Videodokumentation über im Schausteller-Millieu engagierte Ordensfrauen, ergänzt von Holzschnitten, die abstrahierte Zelte darstellen – Behausung der Nichtsesshaften und Flüchtlinge.
Bodenständig
Die Erfindung des Tafelbildes markierte einst den Übergang vom religiös motivierten Handwerk zur Kunst. Die an den Flügelaltar gebundene Malerei wurde mobil und ließ sich verschiedenen Kontexten anpassen. Nun holt Pich die Standortgebundenheit zurück ins Tafelbild. Mit dem für lokale Eigenheiten sensibilisierten Blick des Rückkehrers fertigt er das universale Raster aus einheimischen Rohstoffen Bambus, Erden und Bienenwachs an.
Verglichen mit Pichs Erdung der universell transportablen Währung Bild schlägt Doreen Reid Nakamarra die umgekehrte Richtung ein. Um den Verkauf zu ermöglichen, überträgt sie ihre, nach Tradition der Aborigines auf dem Boden ausgeführten Arbeiten auf Leinwand und speist so die einstige Bodenzeichnung in den globalen Kunsthandel ein.
Die Verwandlung von Erde zu Geld gehört zu den Werken, die das Verhältnis abstrakter und konkreter Werte thematisieren – allen voran die wirtschaftliche Ab- und Aufwertung der Elemente Erde, Wasser, Luft und menschlicher Arbeitskraft.
Ja, aber. Was ist denn nun daran politisch?
Die interdisziplinäre Ausrichtung der dOCUMENTA (13) deutet darauf hin, dass ein Grund für das Scheitern politischer Programme im Outsourcing einzelner Segmente aus dem politischen Aktionsradius liegt. Statt die Anliegen wissenschaftlicher, wirtschaftlicher oder kultureller Bereiche rechtzeitig im politischen Zusammenhang zu thematisieren, werden die Sprengkraft bergenden Felder aus dem politischen Geschehen ausgelagert.
Angesichts dieser Optionen des selbst- und fremdbestimmtem Engagements tendiert die dOCUMENTA (13) zur Funktionalisierung, d.h. zur Anwendung künstlerischer Strategien im Interesse sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Ziele.
Das Plädoyer für die Gleichwertigkeit von Altersgruppen und Kunstgeschichten verschiedener Zeiten und Räume lässt die Hierarchien des Kunstbetriebs anachronistisch scheinen.
Auch die Integration verschiedener Wahrnehmungsformen hat Modellcharakter, da Lösungen für wirtschaftliche und ökologische Probleme eine Erweiterung der auf Menschen zentrierten Sicht erfordern. Solche Lösungen entstehen nicht durch eine bloße Verschiebung von einem Zentrismus zum nächsten, sondern durch ein Auflösen aller auf einzelne Gruppen beschränkten Herrschaftsformen zugunsten horizontaler Verfahren.
All diese Prinzipien – Interdisziplinarität, Einsatz künstlerischer Praktiken zugunsten nicht-künstlerischer Ziele, sowie Dezentralisierung – treten im Rahmen der Ausstellung und der sie begleitenden Veranstaltungen in einer Vielzahl von Varianten in Erscheinung. So werden die vielzitierten Möglichkeitsräume nicht nur angedeutet, sondern auf genuin künstlerische Weise inszeniert.