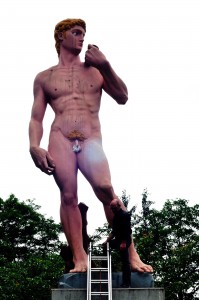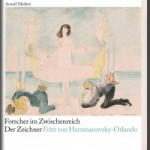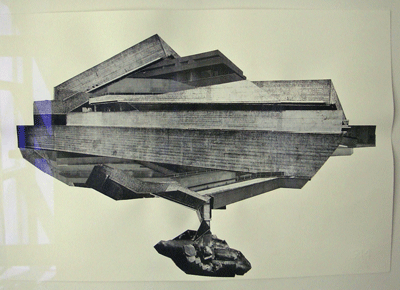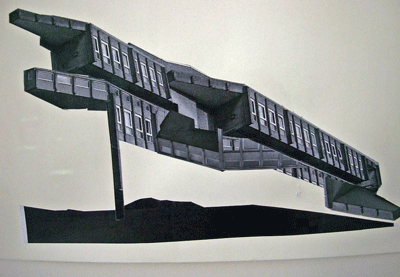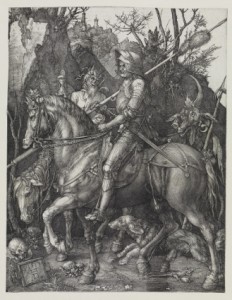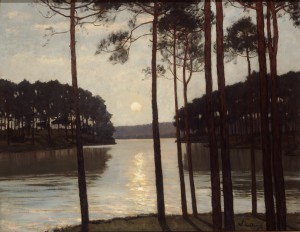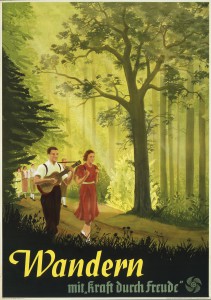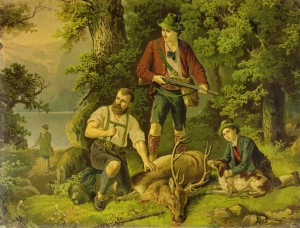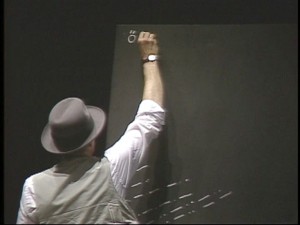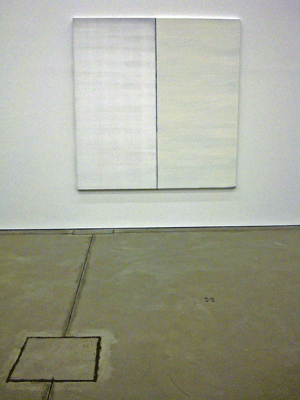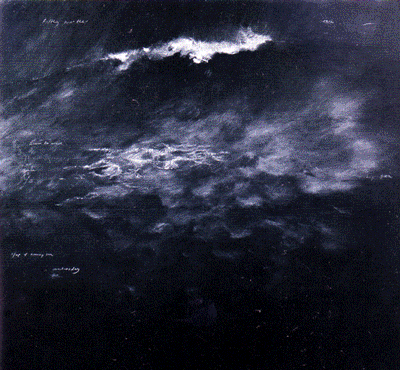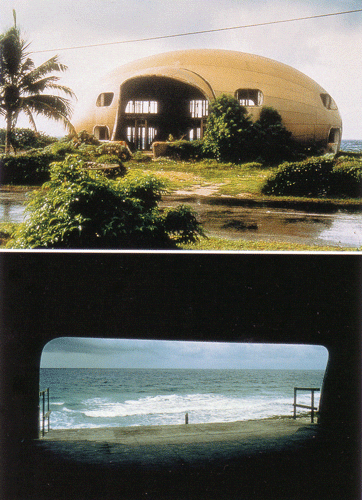In Zeiten wie diesen kommen viele Anleger auf die Idee, ihr Geld zu Kunst zu machen. Kurzfristige Gewinne erzielt damit jedoch vor allem eine Gruppe – die der Berater. Einer Szene auf der Spur.

Kann man sich leisten: Die "Lesende" von Gerhard Richter als Postkarte. Bringt aber kein Geld.
November 2011. Ein abstraktes Bild von Gerhard Richter erzielt bei einer Auktion von Sotheby’s in New York 15 Millionen Euro, fast doppelt so viel wie erwartet. Ein Monat zuvor kam bei Christie’s eines seiner Kerzen-Gemälde unter den Hammer – für 12 Millionen Euro. Gerhard Richter ist 79, und er malt noch immer. Fast jedes Bild, das sein Atelier verlässt, wird seinen Galeristen aus den Händen gerissen. Wohl dem, der einen Richter hat – doch jetzt Richter kaufen?
Wie anders erging es damals Pablo Picasso. Erst zwei Jahrzehnte nach seinem Tod konnte sich die Kunstwelt mit seinem Spätwerk anfreunden. Doch auf dem Kunstmarkt ist Picasso keine sichere Bank: Mal erreichen seine Werke Rekord-Ergebnisse wie im vergangenen Jahr, als ein Käufer für das Ölgemälde „Nackte, Grüne Blätter und Büste“ 106 Millionen Dollar ausgab. Mal zählt er zu den Ladenhütern, wie bei einer Auktion in diesem November.
„Viele glauben, wenn ich einen Picasso habe, habe ich immer ein gutes Bild. Das ist aber nicht so. Es gibt gute und schlechte Picassos, auch nicht so gut verkäufliche. Wir beraten unsere Kunden, dass sie das richtige Bild zu einem realistischen Preis kaufen“, sagt Dr. Stefan Horsthemke. Auch zum derzeit teuersten deutschen Maler hat er eine Meinung: „Die Preise für Richter sind auf einem sehr hohen Niveau. Als Invest würden wir das nur empfehlen, wenn es einem wirklich gut gefällt.“
Es ist offenbar leicht, Geld zu Kunst zu machen, aber eine Kunst für sich, sein Vermögen mit Kunst zu mehren. Dr. Stefan Horsthemke ist kein Künstler. Doch die Kunst, mit Kunst zu verdienen, beherrscht er gut. Kein Wunder nach einem passgenauen Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Kulturmanagement und der Kunstgeschichte, inklusive Dissertation („Das Bild im Bild in der italienischen Malerei“). Erfahrungen mit dem Kunstmarkt sammelte der Kunsthistoriker bei der AXA Art – er versicherte die Werke, bei deren Ver- und Ankauf er nun hilft, bewertete und beriet zahlreiche Privatsammlungen. Nebenbei baute er seine eigene Sammlung zeitgenössischer Kunst auf. Nun hat Horsthemke gemeinsam mit dem Düsseldorfer Kunst-Berater Helge Achenbach und der ältesten deutschen Privatbank, der Berenberg-Bank, die „Berenberg Art Advice“ gegründet. Ein eigenständiges Unternehmen, das sich nicht nur dem Aufbau und der Verwaltung von Sammlungen sowie der Kunstberatung verschrieben hat, sondern das Kunden auch dabei unterstützt, ihr Geld in Öl auf Leinwand zu investieren – und Kapital aus der Kunst zu schlagen. Ein genialer Schachzug für alle Beteiligten. Das prall gefüllte Adressbuchvon Kunstberater Achenbach, der, wie er in einem Interview verriet, seit 15 Jahren nicht mehr akquirieren muss, wurde noch angereichert durch die Sammler-Kontakte Horsthemkes und die Abwicklungsmöglichkeiten über eine Privatbank.
Immobilienblasen können platzen, Aktienbörsen zusammenbrechen, Währungen wertlos werden. Ein Bild bleibt dagegen ein Bild. Auch wenn die Finanzwelt verrückt spielt – mit einem Kunstwerk hat man nicht nur ästhetischen oder dekorativen Mehrwert, sondern besitzt ein Stückchen Kunstgeschichte. Man holt sich die Aura des Originals ins Haus. Und so beantworten Reiche und Superreiche die Frage „Wohin mit dem Geld?“ zunehmend mit „Kunst“. Der internationale Kunstmarkt hat aktuell ein Volumen von 20 Milliarden Euro, in Boom-Jahren wie 2010 können es auch schon mal 43 Milliarden sein. „Das liegt auch daran, dass der Markt internationaler geworden ist, immer mehr Sammler kommen aus Asien, vor allem aus China“, sagt Horsthemke.
Horsthemke spricht mit ruhiger, sonorer Stimme. Seine goldenen Manschettenknöpfe blitzen auf, wenn er während des Gesprächs kurz E-Mails auf dem iPad checkt oder das Klingeln seines iPhones unterdrückt. Die beiden Geräte wirken seltsam aus der Zeit gefallen in dem dunkel-gediegenen Konferenzraum der Stadtvilla direkt am Rhein mit ihrem schmiedeeisernen Gitter und dem Kamera-Auge am Eingang. Seine sorgfältig gegelten grauen Haare und die markante schwarze Brille lassen den 46-Jährigen nicht nur jünger wirken, sondern für einen gebürtigen Westfalen auch ziemlich düsseldorferisch. Wenn Horsthemke unterschreibt, wird daraus eher eine Zeichnung denn eine Signatur. Das ist vermutlich angemessen, wenn man seinen Namen unter Millionen schwere Transaktionen setzen muss.
Leztens hatte er fast wieder so einen Fall. Ein Kunsthändler sprach Stefan Horsthemke an. Er wollte einen Picasso zurückkaufen, den Horsthemke ihm vor zwei Jahren im Auftrag eines Kunden abgekauft hatte. Auf 2,5 Millionen Euro hatte man sich damals geeinigt – ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, fand Horsthemke. Und er hatte recht: Mittlerweile könnte der Kunsthändler das Bild für bedeutend mehr Geld verkaufen. Er bot Horsthemke 3,8 Millionen für das Bild. Horsthemke sprach mit seinem Kunden, dem damaligen Käufer. Eine Rendite von über 50 Prozent in zwei Jahren – ein Traum, sollte man meinen, auch wenn man die hohen Transaktionskosten von 10, bei Auktionshäusern bis zu 35 Prozent berücksichtigt. Doch der Picasso-Besitzer wollte sich nicht trennen. „Seine Liebe zu dem Bild ist gewachsen“, sagt Horsthemke, „ursprünglich hatte der Mann mit Kunst wenig am Hut und wollte nur sein Geld sinnvoll anlegen.“ Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Anleger zum Sammler wird.
Ein betriebswirtschaftlich irrationales Verhalten – und doch ein für diesen Markt typisches. Der Kunstmarkt ist noch unberechenbarer als andere Märkte, was nicht nur am unkalkulierbaren Verhalten der Marktteilnehmer liegt. Anders als bei Aktien oder Immobilien lässt sich der Wert von Kunst nur begrenzt kalkulieren. Und da ist sie wieder, die Frage aller Fragen: Was ist gute, qualitätvolle Kunst? Was ist Kunst wert?
Fragt man Stefan Horsthemke danach, dann klingt alles ganz logisch und transparent. Horsthemke redet von „Art Evaluation Process“ und „Due-Diligence-Prüfung“, einem Verfahren, mit dem man vor einem Kauf verborgene Risiken aufspüren und die Qualität prüfen kann. „Im Falle der Kunst schauen wir, wo das Werk herkommt und wie häufig es bereits gehandelt wurde, wie stark es restauriert wurde, ob es gefälscht sein könnte, und welche Preise es auf dem Kunstmarkt erzielt hat.“ Neulich etwa habe ein Kunde ein bestimmtes Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner im Auge gehabt und um Beratung vor dem Kauf gebeten. Es zeigte sich, dass bei einer älteren Restaurierung Leinwand und Farbschicht des Bildes in Acrylharz getränkt wurden. Die schlechte Restaurierung ließ sich nicht mehr rückgängig machen. „Dadurch war das Bild wertlos geworden“, so Horsthemke, „es kommt für viele Käufer nun nicht mehr in Frage, auch wenn es motivisch interessant ist.“ Natürlich riet er vom Kauf ab.
Doch was, wenn Bilder weder gefälscht noch beschädigt sind? Wie kommt man rechtzeitig dahinter, dass Bilder aller Schaffensperioden von Gerhard Richter Summen erbringen, die der Künstler selbst „unverständlich, albern, unangenehm“ nennt?
Man kann es nur vermuten – also spekulieren. „In der Tate Modern in London läuft eine Richter-Ausstellung, die demnächst nach Berlin kommt, und er wird nächstes Jahr 80 Jahre alt – solche Faktoren spielen in die Bewertung hinein“, sagt Horsthemke, „für viele ist Richter ein zweiter Picasso.“ Aber niemand kann garantieren, das Richter an seinem 107. oder 122. Geburtstag von den Zeitgenossen noch ebenso geschätzt werden wird. Letztlich kann keine noch so gute Qualitätsprüfung die Wertentwicklung vorhersehen. Es ist der Markt, der den Rang eines Kunstwerkes bestimmt, und nicht das Werk selbst. Sobald es jemanden gibt, der bereit ist, Geld auszugeben, steigt der Wert. Ein einfacher Mechanismus.
Wenn man Stefan Horsthemke glauben darf, dann ist er glücklich darüber, dass der Millionen schwere Picasso-Rückkauf nicht zustande kam. „Eine Kunstinvestition“, sagt er, „ist für uns eine langfristige, konservative Anlage und kein kurzfristiges Spekulationsobjekt.“ Man sollte nur kaufen, was zu einem passt und einem gefällt, findet er, und es mindestens fünf, besser zehn Jahre halten – am liebsten noch länger. Kunstwerke, die Berenberg Art Advice als Geldanlage empfiehlt, haben alle eines gemein: Sie entstanden vor 1945. Ihre Schöpfer sind tot, ihr Stellenwert auf dem Kunstmarkt ist geklärt. „Wenn man die wichtigen, großen Künstler nimmt, die in Museen und Sammlungen vertreten sind, und auf gute Qualität achtet, kann man wenig falsch machen“, sagt Horsthemke. Große Wertverluste sind dann ebenso wenig zu erwarten wie große Steigerungen: Mal steht Renaissance-Künstlern eine Renaissance bevor, weil die Ausstellung „Gesichter der Renaissance“ im Berliner Bode-Museum das Interesse neu entfacht. Mal sind es die Impressionisten, die wieder im Interesse steigen. Natürlich muss man für Kunst dieser Kategorie tiefer in die Tasche greifen. Die Kunden von Berenberg Art Advice können das. Ihre Kunden investieren mindestens 100.000 Euro jährlich in Kunst. Zwischen fünf und zehn Prozent des Verkaufspreises landen als Beratungsgebühr bei Berenberg Art Advice.
Immer mehr Kunden wollen jedoch etwas anderes. Sie sind auf der Suche nach junger, zeitgenössischer Kunst, nach dem ultimativen Geheim-Tipp, der sich top entwickeln wird. „Ich werde das sehr oft gefragt, auch von Künstlern selbst“, sagt Horsthemke und schaut sehr ernst durch seine schwarze Brille. „ Kunstspekulationen sind für uns ein No-Go-Thema. Damit macht man Kunst zur Ware und zerstört jungen Künstlern den Markt.“ Beispiele dafür gebe es genug, seit Christie’s und Sotheby’s vor 15 Jahren damit begonnen hätten, auch sehr junge zeitgenössische Kunst zu versteigern. Zu viele Künstler seien zu früh auf dem so genannten zweiten Markt, dem Auktionsmarkt, gehandelt worden, anstatt nach und nach über Galerien ihre Weg in Sammlungen zu finden.
Kunst als Ware – ist das nicht die Basis des Geschäftsprinzips von Berenberg Art Advice? Diesen Umstand möglichst auszublenden, ist noch so eine Eigenheit der Akteure auf dem Kunstmarkt. Auch Horsthemke spricht lieber davon, wie glücklich das Sammeln von Kunst macht, welche Lebensfreude es bringe und wie wichtig die richtige Vermittlung von Kunst sei.
Viele Künstler sind da längst einen Schritt weiter. Jeff Koons oder Damien Hirst spielen mit den Mechanismen und Funktionsweisen des Marktes, der Flirt – wenn nicht gar der Beischlaf – mit Markt und Kommerz ist zu ihrem Markenzeichen geworden. Damit stehen sie in der Tradition Andy Warhols, der bewusst die Grenzen zwischen Kunst und Kommerz verwischte, und das weit über seinen Tod hinaus: Nie war er so teuer wie heute, was vor allem an den Absprachen der größten Warhol-Sammler untereinander liegt.
Wer sehr viel Geld in Kunst investieren will, dem raten Horsthemke und seine Kompagnons nicht zu Warhol, sondern eher dazu, sich an Ankäufen großer, teurer Werken zu beteiligen, die anschließend zum Beispiel an Museen ausgeliehen werden. Allerdings ist man auch dann vor bösen Überraschungen nicht gefeit. In Dortmund schrubbte unlängst eine Putzfrau Martin Kippenbergers Installation „Wenn’s anfängt durch die Decke zu tropfen“ kaputt. Das Werk war die Leihgabe eines anonymen Sammlers und ist nun irreversibel beschädigt. Dass die Versicherungssumme 800.000 Euro beträgt – ein für die kunstferne Öffentlichkeit unglaublicher Betrag angesichts des mageren Materialwertes aus einigen Brettern und einer rostigen Wanne – dürfte den Leihgeber kaum trösten, zumal die Installation nach Ansicht Horsthemkes stark unterbewertet war.
Der Text erschien zuerst in der Dezember-Ausgabe des NRW-Kulturmagazins K.West.
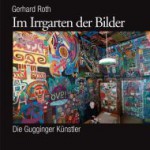 Rechtzeitig vor dem Geburtstag Gerhard Roths, des bedeutenden österreichischen Schriftstellers, der am 24. Juni 70 Jahre alt wurde, erschien im Mai im Residenz Verlag ein opulenter Text– , Bild– und Foto–Band: Gerhard Roths „Im Irrgarten der Bilder / Die Gugginger Künstler“.
Rechtzeitig vor dem Geburtstag Gerhard Roths, des bedeutenden österreichischen Schriftstellers, der am 24. Juni 70 Jahre alt wurde, erschien im Mai im Residenz Verlag ein opulenter Text– , Bild– und Foto–Band: Gerhard Roths „Im Irrgarten der Bilder / Die Gugginger Künstler“.