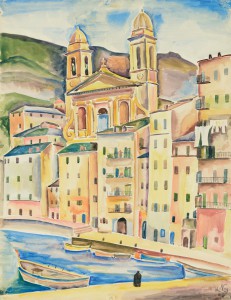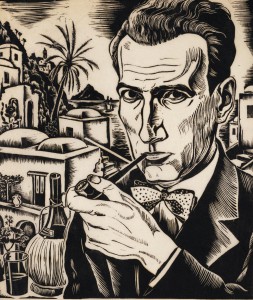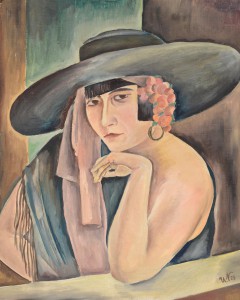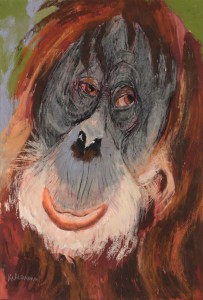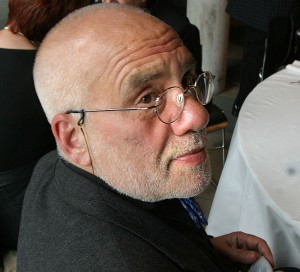Ein Wrack namens Scarpia – Gelsenkirchen zeigt „Tosca“ in ungewöhnlicher Lesart

Für Scarpia (Aris Argiris, v.) ist das „Te Deum“ ein einziges Höllenspektakel. Foto: Pedro Malinowski
Der Mann ist am Ende. Ein Wrack, wie er dasteht, etwas gebeugt, mit strähnigen Haaren, von Dämonen besessen, von einer Obsession getrieben. Sein erster Auftritt ist so, als hätte ihn die nahe Menschenmasse ausgespien. Und dieser müde Außenseiter soll der gefürchtete Baron Scarpia sein? Der Polizeichef Roms als fieser Strolch? Das ist mal eine Umdeutung in Giacomo Puccinis Oper „Tosca“, die wir so noch nicht gesehen haben.
Regisseur Tobias Heyder zeichnet am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen (MiR) für diese Lesart verantwortlich, und so wie Scarpia ganz artfremd als schmieriger, gebeutelter Strippenzieher dasteht, sind auch die anderen Hauptfiguren dieses Dreiecksdramas mit politisch-historischem Hintergrund relativ frei ausgestaltet. Tosca zeigt kaum Spuren innerer Verletzbarkeit, ihre Eifersucht ergeht sich bisweilen in seltsam maskulinen Posen, ihre Rache (Scarpias Ermordung) speist sich nur aus milder Verzweiflung und gebremstem Furor. Ihr Geliebter, der Maler Cavaradossi schließlich, ist ein eher ungelenker, fast nüchterner Antiheld, ein Freigeist der naiven Art, der seinem politisch verfolgten Freund Angelotti nahezu geschäftsmäßig hilft.
Jeder leidet für sich allein, scheint das Fazit der Regie, zumal die Interaktion der Beteiligten mehr nebeneinander her läuft, mit geringen Blickkontakten und einer nahezu aseptischen körperlichen Nähe. Tosca in Scarpias Armen, die Erfüllung seiner Obsession, wirkt wie pure Hilflosigkeit, nicht wie die pralle Gier. Und wenn die Frau ihrem vermeintlichen Bezwinger das Messer in die Rippen stößt, fehlt der Szene die Eiseskälte der Täterin ebenso wie die Schockstarre des Opfers.
Toscas Paralyse hingegen setzt erst ganz zum Schluss ein. Wenn sie feststellen muss, dass ihr Geliebter nicht zum Schein, sondern tatsächlich erschossen wurde. Dann zieht und zerrt sie an ihm herum, die Menge, die bereit ist, sie zu lynchen, nicht mehr beachtend. Der Sprung der Tosca von der Engelsburg fällt aus.

Tosca (Petra Schmidt) und der von der Folter gezeichnete Cavaradossi (Derek Taylor). Im Hintergrund Scarpias Helfer Spoletta (William Saetre). Foto: Pedro Malinowski
Darüber mag mancher im Publikum die Nase rümpfen wie auch über Scarpias Deformation, die bisweilen in tranceartige Zustände mündet. Verbunden damit sind indes starke, teils verstörende Bilder. Nicht nur in dem Sinne, dass der Maler Cavaradossi riesige Gemälde mit nackten Frauen produziert – Ausstatter Tilo Steffens hat ein entsprechend großformatiges Exponat auf die Bühne gewuchtet, das „Nudes“ im Stile Helmut Newtons zeigt. Sondern auch dergestalt, dass das berühmte „Te Deum“ zum Finale des 1. Aktes zum Höllenspektakel wird, als hätte Hieronymus Bosch seine Gespenstergestalten losgelassen. Scarpia, so ist wohl die Botschaft, hat sich dunklen Mächten hingegeben. Die Symbolkraft des Katholizismus ist für ihn einzige Pein.
Dazu passt, dass im 2. Akt, in seinem Palast, die Gemälde alter Meister abgehängt sind. Der Gott anrufende Chorgesang, der zwischenzeitlich erklingt, dröhnt dem Finsterling in den Ohren. Mag er auch Trost suchen in den Armen einer Nonne (eines Engels?) und dabei der „Erbarme Dich…“-Arie aus Bachs „Matthäuspassion“ lauschen, Frieden findet dieser Mensch im Diesseits wohl nicht mehr. Und sein Tod wird einhergehen mit dem Ende der Despotie in Rom, eingeleitet durch Napoleons Sieg. Die Exekution Cavaradossis, das Übermalen seiner Nackten, ist nur ein letztes Aufzucken des alten Regimes.
Insofern hat diese Produktion durchaus politischen Charakter. Wenn dieser auch durch die Personenführung nicht explizit beglaubigt wird. Andererseits versagt sich Regisseur Tobias Heyder die konsequente Psychologisierung.
Neben Scarpia wirken seine Gegenspieler blass. Sollte also Puccinis Oper hier lieber „Scarpia“ heißen? Ganz falsch wäre das nicht. Denn ein musikalisches Gerüst dieser Verismo-Oper sind gewiss die wuchtigen Akkordschläge, die den Bösewicht kennzeichnen. Andererseits hat der Komponist sein Werk mit sanfter Liebeslyrik ausklingen lassen – ein Zeichen der Hoffnung gegen die brutale Despotie.
Wuchtige Dramatik und sensible, leidenschaftliche Schwingungen: Das klingende Spektrum ist bei Dirigent Rasmus Baumann und der Neuen Philharmonie Westfalen in allerbesten Händen. Hier spielen sich aller Hass, alles Aufbegehren und innige Liebe ab. Entäußerungen, die der Regisseur den Figuren teils versagt, haben ihren Platz in der musikalischen Umsetzung. Der tönende Bruitismus ist von unglaublicher Schärfe. Die Mordszene (Tosca-Scarpia) gewinnt nur im Orchester wirklich erschreckende Kontur. Im Graben wüten die emotionalen Wechselbäder.
Mithalten kann da nur Aris Argiris als Scarpia. Die baritonale Mittellage verfügt über schneidende Kraft. Doch fehlt der Stimme einerseits dämonische Tiefe, zum anderen das schmierige Parlando eines Gauners. Derek Taylor singt den Maler höhensicher, wirkt gleichwohl angestrengt. Große, frei gestaltete Legatobögen sind seine Sache nicht. Da hat Petra Schmidt in der Titelpartie durchweg mehr zu bieten. Leuchtende Glut, ein Mezzoton zum Fürchten, schöne Stimmführung. Schade nur, dass ihre große Arie „Vissi d’arte“ so gleichförmig und introvertiert klingt. Aber das passt ja wohl zum Ansatz der Regie.
Der große, in sich gerundete Wurf ist die Gelsenkirchener „Tosca“ also nicht. Eher der, durchaus diskussionswürdige, Versuch einer unkonventionellen Annäherung. Gleichwohl gilt: Unbedingt hingehen, allein schon wegen des famosen Orchesters.
Nächste Aufführungen: 27. Dezember 2015 (15 Uhr), 2. Januar, 14. Januar, 16. Januar und 5. Februar 2016 (jeweils 19.30 Uhr). Infos: http://www.musiktheater-im-revier.de/Spielplan/Oper/Tosca/
Sich in Faultiere und Birnen einfühlen – ja, selbstverständlich geht das!
Weckerbrüllt! Uff… nur… ne Viertelstunde noch… konzentriert schlafen (jawoll, das geht)…
…wenn dann Kater Schorsch sein aggro-beleidigtes MRRRRRAAUU! MRRRRRAAUU! MRRRRRAAUU! raushaut ohne Luft zu holen, weil er der Meinung ist, daß er sogleich Hungers stirbt, wenn ich ihn nicht sofort fütter (Essenszeit für ihn in zwei Stunden!), hau ich mein 100% aggro RUHEJETZTVERDAMMTESCHEIßE! raus, daß die metallenen Bettpfosten mitsingen.
Es kümmert ihn zwar keinen feuchten Kehricht, aber immerhin hab ich das erhebende Gefühl, daß mir wenigstens ein Ding auf Erden Resonanz gibt – und wenn’s nur die Bettpfosten sind.
Wenn ich dann allerdings zB versuche, mich in ein Faultier einzufühlen, weil ich einen Faultiershirtentwurf machen muß und das Vieh so richtig schön faul werden soll oder das gleiche in drei Birnen für eine Auftragszeichung, damit da auch wirklich die richtige Geschichte erzählt wird mit dem Obst (ja freilich kann man sich in Birnen einfühlen. Bin ich Künstler oder Hobby-?) und der schwarze Pelzsatan legt dann los mit seinem Geschrei (wofür er in 99% aller Fälle exact (ja, mit »c«)) den richtigen Zeitpunkt findet und auch nicht eher aufhört, bis ich entweder keine Zeit mehr hab oder mir auch noch das letzte bissl Muse zerrüttet ist), packt mich einfach nur noch tiefste Verzweiflung und eine Stimme fragt in mir:
»Was hätt Picasso an meiner statt getan? Oder Matisse? Oder Cezanne? Oder Christian Schad? Oder…« (Zwischenruf einer anderen Stimme: »Charles Manson?«) und es antwortet: »Sie wären ins Atelier gegangen und wenn sie da schon gewesen wären, in ’n anderes.«, dann kommentiert die nächste: »Thomas, schreib auf deinen ‹Ziele 2016›-Zettel ganz oben, ganz groß: ‹1. Viel Geld verdienen, 2. Atelier mieten›.«
Done.
(Also das mit dem Zettel.)
Liebevoll-ironische Würdigung des Künstlers: Tilman Spengler über Jörg Immendorff
Jörg Immendorf war (und ist) einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart. Sein Schaffen umfasst Malerei, Bildhauerei, Grafik und Aktionskunst. Er starb 2007, in seinen letzten Jahren galt er als Begründer einer neuen deutschen Historienmalerei, immer aber hatte sein Werk politischen Bezug und gesellschaftskritischen Inhalt. Bevor er an amyotrpher Lateralsklerose („ALS“) erkrankte, führte er ein schonungsloses, in der Außenwirkung ab und an auch exzessives Leben. Ausgelassen hat er jedenfalls wenig.
Der gebürtige Oberhausener Tilman Spengler ist ein vielfach ausgezeichneter deutscher Publizist. Einem breiterem Publikum ist der studierte Politikwissenschaftler und Sinologe wohl durch die Fernsehreihe „Klassiker der Weltliteratur“ bekannt.
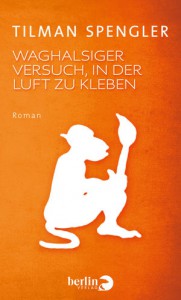 Mit seinem Buch „Waghalsiger Versuch, in der Luft zu kleben“ hat Tilman Spingler nun seinem verstorbenen Freund Jörg Immendorf eine ganz besondere Schrift gewidmet. Es ist eher eine fiktionale als klassische Biographie, aber von Wahrheit und Wahrheiten geprägt. Spengler zeichnet ein persönliches und sicher gerade dadurch wahrhaftiges Bild des Jörg Immendorff und der Zeit, in der der Künstler lebte, an der er litt und die er prägte.
Mit seinem Buch „Waghalsiger Versuch, in der Luft zu kleben“ hat Tilman Spingler nun seinem verstorbenen Freund Jörg Immendorf eine ganz besondere Schrift gewidmet. Es ist eher eine fiktionale als klassische Biographie, aber von Wahrheit und Wahrheiten geprägt. Spengler zeichnet ein persönliches und sicher gerade dadurch wahrhaftiges Bild des Jörg Immendorff und der Zeit, in der der Künstler lebte, an der er litt und die er prägte.
Das Buch gliedert sich in 15 Tableaus, beginnend mit der Taufe Immendorffs, endend mit seiner Trauerfeier. Jede Station ist eine Hommage an den großen Künstler. Nicht moralinsauer, auch nicht moralisierend, sondern – schlicht und einfach vergnüglich. Spengler beherrscht die große Kunst des zärtlich-ironischen Erzählens, der waghalsige Versuch würdigt Immendorff ebenso, wie er ihn und den um ihn herum irrlichternden Politik- und Kulturbetrieb auf die Schippe nimmt. Man spürt die Verehrung, aber auch die Freundschaft, die Spengler Jörg Immendorff entgegenbringt, in jeder Zeile. Ebenso wie das Vermissen.
Spengler schreibt Immendorff folgende Interpretation des Begriffes Kunst zu: „Wenn man beim Betrachten oder Hören oder auch beim Lesen eines Werkes der Kunst nicht an Kunst denken muss, und zwar keine einzige, nicht einmal den Bruchteil einer Sekunde lang, erst dann begreift man Kunst.“ Immendorffs Werke waren so, genau so. Man sah seine Werke und dachte nicht darüber nach, wie der Künstler das wohl und womit geschaffen hat, sondern man war davon berührt (oder auch nicht) und dachte darüber nach, wie man mit dem, was dieses Werk einem sagte, umgehen wolle. Immendorffs Kunst war alltagstauglich in einem guten Sinne.
Eine persönliche Anmerkung: Im dänischen Blavand steht an dem Strand, an dem sich Nordsee und Wattenmeer trennen, ein alter Bunker. Diesen Bunker ziert – siehe Foto – ein Graffito von Jörg Immendorff, dem Cover des Buches verwandt. Ich fand es in einem Urlaub dort großartig, jeden Tag daran vorbeizugehen und es sprach mich, die ich vieles, aber keine Kunstkennerin bin, auf eine sehr besondere Weise an. Wir betitelten das Graffiti als den „Friedensaffen“ und ganz gleich, was immer Immendorff auch zu diesem Zeichen bewog, das ist für mich Kunst, die mich berührte und die ich für mich begreifen konnte.
Genauso ergeht es einem nun mit dem Buch Tilman Spenglers. Man liest es gerne, man liest es neugierig, man denkt über den Künstler und seine Intentionen nach. Eines der schönsten, liebevollsten Bücher des Jahres.
Tilman Spengler: „Waghalsiger Versuch, in der Luft zu kleben“. Berlin Verlag, 160 Seiten, 18 €.
Rückkauf für Dortmund – ein lange verschollenes Gemälde und viele Geschichten
„Wir sind jetzt heiß geworden“, sagt Klaus Fehlemann mit leicht ironischem Beiklang. Wenn ein distinguierter Mensch wie Dortmunds ehemaliger Stadtdirektor sich so kräftig ausdrückt, dann muss wohl etwas besonders Erfreuliches, ja Herzwärmendes geschehen sein; etwas, das möglichst eine Fortsetzung finden sollte…

Heinrich Nauens Bild „Sonnenblumen mit welker Kresse“ (um 1924), enthüllt: Stadtdirektor und Kulturdezernent Jörg Stüdemann mit der Provenienzforscherin Dr. Ulrike Gärtner und Klaus Fehlemann (re.), dem Vorsitzenden der Freunde des Museums Ostwall. (Foto: Bernd Berke)
Fehlemann ist heute Vorsitzender des Vereins Freunde des Museums Ostwall, welches sich bekanntlich im Dortmunder „U“ befindet. Dem Freundeskreis ist es jetzt gelungen, ein lange verschollenes, doch staunenswert gut erhaltenes Bild für Dortmund zurückzukaufen: Bis 1937 hatte Heinrich Nauens Gemälde „Sonnenblumen mit welker Kresse“ (entstanden um 1924) zur Sammlung des damaligen Dortmunder Museums für Kunst und Kulturgeschichte am Ostwall gehört.
Unverhofft wieder auf dem Markt
Doch im August 1937 wurde das Stillleben des rheinischen Expressionisten Nauen (1880-1940) – wie so viele andere Kunstwerke in ganz Deutschland – von den Nazis im Rahmen einer schändlichen Maßnahme als „Entartete Kunst“ beschlagnahmt und aus dem Museum entfernt. Nach einem erfolglosen Verkaufsversuch im Auftrag des NS-Propagandaministeriums verlor sich die Spur des Bildes für viele Jahrzehnte. Irgendwann muss es in niederrheinischen Privatbesitz gelangt sein.
Just im November 2015, also etwas über 78 Jahre nach der Beschlagnahme, tauchte das Werk unverhofft wieder auf dem Kunstmarkt auf. Der wertvolle Hinweis aufs Angebot einer Düsseldorfer Kunsthandlung kam von einem aufmerksamen Nutzer der Internet-Seite www.alfredflechtheim.com.
Zweifelsfrei echt
Dann ging alles sehr rasch: Sehr zügig konnte die erfahrene Dortmunder Provenienzforscherin Dr. Ulrike Gärtner das Bild zweifelsfrei identifizieren und zuordnen. Eine Schwarzweißfoto von 1926 wies die Richtung, auf der Gemälde-Rückseite war die passende, allzeit unveränderte Inventarnummer zu finden, auch die Signatur und weitere Merkmale stimmten.
Flugs handelten daraufhin auch die Freunde des Museums, die das – auch von anderen Interessenten ins Auge gefasste – Bild binnen 98 Stunden für eine Summe erwarben, über die Stillschweigen vereinbart wurde. Sie liegt „im unteren fünfstelligen Bereich“.

Heinrich Nauen: „Sonnenblumen mit welker Kresse“, um 1924 (Museum Ostwall/Foto: Sascha Fuis Photographie, Köln)
Man mag unter ethischen und rechtlichen Gesichtspunkten darüber sinnieren, warum für die Stadt ein Werk zurückgekauft werden muss, das ihr doch eigentlich gehört hat. In der Praxis geht es wohl nicht anders. Apropos Legalität: Die NS-Machthaber hatten die Beschlagnahmung der als „entartet“ verfemten Kunstwerke rein formaljuristisch durch ein Gesetz vorbereitet. Kaum zu glauben, was im Namen des (gebeugten) Rechts möglich war…
Alfred Flechtheims Verbindung zur Stadt
An das Bild knüpfen sich noch weitere Geschichten, beispielsweise diese: Es kam durch den damals wohl wichtigsten deutschen Kunsthändler nach Dortmund. Alfred Flechtheim betrieb avancierte Galerien in Düsseldorf und Berlin. Er war mit dem damaligen Dortmunder Museumsdirektor Prof. Braun befreundet, dem er auch manche Schenkung zukommen ließ.
Was wahrlich nicht allgemein bekannt ist: Sowohl Flechtheims Mutter als auch seine Frau stammten aus Dortmund. Da kann man geradezu in lokalen Zusammenhängen schwelgen: Ursprünglich Getreidehändler, hatte Flechtheim häufig an der Dortmunder Getreidebörse zu tun, der größten des Ruhrgebiets. Hier lernte er das Regionalgericht Pfefferpotthast schätzen. Auch zählte der Förderer des zeitweise weltmeisterlichen Boxers Max Schmeling Sportereignisse in der Dortmunder Westfalenhalle zu seinen liebsten Freizeitvergnügen.
Weitere Werke auf der Verlustliste
Zurück zu Heinrich Nauens farbkräftigem Bild, das sich bestens zum expressionistischen Schwerpunkt des Museums Ostwall und speziell zu vier bereits vorhandenen Nauen-Zeichnungen fügt. Dortmunds Stadtdirektor und Kulturdezernent Jörg Stüdemann sowie Regina Selter (kommissarische Leiterin) und Dr. Nicole Grothe (Sammlungsleiterin) vom Ostwall-Museum zeigten sich denn auch hoch erfreut übers vorweihnachtliche Bildergeschenk, das heute mit gemessener Feierlichkeit in der Restaurierungswerkstatt des Dortmunder „U“ enthüllt wurde. Medienleute mögen solche Momente. Irgendwie.
Thema erschöpft? Nein, immer noch nicht ganz: Schon lange zuvor sind drei Gemälde von Christian Rohlfs in die Stadt zurückgekehrt. Doch auf der Liste der 1937 beschlagnahmten und seither verschollenen Kunstwerke aus Dortmunder Besitz stehen noch weitere 7 Gemälde, 81 Grafiken, 25 Grafikmappen und eine Skulptur. Besagte Provenienzforscherin Dr. Ulrike Gärtner spürt übrigens nicht nur detektivisch den verschlungenen Wegen dieser Bilder nach, sondern versucht auch zu ermitteln, welche „Raubkunst“ die Stadt ihrerseits eventuell an rechtmäßige Besitzer bzw. deren Erben zurückgeben muss. Ein weites Feld.
So. Nun aber genug der vielfältigen Verzweigungen. Jetzt wollen Sie das Werk von Heinrich Nauen wahrscheinlich bald in Dortmund besichtigen, nicht wahr? Schade, aber das wird nicht gehen. Zuerst muss es restauriert und neu gerahmt werden. Es soll, so die bisherigen Pläne, erst nach der nächsten Umsortierung der Schausammlung zu sehen sein, so ungefähr im Frühjahr 2017. Vielleicht geht’s ja doch ein bisschen früher?
_____________________________________________
Ein Hinweis zur genaueren (vergrößerten) Betrachtung des Gemälde-Fotos findet sich hier.
„Platz des europäischen Versprechens“ – Jochen Gerz‘ Konzeptkunstwerk wird in Bochum eröffnet
Die Idee von Europa steht mehr denn je auf dem Prüfstand. Gastautorin Isabelle Reiff über Jochen Gerz‘ Konzeptkunstwerk „Platz des europäischen Versprechens“, das nach rund zehn Jahren Vorbereitung am kommenden Freitag in Bochum eröffnet werden soll – offenbar genau zur rechten Zeit.
Erst der drohende Grexit, jetzt Flüchtlingskrise und Terroralarm. Eine harte Bewährungsprobe für Europas Selbstverständnis: Machen wir die Grenzen dicht, aber TTIP & Co. klar? Oder beziehen wir Stellung gegenüber den USA und tragen Verantwortung als Mitverursacher der Konflikte im Nahen Osten?
„Die Teilung der Welt in Künstler und Betrachter gefährdet die Demokratie“, sagt der Konzeptkünstler Jochen Gerz; ebenso wie die Teilung in Regierung und Regierte.

Jochen Gerz: „Platz des europäischen Versprechens (2004-2015), Bochum. (© Jochen Gerz, VG Bild-Kunst, Bonn 2015. Courtesy: Gerz studio, www.jochengerz.eu. Foto: Ayla Wessel, Bochum)
Könnte es einen passenderen Zeitpunkt geben, um einen Ort einzuweihen, der „Platz des Europäischen Versprechens“ heißt? Die Rede ist vom Platz vor einem geschichtsträchtigen Sakralbau: Der Glockenturm der Christuskirche war das einzige Bauwerk in Bochums Innenstadt, das 1945 nicht in Schutt und Asche lag. Dennoch blieb das Innere 60 Jahre lang jeder Einsicht entzogen. Zwei Weltkriege hatte der Turm überstanden und diente dann nur noch als Abstellkammer. Grund ist die in den Jahren 1929-1931 erfolgte Umwidmung in eine Heldengedenkhalle: An den Wänden sind noch immer die Namen von 1358 Gefallenen und die Namen der „Feindstaaten“ der Deutschen im Ersten Weltkrieg zu lesen.
Als es in Bochum 2005 im Rahmen eines Landeswettbewerbs darum ging, den Kirchplatz – bis dahin halb Baustelle, halb Parkplatz – endlich zu verschönern, schlug der Gemeindepfarrer Thomas Wessel den Künstler Jochen Gerz als Gestalter vor. Gerz ist vor allem bekannt für seine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.
14726 Unterschriften für eine neue Vision
Gerz sah das Innere dieses Glockenturms und entschied: In diesem Raum fängt der Platz an. Sein Konzept für ein Kunstwerk, das dem Turm eine dritte Namensliste einschreibt und aus ihm heraus führt, erhielt den Zuschlag – mit Tausenden Unterschriften heute Lebender, die der alten Geschichtsauffassung von Feinden und Krieg eine neue Vision gegenüberstellen.

Jochen Gerz: „Platz des europäischen Versprechens“ (Detail einer Steinplatte mit Namensinschriften). 2004-2015, Bochum. (© Jochen Gerz, VG Bild-Kunst, Bonn 2015, Courtesy: Gerz studio, www.jochengerz.eu, Foto: Sabitha Saul, Dortmund).
Welche Zusage sie Europa gemacht haben, blieb unausgesprochen. Dennoch haben 14726 Menschen teilgenommen. „Diese Verschwiegenheit ist ja nicht identisch mit Unverbindlichkeit“, findet Kurt Wettengl, langjähriger Leiter des Ostwall-Museums in Dortmund. „Sollte ich mein Versprechen nicht einhalten oder brechen, muss ich es mit mir ausmachen und ich mich wieder daran erinnern. Unser aller und damit auch meine Mitverantwortlichkeit für die Gestaltung der Zukunft – Europas – macht das Bochumer Denkmal deutlich.“
600 Namen sind in der ersten Bodenplatte im Turm eingraviert. Ihre Abmessung bildet die Matrix für alle Steinplatten, die nachfolgten und jetzt (insgesamt sind es 20) den Vorplatz mit Namen füllen. „Dieser Platz ist für mich eine Gelegenheit, meine Anteilnahme kund zu tun“, begründet Rotraud Burchhardt-Kamplade, eine der ersten Versprechensgeberinnen. „Europa ist der kleinste Kontinent, und doch haben hier die meisten Kriege stattgefunden. Dass von Europa heute Frieden ausgeht, das liegt mir am Herzen.“
Ein Bündnis für den Frieden
Der „Platz des europäischen Versprechens“ ist gedacht als großes, demokratisches Manifest für ein Europa, das aus seiner blutigen Vergangenheit gelernt hat und auch andernorts keine Kriege führt. Deutschland ist das passende Land für so einen Platz, erst recht NRW. Keine Woche vergeht, in der nicht wieder Bomben aus einer Zeit auftauchen, als die einstige Industriehochburg unter Beschuss lag. Und während wir hier alte Blindgänger entschärfen, gelangt neue Munition auf andere Kontinente: Es sind ja sogar nicht zum geringen Teil deutsche Waffen, die jetzt auf uns zurückzielen.
Wo kann das Umdenken anfangen? Bei den Politikern? So denken die meisten. Ich auch, und das drückt auch meine Frustration aus. Ich konnte erst wenig mit dem Konzeptkunstwerk „Platz des Europäischen Versprechens“ anfangen – zu intellektuell, zu erklärungsbedürftig kam mir das Ganze vor. Jetzt tut es mir leid, dass meine Unterschrift fehlt, allein um dieses Zeichen zu setzen: „Krieg kann keine Lösung sein!“
Tatsächlich hat mich die Beschäftigung mit diesem Platz dazu gebracht, meine Anti-Haltung gegenüber Europa (hervorgerufen durch die Regulierungswut und den Sparzwang, der auf Kosten so vieler geht) hinter mir zu lassen und mich rückzubesinnen auf das, wozu Europa im allerersten Schritt gedacht war: als ein Bündnis für den Frieden.
(Der Platz wird am kommenden Freitag, 11. Dezember, um 17 Uhr offiziell eröffnet).
Auf Ischia der Welt entfliehen – Arbeiten von Ulrich Neujahr in Haus Opherdicke
Was fällt einem ein zu diesem Künstler, nachdem man die Ausstellung gesehen hat? Vielleicht dies: daß der Begriff „holzschnittartig“ für seine Holzschnitte nicht gilt. Licht und durchgezeichnet sind sie, egal, ob sie Menschen oder Landschaften zeigen. Nur wenige Linien blieben im Holz stehen, um beispielsweise 1929 „Gerda“, qualmende Zigarette in der Rechten, druckreif zu machen. Auf den ersten Blick könnte dies auch eine Kohlezeichnung sein. Und selbst ein „Mond über Sant’Angelo“ (ohne Jahr) ist trotz seines Themas ein Bild der leuchtenden Konturen und Schraffuren, nicht der Nacht.
Die lichte, Schatten vermeidende Bildauffassung zieht sich über Jahrzehnte hin wie ein roter Faden durch das Werk Ulrich Neujahrs. Gut 90 Arbeiten sind jetzt in Haus Opherdicke ausgestellt, Aquarelle, Öl, Kohle, Holzschnitte. Vorwiegend stammen sie aus dem Nachlaß, aus dem Sohn und Tochter je um die 400 Arbeiten besitzen; drei Bilder kamen aus der Sammlung Brabant, aus der ja häufiger schon Teile in Opherdicke gezeigt wurden.
Bruchlose Biographie
In den Beständen der Sammlung Brabant, so könnte man wohl sagen, machten Sigrid Zielke-Hengstenberg und Thomas Hengstenberg als Kuratoren des Kreises Unna eine erste Bekanntschaft mit dem Schaffen Ulrich Neujahrs, der nicht so vielen Kunstinteressierten bekannt sein dürfte. Neujahr, er lebte von 1898 bis 1977, hatte in den 20er Jahren zunächst Architektur in Berlin studiert, nach dem Vordiplom (wie man heute vielleicht sagen könnte) jedoch auf Freie Malerei und Angewandte Kunst umgesattelt. Er wurde Kunstlehrer am Gymnasium und betätigte sich nebenher als produktiver Künstler, der ungern Werke fortgab, wie sich seine Tochter Cecilia erinnert, und dies dank der auskömmlichen Lehrerstelle auch nicht mußte.
Bekannt war er mit Größen der Malerei wie Eduard Bargheer und Werner Gilles, häufig besuchte er das legendäre Romanische Café, er hatte Frauen und Kinder, und alles in allem hinterläßt seine Biographie einen überaus bruchlosen Eindruck. Gravierende Probleme mit den Nazis gab es anscheinend nicht, auch hat diese dunkle Zeit der deutschen Geschichte ganz offenbar keine Spuren im Oeuvre hinterlassen, das von erstaunlicher Kontinuität ist.
Ein Atelier in Sant’Angelo
Von zentraler Bedeutung ist in Ulrich Neujahrs Werk die Liebe zum Süden, vor allem zur italienischen Insel Ischia, die er in den 30er Jahren für sich entdeckte und wo er einen Großteil seines Lebens verbrachte – vor allem nach 1963, als er in den Ruhestand ging.
Im Fischerdorf Sant’Angelo hatte er sein Atelier mit Traumkulisse. Wer durch die Ausstellung streift, spürt schnell, wie sehr dieser Maler die Menschen, die Farbigkeit, das Licht, die Schönheit der Orte, die Spuren der alten Zivilisation liebte. Das eine oder andere Bild mag gar zu lieblich wirken, und manchmal vermeint man leise Rudi Schurickes „Caprifischer“ zu vernehmen. Doch so ist das eben mit den Sehnsuchtsorten. Und manchmal auch mit den zu Lebzeiten erfüllten Träumen eines Malers.
Neben den südlichen Bildern sind die Portraits und unter ihnen vor allem die Selbstportraits ein wesentlicher Schwerpunkt des Werks. Seit den frühen 20er Jahren bis kurz vor seinem Tod malte sich Neujahr immer wieder, und stets spiegeln diese Selbstportraits (meistens mit Pfeife) ein starkes Selbstbewußtsein. Der Mann, der sich hier zeigt, scheint nicht eben auf quälender Suche nach sicht selbst gewesen zu sein.
Mit Ausnahme einiger musikalischer Strukturen aus den 60er Jahrendie neue – Frau, die spät er noch geehelicht hat, war Musikerin – bleibt das Oeuvre Neujahrs im Naturalistischen verhaftet. Allerdings wird hie und da durchaus Zeitströmung sichtbar, etwa ein ganz klein bißchen Kubismus im Stilleben „An Picasso“ (1956) oder etwas italienischer Futurismus in einigen Akten. Doch ist das alles sehr schön, sehr ausgewogen und sehr positiv. Als Betrachter wird man nirgendwo beleidigt oder provoziert.
Fraglos also ist die neue Bilderschau in Haus Opherdicke eine Wohlfühlausstellung für alle Freunde des Mediterranen und in ihrer schlichten Weltsicht der Vorgängerschau mit Arbeiten von Hans Jürgen Kallmann nicht ganz unähnlich. Für die nächsten Ausstellungen aber wünschte man sich etwas mehr Auseinandersetzung, Kritik, Drama. Vielleicht auch mal wieder einen Zeitgenossen? Vor etlichen Jahren, dies nur zur Erinnerung, hat der Kreis Unna sogar schon einmal den DDR-„Malerfürsten“ Willi Sitte ausgestellt.
- „Ulrich Neujahr – Die Faszination des Südens“, Haus Opherdicke, Dorfstraße 29, Holzwickede.
- &. Dezember 2015 bis 3. April 2016.
- Geöffnet Di-So 10.30-17.30 Uhr. Eintritt 4,00 €
- Katalog 24 €. www.kreis-unna.de, www.kulturkreis-unna.de
„Herzchen, sieh zu, wie Du klarkommst“ – Tagung zum 100. des Fotografen Otto Steinert
Die Altersverteilung war auffällig. Eine große Gruppe, vorwiegend männlich, repräsentierte die Generation 60 plus X, teilweise auch plus XX; die andere befand sich im Studentenalter, das Mittelfeld blieb deutlich sparsamer besetzt. Man war an diesem Wochenende zusammengekommen, um sich an Otto Steinert (1915 – 1978) zu erinnern, dessen Geburtstag sich im Juni zum 100. Mal gejährt hatte.
„Arbeit am Bild – Otto Steinert und die Felder des Fotografischen“ war das internationale Symposium in Essen überschrieben, auf dem am 27. und 28. November eine beachtliche Referentenriege mit Vorträgen auf Leben und Werk des Fotografen und Fotolehrers schaute. Außerdem sind Steinert-Arbeiten noch bis zum 28. Februar im Essener Folkwang-Museum unter dem Titel „Otto Steinert. Absolute Gestaltung“ ausgestellt.
„Who is Who“ der Fotoszene
Steinert gilt als bedeutendster Fotolehrer der jungen Bundesrepublik, und das Verzeichnis seiner Studenten und Studentinnen liest sich wie das Who is Who der Szene. Das Seminar-Wochenende im Sanaa-Gebäude auf dem Gelände der Zeche Zollverein war also auch so etwas wie ein Studententreffen, Steinert-Studenten aus den 50er, 60er und 70 er Jahren mit dem Drang zu kollektiver Erinnerung und junge Studis von der Gesamthochschule, die sich für den berühmten Altvorderen interessierten, den sie nie persönlich kennengelernt hatten.
Der große Fotolehrer war nicht leicht zu ertragen
Sensationelle Befunde förderten die Vorträge nicht zu Tage, Steinert-Forschung ist Kärrnerarbeit, wenngleich auch sicherlich ein Feld, auf dem sich noch manche Themen für Magisterarbeiten und Promotionen finden lassen. Viele Vorträge des Symposiums indes hätten ebenso überschrieben sein können wie der von Thilo Koenig aus Zürich: „Herzchen, sieh zu wie Du klarkommst“ zitiert er da den großen Fotolehrer, den zu ertragen alles andere als einfach war.
Koenig, von Beruf Kunstwissenschaftler, formulierte das natürlich zurückhaltender, seriöser: Es gebe Paradoxien in der Person Steinerts. Unbestritten sei einerseits, daß er es war, der zunächst in Saarbrücken, ab 1959 in Essen der jungen Bundesrepublik die Avantgarde der 20er Jahre wieder in das Bewußtsein rief, ganze Werkgruppen von Moholy-Nagy, Man Ray und vielen anderen präsentierte.
Steinert bewahrte Pioniere wie den bildjournalistisch arbeitenden Dr. Erich Salomon, der 1944 im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet wurde, vor dem Vergessen, er lenkte das Augenmerk auf die französische Fotografie des 19. Jahrhunderts. Eine seiner ersten Ausstellungen (samt Katalog) widmete sich Hippolyte Bayard (1801-1887), der mit dem von ihm entwickelten Direkt-Positiv-Verfahren auf Papier zu den „Urvätern“ der Fotografie zählt, aber bei weitem nicht so bekannt ist wie Daguerre.
Bei der Arbeit im Schwarzweiß-Labor war Steinert überaus penibel, notierte jeden Eingriff beim Erstellen von Vergrößerungen auf „Waschzetteln“, die an den Negativbögen hingen, so daß eigentlich jeder Abzug, war er durch die zahlreichen Steinertschen Dunkelkammer-Interventionen gegangen, als Unikat gelten mußte. Diese naturwissenschaftliche Präzision, vermutet Koenig, mag mit Steinerts ursprünglichem Arztberuf zu tun haben.
Antipädagogik
Im Umgang mit seinen Studenten war Otto Steinert autoritär, er pflegte ein geradezu militärisches Auftreten, blaffte Menschen – in den Worten des mit ihm befreundeten Historikers Josef Adolf Schmoll genannt Eisenwerth – im „Casinoton“ an. Als fürsorglicher Lehrer verweigerte er sich konsequent, eher pflegte er eine „Antipädagogik“. Der schon erwähnte Titel des Vortrags ist eine Äußerung, die er machte, als ihn eine Studentin nach vernichtender Kritik an ihren Fotos fast flehentlich fragte, wie sie es denn nun anders, besser mache solle. „Herzchen, sieh zu, wie du klarkommst.“
Bilder, die ihm nicht gefielen, zerriß er gleich stapelweise, und den Stempel, auf dem „Scheiße“ stand, besaß er wirklich. Allerdings hat er ihn wohl nicht eingesetzt, höchstens mal zum Spaß. So jedenfalls der aktuelle Stand der Steinert-Forschung. Immerhin befindet sich im Archiv des Essener Folkwang-Museums ein derart abgestempeltes Bild, das dessen Autor aber nicht öffentlich zeigen möchte. Schade, wär doch lustig.

Bildnis hell – dunkel, übrigens als Fotomontage ausgeflaggt (Foto: Museum Folkwang/Nachlaß Otto Steinert)
Um die jungen Leute Pünktlichkeit und Mores zu lehren, schloß Steinert nach Beginn der Stunde die Klasse ab, und Studenten, die ihm nicht paßten, meldete er einfach im Sekretariat ab. „Ich hab dich abgemeldet,“ lautete dann der Satz, „du studierst hier nicht mehr.“ Natürlich duzte nur er. Für die Studenten war er Herr Professor, darauf legte er großen Wert.
Menschen entwerten
Andererseits: Steinert kochte für seine Studenten und liebte es gesellig. Er brachte Zeitungen mit in den Unterricht und legte Wert auf Informiertheit und so etwas wie „politische Bildung“. Wer da indes durch Unkenntnis auffiel, mußte eventuell ein Referat verfassen, das mit Fotografie nichts zu tun hatte. Eine solche spontane Vergabe von Hausaufgaben kam manchmal auch beim gemeinsamen Essen vor.
Wirklich entspannt kann es da eigentlich nicht zugegangen sein. Eher schon drängt sich der Eindruck auf, daß Steinerts Pädagogik – oder Antipädagogik, auf jeden Fall rabenschwarze Pädagogik – darauf gerichtet war, die jungen Menschen in ihrem Selbstbild zu entwerten und in die Verzweiflung zu treiben, um sie schließlich, wenn sie nicht resignierten und die Brocken hinschmissen, nach seinen Vorstellungen gleichsam neu zu erschaffen.
Eine Fotografie der dramatischen Schwärzen
Und der Fotograf Steinert? Seine Bildauffassung mit ihren vielen tiefen, dramatischen Schwärzen, mit den gleichsam nach innen gewandten Kompositionen und einem eigentümlichen Hang zu Abstraktion und Struktur war für Jahrzehnte prägend. „Erst in den 70er Jahren entwickelt sich eine andere Auffassung, kommen offenere Bilder“, befindet Koenig und nennt in Sonderheit Timm Rautert als einen Fotografen, dessen Werk typisch für diese Wandlung ist.
Möglicherweise korrespondieren Veränderungen im Schaffen Otto Steinerts jedoch auch einfach mit gesellschaftlichen und politischen Veränderungen, gerade im Ruhrgebiet: Der Strukturwandel war im Gange, stinkige rauchig-rußige Revierkulissen à la Chargesheimer waren nicht mehr gefragt, die strenge formale Ästhetik eines Albert Renger-Patzsch galt bestenfalls als Kunst. Die fotografierte Wirklichkeit war jetzt eher hellgrau und etwas optimistischer – wenngleich man ja doch sagen muß, daß die Dramatik vieler Steinertscher Schwarzweißarbeiten einen mehr packt als die betonte Zurücknahme, die nun in der Fotografie Platz griff.

Luminogramm I von 1952. Bromsilbergelatine, Vintage Print (Foto: Museum Folkwang/Nachlaß Otto Steinert)
Schweizerische Leichtigkeit
Lichtersetzung hatte Steinert wohl nie sonderlich interessiert, „Licht mache ich in der Dunkelkammer“ soll eine seiner stehenden Wendungen gewesen sein. Doch die Zeit ging über diese Auffassung hinweg. Und nicht nur in der Werbung erinnerte man sich zunehmend an schweizerisches Graphik- und Foto-Design beispielsweise eines Hans Finsler, das nicht durch nationalsozialistisches Pathos geprägt worden war und sich durch Leichtigkeit und Offenheit auszeichnete. Hier, so Koenig, geht die Leserichtung der Bilder nach außen, hell und luftig sind die Fotografien, korrespondieren mit Freiraum und Typographie und bilden so ein informatives neues Ganzes.
Stilistische Kontinuitäten nach 1945
Immer wieder einmal wurde der Vorwurf laut, Steinerts gestalterische Konzepte hätten sich am Monumentalstil der Nazis orientiert. Biographische Daten – 1936 tritt er 21jährig in die NSDAP ein, 1937 meldet er sich zur Wehrmacht und wird Fahnenjunker in einem Sanitätskorps – legen solche Vermutungen nahe, doch halten sie einer Überprüfung nicht recht stand, allein deshalb nicht, weil es einen typischen Nazi-Stil streng genommen nicht gab.
Eher schon sind ästhetische, formale, stilistische Kontinuitäten nach 1945 von Bedeutung, die sich indes auch in den Arbeiten zahlreicher anderer Künstler und Fotografen finden – falls diese nicht ausdrücklich damit brechen. Sieht man allerdings Steinerts frühe experimentelle Arbeiten, Fotogramme und Solarisationen vor allem, dann könnte man hier durchaus auch ein Streben nach Entgegenständlichung vermuten, einen Versuch, es auf fotografischem Feld den abstrakten Expressionisten gleichzutun, die nach dem Krieg in Deutschland West in hohem Ansehen standen.
Formale Zurücknahme jedenfalls gehörte nicht zum Selbstverständnis der von Steinert auch so getauften „Subjektiven Fotografie“. Er bearbeitete seine Themen mit Kamera und Dunkelkammer „bis zum Endsieg“, wie ein Diskussionsteilnehmer es in Essen ausdrückte. Doch die Zeit ist über vieles hinweggegangen. Was früher großes handwerkliches Geschick erforderte, ist heute oft mit wenigen Mausklicks zu bekommen. Und die Fotografie – Stichwort Becher-Schule – gefällt sich mittlerweile in großer Zurücknahme, in geradezu programmatischer Entdramatisierung.
Bleibende Verdienste
Was bleibt: Agenturen wie VISUM oder die Illustrierten der 60er, 70er Jahre, Stern, Geo, Twen, wären ohne Fotografen und Fotografinnen aus der Steinert-Schule kaum denkbar. Viele von ihnen wurden zudem erfolgreiche Hochschullehrer.
Hier einige bekannte Namen von Steinert-Schülern: André Gelpke, Guido Mangold, Harry S. Morgan, Arno Jansen, Bernd Jansen, Heinrich Riebesehl, Dirk Reinartz, Adolf Clemens, Detlef Orlopp, Erich vom Endt, Monika von Boch, Vicente del Amo, Kilian Breier, Harald Boockmann, Ute Eskildsen, Timm Rautert.
- Ausstellung „Otto Steinert. Absolute Gestaltung“, Museum Folkwang, Museumsplatz 1, 45128 Essen. (Navi: Bismarckstraße 60)
- Bis 28. Februar 2016. Geöffnet Di+Mi 10 – 18 Uhr, Do+ Fr 10 – 20 Uhr, Sa+ So 10 – 18 Uhr. Mo geschlossen
- Geöffnet Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, Totensonntag, 26. Dezember, 28. Dezember 2015
- Geschlossen Rosenmontag, Heiligabend, 25. Dezember, Silvester
- Besucherinfo Tel. 0201 8845 444
info@museum-folkwang.essen.de - Der Eintritt in die ständige Sammlung im Museum Folkwang ist an allen Öffnungstagen frei. Ermöglicht wird dies durch die Unterstützung der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.
- Folgende Ausstellungen sind im freien Eintritt inbegriffen:
- Sammlung Goetz. 12 Monate / 12 Filme (bis 1. Mai 2016)
Los Carpinteros. Helm/Helmet/Yelmo
(seit 15. November 2014)
Otto Steinert. Absolute Gestaltung
(bis 28. Februar 2016).
Kunst und Bier in inniglicher Verbindung – Ausstellung „Dortmunder Neugold“ im U
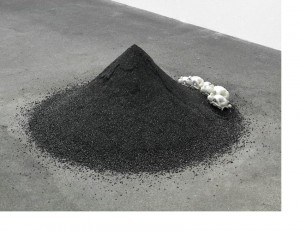
Zwei Tonnen Kohle: „Die Trinkenden“ von Alicia Kwade (Foto: Dortmunder U/Olbricht Collection/Roman März)
Der Titel ist eigentlich nicht schlecht. Bier als das neue Gold der Stadt paßt ja rein farblich schon viel besser als Kohle, die man deshalb etwas verschämt auch immer als schwarzes Gold bezeichnete. Wenngleich: Neu ist das Bierthema für Dortmund eher nicht, und dem Bier ging es in der Stadt schon mal deutlich besser. Bedenklich schwankt das Pilsglas auf absteigendem Ast, und die Versuche der Dortmunder Brauereien, wieder mit Export zu punkten, waren in jüngerer Vergangenheit nur von mäßigem Erfolg gekrönt. Doch jetzt gibt es wieder einen Versuch, und die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, der Verfasser dieser (sag es nicht!) goldenen Zeilen hat noch nicht diverse Pilse intus, aber das Thema Bier setzt einfach in hoher Dosis Assoziationen frei. Nun aber: Disziplin!
500 Jahre Reinheitsgebot
Im Dortmunder U gibt es auf der 6. Etage eine hübsche neue Ausstellung zu bestaunen, die „Dortmunder Neugold – Kunst, Bier und Alchemie“ heißt und ihr Entstehen dem deutschen Reinheitsgebot (für Bier) verdankt, das im kommenden Jahr seinen 500. Geburtstag feiert.
Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Brauerei-Museum und mit der einzigen in der Stadt noch ansässigen Großbrauerei Brinkhoff, die (endlich!) zum Jubiläum ein Union-Bier auf den Markt wirft, mit großem U auf dem Etikett der behäbigen Literflaschen. Auch ist das neue Jubiläumsbier kein Pils, sondern traditionsreiches Exportbier mit viel sättigender Stammwürze und mäßiger Hopfung, und last not least gibt es für jeden Besucher der Ausstellung bei Nachweis der Volljährigkeit ein Schlückchen davon, ist im Eintrittspreis mit drin. Die Marketing-Leute der Brauerei wollen als Reklame für dieses süffige Bierkulturprojekt 20 bis 30 Millionen Bierdeckel mit Werbebotschaften für Bier und Kultur drucken lassen, und alles in allem klingt das doch recht gut. Hier wächst, nicht nur aus der Perspektive des Marketing, endlich zusammen, was zusammengehört. Prost!

„In der Alchemie wurde der Prozeß der Fermentation und das daraus resultierende Ergebnis unter anderem mit der Geburt des Phoenix illustriert. Die Künstlerin Dörte Kraft verwendet diese Symbole für ihre eigene Interpretation des Prozesses.“ Ohne Titel, 2012, Mischtechnik auf Leinwand, 220 x 200 cm. (Foto: Dortmunder U)
Ernsthaft, nicht bierernst
Vor diesem Hintergrund nun möglicherweise aufkeimende Befürchtungen, auch die Ausstellung selbst sei nur eine Marketingaktion an historischer Stätte und deshalb belanglos, sind unbegründet. Stefan Riekeles, Jahrgang 1976 und Kurator von „Dortmunder Neugold“, hat hier mit gutem Gespür für die Raumwirkung von Bildern und Objekten und mit dankenswertem Mut zur Reduktion eine ernsthafte, nicht aber immer bierernste Kunstschau aufgebaut. Er macht den Aspekt der Wandlung zum zentralen Begriff seiner Konzeption. Für ihn ist die Geschichte von Bier und Stadt und Industrie ein fortlaufender Prozeß des Werdens und Vergehens, der im Baukörper des ehemaligen Kühlhauses mit dem markanten U auf dem Dach ebenso seine Entsprechung erfährt wie im Strukturwandel des Ruhrgebiets. Auch die Entstehung von Bier aus Wasser, Malz und Hopfen könne als Wandlung begriffen werden, einige Kunstwerke greifen diesen Gedanken auf.
Kreislauf des Bieres
So stoßen Besucher gleich im ersten Raum, ganz nahe bei den offenbar unvermeidlichen Säcken mit Hopfen und Braugerste, auf eine konzeptionelle Arbeit von Ayumi Matsuzaka. In „Future Beer Cycle“ thematisiert sie den agrarischen Kreislaufprozeß der Bierproduktion. Aus Urinalen in Dortmund und Berlin sammelte sie Urin, um damit Ackerboden zu düngen und mit Stickstoff anzureichern. Auf dem Boden wuchs Braugerste, die die Künstlerin zu Bier verarbeitete, welches schließlich – der Kreis schließt sich – an die selbstlosen Urinspender ausgeschenkt wurde. Nun ja.

Alkoholischer Absturz – Foto von Eva Teppe aus der Serie „Shinjuku Twilight“ von 2008 (Foto: Dortmunder U)
Eine Begegnung mit der „Alchemie“, die der Untertitel der Ausstellung verheißt und die man kurz und knapp vielleicht als ein furchtloses Experimentieren in vornaturwissenschaftlicher Zeit bezeichnen kann, gibt es ebenfalls im ersten Raum der Ausstellung. Hier hocken trinkende Frauen, aus weißem Porzellan gebrannt, am Fuß eines tonnenschweren Kohlehaufens und „trinken“ gleichsam von ihm. Kohle ist nicht Bier, gewiß, doch Kohle, sagt uns diese Arbeit von Alicja Kwade von 2011, nährt die Menschen, befriedigt trotz der nicht zu leugnenden Klimaschädlichkeit elementare Bedürfnisse.
Das Material Porzellan, aus dem die Trinkenden (nach einem Entwurf von Ernst Wenck aus dem Jahr 1924) geschaffen wurden, ist so ziemlich das Einzige, was die Alchemie im europäischen Raum an Sinnvollem hervorbrachte. Eigentlich, hallo Hintersinn, wollte man im alchemistischen Labor ja Gold erzeugen. So kommt hier in Raum 1 alles zusammen: Das schwarze Gold des Ruhrgebiets, das flüssige Gold aus Gerste und Malz und schließlich auch noch das richtige Gold, das indes, oh Sprachverwirrung, aus dem Dortmunder Rats-Silber herbeigeschafft wurde.
Prunkleuchter aus Kaisers Zeiten
Zwei goldene Leuchter stehen in den Vitrinen, sehen nach Mittelalter aus, stammen aber aus dem Jahr 1899, als Kaiser Wilhelm II Dortmund besuchte. Die Brauer hatten für dieses Geschenk zusammengeschmissen, und schaut man genauer hin, so sieht man, daß sie sich mit dezenten Prägungen im gelbstrahlenden Metall verewigt haben. Symbolisierte Handwerke rund um die Braukunst, die Stadttore, der heilige Reinoldus und andere Dortmundereien zieren die Stücke, die nach heutigen Geld je um die 150000 Euro kosten würden. Man kann sie kitschig finden oder auch schön und vielleicht einen Gedanken daran verwenden, daß es zur Zeit der Entstehung dieser Kerzenständer auch schon die Impressionisten und Osthaus und fortschrittliches Industriedesign gab. Auf jeden Fall werden sie eindrucksvoll präsentiert, scheinen leicht zu schweben, weil sie auf Glasböden in ihren Vitrinen stehen.

Michael Sailstorfers „Hang Over“ (2004) ist so etwas wie ein Kronleuchter aus Bierflaschen, Eisen, Neonröhren und Elektronik. (Foto: Dortmunder U/Courtesy Michael Sailstorfer und König Galerie, Gert Elsner)
Prozessuale Elemente, um noch einmal daran anzuknüpfen, sind dem Bier- bzw. Alkoholgenuß ja in besonderer Weise eigen. Trinken erzeugt Rausch und Hochgefühl, späterhin Absturz und Kater, wenn man nicht aufpaßt. Iva Vacheva hat die Freuden der alkoholischen Enthemmung 2009 in Acryl auf bunte Großformate gemalt, die „Auf die Freundschaft“, „Gloria, Gloria!“ und „Kultus“ heißen. Daneben hängt in strengem Schwarzweiß eine Fotoserie von Eva Teppe, die im Tokioter Vergnügungsviertel Shinjuku enstand und im Morgengrauen die Alkoholopfer der Nacht zeigt, wie sie auf Treppenstufen und in Hauseingängen schlafen. Deprimierend und sicherlich nicht nur ein japanisches Phänomen.
Überzeugendes Raumkonzept
Die Veränderung des Raumkonzepts in der 6. Etage des Dortmunder U, die schon der Bestandsausstellung der Dortmunder Museen „Meisterwerke – Caspar David Friedrich bis Max Beckmann“ zugute kam, macht sich auch bei dieser Ausstellung bezahlt: Die Anordnung der Kojen auf der Etage mit zahlreichen Durchgängen und Blickachsen gibt dem Publikum das gute Gefühl, sich gänzlich frei bewegen zu können. Stefan Riekeles nutzt diese Möglichkeiten der Räumlichkeit und ordnet fein die Kunst zusammen, die (mehr oder weniger) zusammengehört, gibt mit gemessener Ironie (wie man wohl vermuten kann) aber auch dem spießigen, vom Gelsenkirchener Barock geprägten „Reich des deutschen Bieres“ Raum und präsentiert die unvermeidlichen Humpen, Gläser und Plakate (einige sogar aus Japan).

Endlich am Markt, wenn auch nur für begrenzte Zeit: das U-Bier für die U-Ausstellung. (Foto: Dortmunder U)
Superfritz beim Frauenarzt
Großen Reiz bezieht das „Dortmunder Neugold“ aus einigen burlesken Kunstwerken, die das alkoholischen Thema möglicherweise in besonderer Zahl hervorbringt. Zwar sind Zecherrunden und trinkende Mönche in der Präsentation dankenswert sparsam plaziert, doch trifft man in Koje Nummer 6 – hinter einem Vorhang, der wohl eine gynäkologischen Praxis symbolisieren soll – auf den roh aus Holz zusammengezimmerten „Superfritz“, den der holländische Künstler Dick Verdult geschaffen hat; überlebensgroß liegt er dort auf der Liege, und wenn von Besuchern ein Kontakt ausgelöst wird, erklingt Superfritzens fröhliches Credo, daß er nicht schwanger sei, sondern Bier seinen Leib geformt habe. Anmerken wollen wir noch, daß Dick Verdult an vielen Stellen aktiv ist, unter anderem im Institut für bezahlbaren Wahnsinn (IBW) und im Centro Periferico Internacional, ein bunter Vogel offenbar.
Ein anderer Künstler, der den burlesken, nicht aber hintersinnfreien Auftritt liebt, ist Herbert Achternbusch. Von ihm läuft das Video „Bierkampf“, in welchem er, in eine Polizistenuniform gekleidet, durch ein Bierzelt des Oktoberfestes stolziert und mehr oder minder trunkene Gäste maßregelt. Man ist erstaunt und ein bißchen erschrocken, was mit Uniform und herrischem Auftreten möglich ist.
Ein politischer Herbert Achternbusch
Diese Achterbusch-Arbeit aus dem Jahr 2003 zeigt allerdings auch, was vielen anderen Exponaten der Biergoldschau weitgehend fehlt: das Politische, das Entlarvende, das über einige skeptische ökologische Befunde Hinausgehende. Vielleicht ist das beim Thema Bier aber auch ein bißchen viel verlangt, sozusagen nicht das Bier des Dortmunder Neugolds.
Auf jeden Fall gibt es einiges an passabler, kluger, vorwiegend junger Kunst zu sehen, nicht alles konnte in dieser Besprechung Erwähnung finden. Außerdem haben Besucherinnen und Besucher aus der 6. Etage des Dortmunder U einen sehr schönen Blick auf die Stadt. Von hier oben sieht Dortmund ganz schnuckelig aus, richtig ordentlich und aufgeräumt und sauber.
Nachsatz
Kleine Überlegung noch am Rande: Der Kohlehaufen mit den Trinkenden von Alicja Kwade ist eine Leihgabe aus der Sammlung Olbricht, die vor einigen Jahren im „alten“ Essener Folkwang-Museum präsentiert wurde, bevor dort die Bauarbeiten begannen. Der Privatsammler besitzt viele spannende Spitzenarbeiten der Gegenwartskunst, die man selten in deutschen Museen sieht, weil die so etwas wg. Geldmangel kaum in ihren Beständen haben. Sollte man auf diesem Feld nicht nach Kooperationsmöglichkeiten suchen? Sammlung Olbricht (oder ein anderer Privatsammler von Rang) im Dortmunder U, das wäre eine Attraktion weit über die Stadtgrenzen hinaus. Nur mal so als Idee.
- „Dortmunder Neugold – Kunst, Bier, Alchemie“, Ausstellung im Dortmunder U, Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund,
- Bis 1. Mai 2016.
- Geöffnet Di+Mi 11-18 Uhr, Do+Fr 11-20 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr. Heiligabend, 1. Weihnachtsfeiertag, Silvester und Neujahr geschlossen. Eintritt 6 €
- www.dortmunder-neugold.de
Der Drucker der Herzen – Jim Dine schenkt dem Essener Museum Folkwang 230 Werke

So sieht er aus: Jim Dine in einem Selbstportrait als Pinocchios Meister Geppetto (Lithographie, 2006). (Foto: Museum Folkwang//VG Bild-Kunst, Bonn 2015)
Er ist der Mann mit den Herzchen. Sie haben ihn weltberühmt gemacht, die Lithographien mit den meist farbenfrohen, optimistischen, manchmal auch durchnumerierten Liebes- und Lebenssymbolen. 1970 schuf Jim Dine seine „Dutch Hearts“, und seitdem gingen sie, vieltausendfach gedruckt, um die Welt. Doch das Oeuvre des amerikanischen Künstlers ist natürlich viel, viel größer, wie jetzt eine Ausstellung im Essener Folkwang-Museum zeigt: „Jim Dine – About the Love of Printing“.
Der Titel der Ausstellung sagt es: Jim Dine liebt den Druck, genauer, die Verwendung von unterschiedlichsten Druckverfahren in seinen Arbeiten. Kaltnadelradierung, Siebruck, Holzschnitt, Lithographie sind gängige Techniken, aber einige Verfahren sind so speziell, dass nur Experten sie kennen, den Kartontiefdruck zum Beispiel oder den Glacié-Tranféré-Druck.
Dine druckt nicht selbst, sondern arbeitet mit den, wie er sagt, besten Druckern der Welt zusammen. Und warum? Nun, antwortet ein sichtlich aufgeräumter, mittlerweile 80-jähriger Künstler bei der Präsentation seiner Ausstellung in Essen, wegen der Geselligkeit natürlich. Malen sei eine einsame Beschäftigung, die Zusammenarbeit mit guten Druckern jedoch überaus angenehm. Da könne man mit jemandem reden, alle seien beim Schaffensprozess gleich wichtig, und „Ich mag meine Freunde“. Sagt Jim Dine und scheint dabei ein ganz klein bisschen zu schmunzeln.

Quasi ein Nachzügler. „Big Wall of Hearts“ von 2002, ein handkolorierter Holzschnitt (Foto: Museum Folkwang/VG Bild-Kunst, Bonn, 2015)
Der künstlerische Nachlass
Daneben hat das Drucken den Vorteil, dass die meisten Arbeiten etwas weniger teuer sind, als es die Originalgemälde eines so berühmten Mannes wären. So konnte Jim Dine großzügig dem Folkwang-Museum 230 Arbeiten aus verschiedenen Schaffensperioden schenken. Sie bilden das Gros der Ausstellung. Doch was soll man davon halten? Hat sich der Künstler am Ende seine Ausstellung im renommierten Haus gekauft?
Das wäre gewiss eine unzulässige Unterstellung. Er sei, sagt Dine, im fortgeschrittenen Alter und wolle sein künstlerisches Erbe ordnen. Im Folkwang-Museum, beim Kurator Tobias Burg und auch beim Chef des Hauses, Tobia Bezzola, wisse er die Arbeiten in guten Händen. Eine Win-Win-Situation mithin.
Vorliebe für die Zentralperspektive
Mal bunt, mal schwarzweiß, mal asketisch nüchtern, mal aus Bild und Schriften bunt zusammengefügt – das Werk Jim Dines ist von Vielfalt geprägt. Indes fallen doch Vorlieben auf, etwa für die Zentralperspektive, die den Gegenstand des Bildes stets in dessen Mittelpunkt postiert, sei es ein Kopf, ein Herz oder eine antike Statue. Tauchen mehrere Bildelemente auf, so werden sie nicht auf der Bildfläche verteilt, sondern übereinander gelegt, beispielsweise in „9 Hearts from Nicolaistrasse“ (Digitaldruck mit Kaltnadel, 2009). Manchmal werden mehrere Bilder wie Kacheln montiert, beispielsweise die berühmten sechs Herzchen. Dann hat jedes seine eigene Zentralperspektive.

Eins von den Bademantelbildern ist „Self-Portrait: The Landscape“ von 1969, eine Lithographie (Foto: Museum Folkwang/VG Bild-Kunst, Bonn, 2015)
Portraits im Bademantel
Früh schon befasste sich Jim Dine mit der plakativen Verbindung von Wort und Bild, etwa in der Lithographie-Serie „Car Crash“ von 1960. Das geschriebene Wort „Crash“ erleidet hier als sichtbares Element den Unfall, eine fast etwas verstörende Doppelung. In den Selbstportraits hingegen, die einen weiteren Schwerpunkt in Dines Werk bilden, ist lediglich dessen Bademantel zu sehen, als Stellvertreter des (nicht) Abgebildeten. Das Individuelle wird dem Betrachter vorenthalten, die erwartete Information nicht gegeben. Es scheint, dass Dine das Spiel mit wechselndem Zuviel und Zuwenig an Information liebt.
Von gediegener konzeptioneller Langeweile scheinen im nächsten Raum auf den ersten Blick die radierten Werkzeugbilder, Pinsel, Zangen, Sägen, Pizzaschneider, zu künden; doch betrachtet man sie länger, beginnen sie ein visuelles Eigenleben zu führen, schieben sich ihre bizarren Formen mit Nachdruck ins Bewusstsein des Betrachters. Dann werden sie fast ein wenig unheimlich, zumal der Künstler Schraffuren über sie legte und ihnen damit eine Aura von Unwirklichkeit gab.
Pinocchio macht alles anders
Antiken Skulpturen, weiblichen zumal, nähert sich Jim Dine mit großen Respekt und gesteht ihnen in seinem Reproduktionen der Serie „Glyptotek“ (Glacé-Transféré-Drucke, 1988) sogar eine echte Plastizität zu. Und dann taucht im nächsten Raum der untadelig gehängten Ausstellung plötzlich Pinocchio auf, ein buntes, quicklebendiges, keck die Augen rollendes und geradezu professionell animiertes Bürschchen, dem die Statuarik anderer Dinescher Motivwelten völlig fremd ist. Ihn habe die Erschaffung eines Menschen durch Menschenhand fasziniert, sagt der Künstler über diese 2006 entstandenen Arbeiten. Und keineswegs zufällig hat er Pinocchios Schöpfer Meister Geppetto seine eigenen Gesichtszüge verpasst. Der Künstler als Welt- und Menscherschaffer: eine schmeichelhafte Vorstellung, vielleicht auch nur ein frommer Wunsch.
Keine Themen mehr
Vor fünf Jahren schließlich, erzählt Jim Dine, sei irgendwie Schluss gewesen. Herzen, Antiken, Bademäntel, Pinocchio, all die Themen seien auserzählt gewesen. So habe er sich entschlossen, weiterzuarbeiten, ohne erneut thematisch zu werden. Die letzten Bilder, teilweise aus diesem Jahr, sind somit gänzlich ungegenständlich, um die anderthalb Quadratmeter groß und sehr farbenfroh. Es sind große Holzschnitte, die Jim Dine nach mehreren Druckvorgängen mit Farbe und unorthodoxen Materialien nachbearbeitet hat. „Holzschnitt mit Elektrowerkzeug-Abrieb“ beispielsweise ist eine Arbeit beschrieben, die einen erstaunlich konkreten Titel trägt: „Die Verpackung eines Sees aus Glas“. Wieder einmal ist die Bild-Text-Schere weit geöffnet; doch das Spiel mit Wörtern und Bildern gehört in Jim Dines Werk ja von Anfang an dazu.
- „Jim Dine – About the Love of Printing“
- 275 druckgraphische Arbeiten, eine dreiteilige Skulptur
- Museum Folkwang, Essen, Museumsplatz 1
- Bis 31. Januar 2016
- Geöffnet Di-So 10-18 Uhr, Do+Fr 10-20 Uhr
- Eintritt 5 €
- Katalog (224 Seiten, Leinen) 28 €
- Besucherbüro Tel. 0201 8845 444
- www.museum-folkwang.de
Diese Weite, diese Stille – „Sehnsucht Finnland“ im Hammer Gustav-Lübcke-Museum
Was wissen wir eigentlich über finnische Kunst? Die aufrichtige Antwort dürfte wohl lauten: nichts.
Jetzt kann man solchen Mangel ein wenig beheben, denn das Gustav-Lübcke-Museum in Hamm gibt mit beachtlichen Leihgaben einen Einblick ins Werden der finnischen Moderne zwischen 1880 und 1920.
Der Titel „Sehnsucht Finnland“ hat gleich mehrfache Bedeutung. Zum einen wecken besonders die Landschaftsbilder aus dem hohen Norden Sehnsucht nach unberührter Natur und sind vielleicht geeignet, manche Reisepläne für den nächsten Sommer zu beeinflussen.
Vor allem aber haben die meisten damaligen Maler ihre Kunst nicht zuletzt als sehnsüchtige Suche nach einer finnischen Identität verstanden, denn ihr Land hatte vom Mittelalter bis 1809 schwedische und dann noch fast 100 Jahre russische Fremdherrschaft ertragen. Erst 1917 wurde Finnland eine unabhängige Nation. Zuvor hatten Künstler Finnland sozusagen erfunden.
Es war eine Zeit, in der kulturelle Schöpfungen – zumindest mittelbar – politisch einiges bewirkt haben: Tatsächlich zählten die Künstler zur Spitze der finnischen Bewegung (so genannte „Fennomanen“), die auf Selbständigkeit aus war. Und wahrhaftig vermochten sie es, in ihren Bildern glaubhaft einigen Grundlinien dessen nachzuspüren, was just die finnische Besonderheit ausmacht. Dabei entstand eine angenehm unaufgeregte Kunst, die so gar nicht imponieren will und niemals auftrumpft.
Die Einsamkeit und schier endlose Weite der nordischen Natur mit ihren Wäldern und Seen war das bevorzugte Feld derartiger Erkundungen, zumal auch in den langen harten Wintern. Sagt man manchen Sprachen nach, sie hätten etliche, fein differenzierende Begriffe für Schnee und Eis, so findet man derlei Vielfalt ebenso in den Bildern finnischer Maler.
Hie und da dringen die Maler mit ihren Schneebildern gar schon unversehens in die Gefilde der Abstraktion vor. Die große Leere der größtenteils noch wirklich unberührten Landschaften kann ebenso Beglückung wie Melancholie hervorrufen. Welche Stille solche Bilder atmen – und wie verhalten die Farben sind! Doch den finnischen Frühlingsbildern merkt man an, wie sehnsüchtig man dort droben auf die Blüte gewartet hat. Auch nicht nur nebenher: Ein Seitenblick zeigt, dass auch das Genre der Sauna-Bilder zur finnischen Identitätsfindung beitrug.
Rund 70 Tafelbilder hat man in Hamm beisammen, die so bislang nur in Stockholm und Paris zu sehen waren. Eigentlicher Hort dieser Fülle ist die finnische Gösta Serlachius Stiftung, deren Kunstschätze seinerzeit von der Industriellenfamilie Serlachius (Forstwirtschaft und Papierfabriken) erworben wurden. Heute gilt das Konvolut als finnisches Nationalerbe und wird sonst allenfalls vereinzelt ausgeliehen.
Die Familie Serlachius unterstützte auch einen befreundeten Künstler, der seinen ursprünglich schwedisch lautenden Namen zu Akseli Gallen-Kallela finnisierte. Seine Bilder ragen, wie sich beim Rundgang mehrmals zeigt, mit ihrer vielfältig delikaten Malweise aus der ohnehin sehenswerten Schau (mit nur wenigen Schwachpunkten) noch einmal deutlich heraus.
Wäre Gallen-Kallelas Name bei uns bekannter, hätte man seine Werke durchaus in einer Einzelausstellung zeigen können, so aber ist die allgemeiner gehaltene „Sehnsucht Finnland“ natürlich zugkräftiger. Sein geheimnisvoll symbolistisch aufgeladenes Bild „Symposion“ (1894) zeigt beim Künstlertreffen in der Kneipe auch den berühmten finnischen Komponisten Jean Sibelius, es vereint mehrere Stilrichtungen und erinnert in einer Partie gar schon an die zur Kenntlichkeit verzerrenden Darstellungen eines George Grosz.
Und weiter: Vor Gallen-Kallelas grandioser karelischer „Landschaft in Kuhmo“ kann man lange schweigend und schwelgend verweilen, sein Bild „Gewitterwolken“ (1897) erweist sich gleichfalls als famose Naturdarstellung. Das in der Fabrik angesiedelte, realistische Porträt des Industriellen Adolf Serlachius (1887) gemahnt nahezu an Adolph von Menzel. „Matti, der Luchsjäger“ (1905) zeigt einen kernigen Mann, der für den idealtypischen Finnen schlechthin gestanden haben mag. Ein Mädchenbildnis von 1895/96 ist hingegen ein Inbild der Traurigkeit und wohl das bewegendste Stück der ganzen Ausstellung. Kurzum: Dieser Künstler kann auch im europäischen Vergleich mit seinen Zeitgenossen bestehen.
Um wenigstens ein paar weitere Namen zu nennen: Albert Edelfelt, der auch noch für bildnerische Huldigungen an die russische Zarin einsteht, besticht mit einem hintergründigen Hafenstück und dem Bildnis eines strickenden Mädchens, irritiert heutige Gemüter freilich mit einer „Gitane“ („Zigeunerin“). Doch Vorsicht! 1881 war ein solches Motiv noch längst nicht als Massenware diskreditiert. Dann wieder die unentrinnbaren Blickfänge: Hugo Simbergs eigentümlich verhalten leuchtendes Tanzbild auf einer Seebrücke, Victor Westerholms Robbenjäger…
Dass die Bilder auch schon in Paris zu sehen waren, ergibt übrigens auch speziellen Sinn, manche sind damit gleichsam an den Ort ihrer Inspiration zurückgekehrt. Denn zahlreiche finnische Künstler gingen ab 1880, wie ihre Kollegen aus ganz Europa, in die Weltkunstmetropole Paris, um dort Strömungen wie Realismus oder Impressionismus und das Phänomen der Freilichtmalerei kennen zu lernen. In der Hammer Schau lassen sich zudem die finnischen Anfänge einer flächigen Malweise und kubistischer Formfindung studieren.
Die Ausstellung zeugt überdies von einer weiteren Besonderheit in der finnischen Kunst. Wie damals nirgendwo sonst, haben Frauen die Entwicklung mitbestimmt. Zwar waren sie anfangs auf den häuslichen Kreis und somit überwiegend auf Kinderbilder eingeschränkt, doch schon relativ früh haben sie dann mehr als die Hälfte aller Kunstpreise erhalten und zwischenzeitlich auch die Mehrheit in den (vergleichsweise spät gegründeten) finnischen Kunstakademien gestellt. Beispielhafte Bilder, etwa von Maria Wiik und – noch eindrücklicher – Helene Schjerfbeck, lassen ahnen, welche Begabungen da am Werk gewesen sind.
Jammerschade nur, dass diese Ausstellung, die auch weitere Anreisen lohnt, nicht durch einen Katalog bewahrt wird.
„Sehnsucht Finnland“. Gustav-Lübcke-Museum, Hamm, Neue Bahnhofstraße 9. Bis zum 20. März 2016. Geöffnet Di-Sa 10-17 Uhr, So 10-18 Uhr. Eintritt 9 Euro (ermäßigt 7 Euro). Kein Katalog. Weitere Infos: www.museum-hamm.de
Auf irgendeine Art naiv – „Der Schatten der Avantgarde“ im Essener Folkwang-Museum
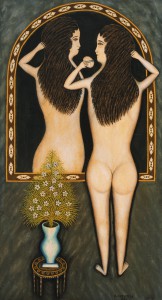
„Mädchen im Spiegel“ (1940) von Morris Hirshfield, 102×57 cm groß (Foto: VG Bild-Kunst/Museum Folkwang)
Als er sich 2012 vom Kölner Museum Ludwig verabschiedete, durchwehte ein Hauch von Schwermut die Räume. „Ein Wunsch bleibt immer übrig. Kasper König zieht Bilanz“, war die Ausstellung betitelt, mit der sich der prominente Kurator und bekennende Westfale nach 12 Jahren Leitungstätigkeit verabschiedete. Und das geneigte Publikum fragte sich, wie der Ausstellungstitel denn wohl zu verstehen sei: Bleibt der letzte Wunsch nun ein für alle Mal unerfüllt, oder wird er in den folgenden Jahren noch verwirklicht?
Wie es aussieht, trifft Letzteres zu. Kasper König hat (unter anderem in St. Petersburg) munter weiter kuratiert, hat bei Anke Engelke in der Talkshow gesessen und jetzt im Essener Folkwang-Museum eine Kunstschau realisiert, die doch Fragen aufwirft: „Der Schatten der Avantgarde – Rousseau und die vergessenen Meister“. Eine Ausstellung, von der man auch sagen könnte, daß sie typisch für König ist.

Dieses „Untitled (Blue Man on Red Object)“ des ehemaligen Sklaven Bill Traylor entstand ca. zwischen 1939 und 1942. (Foto: Mike Jensen/Museum Folkwang)
Wo gehören sie hin?
Natürlich soll nicht verschwiegen sein, daß ein zweiter Kurator mit im Boot sitzt, eine gute Generation jünger als König und aus Dortmund gebürtig: Falk Wolf, der unter anderem auf eine mehrjährige Tätigkeit im Hagener Osthaus-Museum zurückblickt. Die beiden sind für das verantwortlich, was im großen, überaus flexibel gestaltbaren Saal des Folkwang-Museums nun zu sehen ist:
Acht Dschungelbilder des berühmten Zöllners Henri Rousseau, drum herum gruppiert Arbeiten von 12 Künstlerinnen und Künstlern, denen gemein ist, daß sie anders als Rousseau im etablierten Kunstbetrieb so recht keinen Platz zugewiesen bekommen haben: Camille Bombois, Adalbert Trillhaase, William Edmondson, Morris Hirshfield, Martín Ramírez, Séraphine Louis, Alfred Wallis, um einige zu nennen. Den einen oder anderen Namen hat man wohl schon einmal gehört, sicherlich den von André Bauchant, dessen eigentümliche Historienbilder einen der Präsentationsräume füllen.
Erich Bödekers Betonfiguren
Auch ein guter Bekannter aus dem Revier ist in die Auswahl geraten: Erich Bödeker, Bergmann aus Recklinghausen, der Figuren aus Beton schuf und sie anmalte. In Essen stehen Tiere aus einem Zoo, bekannt ist aber vor allem auch seine (in Essen nicht gezeigte) englische Königsfamilie, und Beton wählte Bödeker als Material, weil es ihm am haltbarsten zu sein schien. Da lag er leider falsch, und seine schlicht-feierlichen Gestalten mit ihrer geradlinigen Aura dauerhaft zu erhalten, ist ein großes kuratorisches Problem. Aber dies nur am Rande. Mehr oder weniger sind sie alle Autodidakten, kann das Etikett „naiv“ für ihre Arbeiten verwendet werden, und schließlich ist etlichen eigen, daß sie zeitlebens still vor sich hinbosselten, ohne aktiv den Austausch mit Gleichgesinnten zu suchen, sich gar als Avantgarde zu begreifen.

Ein Esel des Recklinghäuser Bergmanns und Künstlers Erich Bödeker (Foto: Lothar Schnepf/Kolumba/Museum Folkwang)
Der malende Sklave
Der Tscheche Miroslav Tichý, der leicht bekleidete Frauen in Schwarzweiß fotografierte und dies wohl meistens unbemerkt tat, hat es in die Ausstellung geschafft, gleichermaßen Bill Traylor, 1853 in Benton, Alabama geboren und Sklave auf einer Baumwollplantage. Dort blieb er auch noch lange nach dem offiziellen Ende der Sklaverei. Seine chiffrenhaften, kargen Zeichnungen lassen an Höhlenmalerei denken, lassen dunkle Ahnungen von Gewalt und Unterdrückung aufsteigen und gehören in ihrer diffusen Bedrohlichkeit zu den stärksten Bildern der Ausstellung.
Der 1864 geborene Amerikaner Louis Michel Eilshemius hingegen liebte es, nackte pralle Frauen in freier Natur zu malen, und wenn ihm in einigen dieser Bilder die richtige Perspektive auf groteske Art entgleitet, wenn Köpfe wirken wie schief aufgeklebt, dann könnte man glatt eine Absicht dahinter vermuten. Aber sind „naive“ Maler absichtsvoll naiv? In jedem Fall machen schon die Arbeiten dieser drei Künstler deutlich, daß hier von den Kuratoren gerade nicht das Einende gesucht wurde, sondern die bunte Vielfalt.

Den hungrigen Löwen, der sich auf eine Antilope wirft, malte Henri Rousseau zwischen 1898 und 1905. Foto: Fondation Beyeler/Robert Bayer/Museum Folkwang)
Räume im Raum
Einen inhaltlichen, formalen Bezug zu Rousseaus schlicht-schöner Weltsicht zu konstruieren, fällt trotzdem bei keinem der zwölf Ausgestellten (plus einigen Referenz-Gemälden von Delaunay, Modersohn-Becker, Picasso uns so fort) schwer. Dies ist zu einem großen Teil dem dritten Mann zu danken, der am Zustandekommen dieser Schau beteiligt war und den zu preisen Kasper König im Termin nicht müde wurde: Hermann Czech, Ausstellungsarchitekt, der auf der riesigen Fläche drei schräg stehende Raumgebilde verteilt hat, die Containern ähneln, das Werk jeweils eines Künstlers, einer Künstlerin präsentieren und die gesamte Schau räumlich sinnhaft strukturieren. Zudem gibt es durch Stellwände abgetrennte Bereiche, und alle so entstandenen Zonen haben einen Blickachsenbezug zu den berühmten Bilder des Meisters Rousseau. Ist wirklich nicht schlecht gemacht.

Kaspar König (links) und Falk Wolf kuratierten die Ausstellung „Der Schatten der Avantgarde“ im Essener Folkwang-Museum. (Foto: Jens Nober/Museum Folkwang)
„Kuratorische Ratlosigkeit“
Man muß wohl ein alter Hase im Ausstellungsgeschäft sein, wenn man, wie Kasper König, freimütig von „kuratorischer Ratlosigkeit“ als Konzept spricht. Oder vielleicht eben auch als Nicht-Konzept, was aber auch wieder ein Konzept wäre.
Gefragt hatte man ihn, warum nicht auch Jean Dubuffet mit seiner „Art brut“ in der Ausstellung vertreten sei, oder Kunst von psychisch Kranken, oder „Tribal Art“ aus Asien, Afrika, Ozeanien. Hätte man alles machen können, hat man eben nicht (zumal Dubuffet Rousseau dann möglicherweise die Schau gestohlen hätte).
Sicherlich ist der Titel etwas schönfärberisch; der Begriff Avantgarde geht bei den meisten Gezeigten schlichtweg in Leere, und Meister kann man sie auch nicht alle nennen. In jedem Fall jedoch schafft diese Ausstellung eine Vielzahl von sinnvollen schöpferischen Bezügen, die in Ruhe noch bedacht sein wollen. Und zu Recht wirft sie die Frage auf, warum sich der etablierte Kunst- und Museumsbetrieb bei einigen der gezeigten Künstler mit deren systematischer Einordnung so schwer tut.
Kasper König 2017 in Münster
Übrigens werden wir Kasper König spätestens im Sommer 2017 in Münster wiederbegegnen. Er arbeitet, wie er sagt, schon intensiv an der alle 10 Jahre stattfindenden Ausstellung „Skulptur.Projekte“ , die er jetzt zum dritten Mal plant.
- „Der Schatten der Avantgarde – Rousseau und die vergessenen Meister“. Museum Folkwang, Essen, Goethestraße.
- Bis 10. Januar 2016
- 96 Gemälde, 65 Grafiken, 21 Fotografien, 2 Installationen, 20 Skulpturen = 204 Kunstwerke auf 1400 Quadratmetern.
- Geöffnet Di-So 10-18 Uhr, Do+Fr 10-20 Uhr.
- Eintritt 8,00 €
- Katalog 25,00 €
- www.museum-folkwang.de
„Weltkunst“ ohne Grenzen – Wuppertal zeigt die famose Sammlung des Eduard von der Heydt
Von einem veritablen „Großereignis“ spricht Wuppertals Museumsdirektor Gerhard Finckh, der zwar zu schwelgen weiß, aber nicht zu maßlosen Übertreibungen neigt. Man zeige – in bislang beispielloser Breite – wesentliche Teile der bedeutendsten deutschen Kunstsammlung, die hauptsächlich in den 1930er und 40er Jahren aufgebaut wurde.
Konkreter: Wuppertal würdigt den Mann, dem es quasi seine grandiosen Museumsbestände und seinen bleibenden Rang in der Kunst-Landschaft verdankt. Wenn man es pathetisch sagen mag: Alle Stockwerke des Hauses sind nun von Sammlergeist des Eduard von der Heydt erfüllt.

Vincent van Gogh: „Kartoffelsetzen“ (1884). Vermächtnis Eduard von der Heydt, 1964 (Foto: Von der Heydt-Museum Wuppertal)
Seit 1962 trägt das Museum den Namen Von der Heydts. Er hat der Stadt nicht nur unermasslichen Kunstbesitz vermacht, sondern auch ein Millionenvermögen, das in eine Stiftung zum Ankauf weiterer Werke eingeflossen ist. Glückliches Wuppertal! Jedenfalls in dieser Hinsicht.
Eduard von der Heydt war, wie schon sein Vater August, ein Wuppertaler Bankier, der nach und nach in London, der Schweiz, den Niederlanden, Berlin und Paris wirkte; ein Mann von europäischem Format also. Aufbauend auf der Kunstsammlung seines Vaters (erst konventionell mit Marees, Makart und Courbet, dann auch schon kühner ausgreifend), trug er eine famose Kollektion der Moderne zusammen. So zählte er zu jenen Pionieren, die schon sehr zeitig Picasso-Bilder erwarben.

Paul Cézanne: „Liegender weiblicher Akt“ (um 1886/90). Vermächtnis Eduard von der Heydt, 1964 (Foto: Von der Heydt-Museum Wuppertal)
Doch nicht nur das. Durchaus gleichberechtigt kamen künstlerische Arbeiten aus Asien, Afrika und Ozeanien hinzu. Etliche Fotografien aus Von der Heydts großbürgerlichen Villen und sonstigen Wohnsitzen bezeugen solch hierarchieloses Nebeneinander im Sinne einer übergreifenden „Weltkunst“-Idee. Von der Heydt besaß selbst ein Gespür für Qualität, ließ sich freilich auch eingehend von Fachleuten beraten. Man konnte ja nicht alles selbst wissen.
Erstmals in dieser üppigen Form werden nun Eduard von der Heydts Sammlungen wieder zusammengeführt. Rund 320 Exponate repräsentieren die etwa 3500 Stücke, die Eduard von der Heydt erwerben konnte. Skulpturen und Bildnisse aus Asien und Afrika kamen nach dem Zweiten Weltkrieg ins Züricher Rietberg-Museum (Villa Wesendonck), während die überwiegend moderne Kunst ins Wuppertaler Museum zuteil wurde. Jetzt kooperieren beide Institute, um die Gesamtschau zu ermöglichen. In chronologischer Folge werden Aspekte der Sammlerbiographie und der Museumsgeschichte aufgefächert.

Buddha auf dem Schlangenthron, Kambodscha, Khmer-Reich, 12. Jhdt. Sandstein. (Foto: Museum Rietberg, Zürich)
Einige gekonnte Inszenierungen der „Weltkunst“-Schau lassen Kontexte der Sammelzeit aufleben. Immer wieder sieht man hier Originale, die schon auf besagten historischen Fotografien auftauchen. Es ist, als träten sie plastisch aus jener Historie hervor, als würden sie ungeahnt lebendig.
Ein Saal lässt beispielsweise ahnen, wie Von der Heydts Sammelstücke vor der majestätischen Meereskulisse im holländischen Zandvoort (wo er einen Bank gründete) gewirkt haben mögen. Eine weitere Vergegenwärtigung betrifft den Monte Verità, die traditionelle Kultstätte damaliger Lebensreformer, die Eduard von der Heydt kurzerhand kaufte, um dort u. a. ein Hotel zu betreiben. Die künstlerische Ausstattung des (hier teilweise stilgerecht nachempfundenen) Speisesaals hatte wahrhaft museale Qualitäten.
Ach ja. Wir haben bislang noch kaum Künstlernamen genannt. Nun, man müsste ja auch weite Teile der Moderne durchbuchstabieren, von Van Gogh bis Picasso, von Odilon Redon bis Moholy-Nagy, von Hodler bis Jawlensky, von Modersohn-Becker bis Beckmann. Um doch nur wenige zu nennen. Schon beim Presserundgang mussten, um die Fülle zu bewältigen, tatsächlich Meister wie Edvard Munch auch schon mal „links liegen gelassen“ werden, sonst wäre der Termin zeitlich ausgeufert.
Zu all den Werken der Europäer gibt es faszinierende Beispiele für afrikanische und asiatische Kunst, die nicht etwa unter soziologischen, sondern unter ästhetischen Gesichtspunkten gesammelt wurde; wie denn überhaupt Eduard von der Heydt vor allem der Schönheit huldigte und mit der Kunst keinen hehren Bildungsauftrag für die einfachen Leute verfolgte. Das unterschied ihn von Karl Ernst Osthaus, der ein paar Jahrzehnte zuvor von Hagen aus zum sendungsbewussten Botschafter der Moderne wurde.
Die Ausstellung, kuratiert von Antje Birthälmer, verschweigt auch nicht Eduard Von der Heydts notgedrungenes Lavieren im „Dritten Reich“. Die Familie zählte zum engeren Kreis um Kaiser Wilhelm II., der einen reaktionären Kunst-Geschmack hatte, sich aber nie kritisch zur fortschrittlich orientierten Sammeltätigkeit der Banker geäußert haben soll.
Spürbar ist ein abwägendes Bemühen um geschichtliche Gerechtigkeit. Nach 1946 wurde Von der Heydts zunächst zwiespältig erscheinendes Verhalten in der NS-Zeit gerichtlich untersucht. Es sieht so aus, als hätte er sich einigermaßen anständig verhalten und jedenfalls keine Kunst-„Schnäppchen“ auf Kosten drangsalierter jüdischer Mitbürger an sich gebracht.
Ein überaus kompliziertes Diagramm soll außerdem veranschaulichen, wie Eduard von der Heydt staatliche Geldflüsse, gedacht für deutsche Spionage, teilweise umgeleitet hat, um Juden vor der Verfolgung zu retten. Allerdings herrscht auf diesem Felde immer noch Klärungsbedarf. Abermals soll ein Symposion im Rahmen der Ausstellung der schwierigen Wahrheit näher kommen.
Im Laufe des Rundgangs fragt man sich gelegentlich, was dieser Sammler denn eigentlich für ein Mensch gewesen sei. Eine Fotografie zeigt Eduard von der Heydt als eine Art Buddha im Schneidersitz. Er wirkt freundlich, aber letztlich auch unnahbar. Aus seinem Privatleben drang wenig bis nichts nach außen; ganz so, als hätte er – im Reich einer vermeintlich reinen Ästhetik – über allem geschwebt.
„Weltkunst. Von Buddha bis Picasso. Die Sammlung Eduard Von der Heydt“. 29. September 2015 bis 28. Februar 2016. Von der Heydt-Museum, Wuppertal, Turmhof 8. Eintritt 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, Katalog 25 Euro. Geöffnet Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Mo geschlossen. Info-Hotline: 0202/563-26 26. www.von-der-heydt-museum.de / www.weltkunst-ausstellung.de
44.000 Tickets – Intendant Johan Simons zieht positive Bilanz seiner ersten Ruhrtriennale
Die Ruhrtriennale nähert sich ihrem Ende. Deshalb zog Intendant Johan Simons jetzt eine erste Bilanz. Wie nicht anders zu erwarten, war das Festival sehr erfolgreich, alles in allem wurden 44.000 Eintrittskarten verkauft.
Es gibt der Zahlen etliche mehr; genannt sein sollen noch die Verkäufe für Simons’ großformatige eigene Regiearbeiten „Accattone“ (6500 Karten) und „Das Rheingold“ (6020 Karten). Bemerkenswert ist die kurzfristige Vermehrung der Zeit-„Slots“ bei „Orfeo“ in der Kokerei Zollverein von 400 auf 460. Zur Erläuterung: Pro Zeitslot wandern in Viertelstundenabstand acht Zuschauer durch eine fein installierte Alltagshölle, in welcher (Haus-) Frauen mit ausdruckslosen Gummimasken ein freudloses Dasein fristen. Der Durchgang dauert rund eine Stunde, an zentraler Stelle spielt ein Orchester ebenfalls mit Gummimasken Monteverdi-Musik, und diese Installation von Susanne Kennedy, Suzan Boogaerdt und Bianca van der Schoot ist für die einen banal und für die anderen ein geniales Kunstwerk. Auf jeden Fall ist es ein Kunstwerk mit arg begrenzter Kapazität.

Spielt hier im nächsten Jahr die Ruhrtriennale? Portal der Jugendstil-Maschinenhalle auf Zeche Zollern. (Foto: Martin Holtappels/LWL)
Dortmund darf hoffen
Die nächste Triennale findet vom 12. August bis zum 25. September 2016 statt. Was Johan Simons schon in der Pipeline hat, verrät er natürlich nicht. Ein bißchen hat er aber doch gesagt, beispielsweise zu der Frage, ob es im nächsten Jahr neue Spielorte geben wird: „Ich hoffe, es wird Dortmund!“
An der Jugendstilhalle auf Zeche Zollern hatte die Triennale ja beizeiten Interesse gezeigt, letztlich wurde es 2015 aber nichts mit diesem Spielort. Jetzt scheint die Halle als markanter Dortmunder Ort wieder in der Diskussion zu sein, zusammen mit der Phoenix-Halle am Phoenixsee, die ihrer Bestimmung als Eventstandpunkt entgegendämmert.
Kein Dinslaken, kein Wagner
Zeche Lohberg in Dinslaken, das Hallenmonstrum, in dem „Accattone“ lief, hat 2016 Pause. Da derzeit aber wieder fraglich ist, was dauerhaft aus dem gigantischen Schuppen werden soll, will Simons für 2017 noch keine Prognosen wagen.
Und was macht der Triennale-Ring? Nach „Rheingold“ ließe sich doch trefflich weiter an im bosseln. Doch eine Wagner-Inszenierung sei für 2016 definitiv nicht auf dem Plan, so der Intendant.
Musikalische Lesereise durch die Theater des Ruhrgebiets
Bis zur nächsten Triennale ist jetzt bald Pause – aber doch nicht ganz. Mit einer kleinen Tournee durch die Theater des Reviers möchte Johan Simons dem Publikum in Erinnerung bleiben. Deshalb gibt es – die Termine stehen unten – musikgeschichtliche Lesungen aus dem dicken Sachbuch-Bestseller „The Rest is Noise“ des Musikkritikers Alex Ross. Lesen werden Mitglieder der jeweiligen Ensembles unter Simons’ Regie; zudem spielen Musiker der Bochumer Symphoniker unter Leitung von Carl Oesterhelt bei dieser „literarisch-musikalischen Etappenreise“. Ein Abend soll um die drei Stunden dauern, eine Pause haben und 15 Euro Eintritt kosten. Und entspannt soll es zugehen, sagt Simons, gerne mit Getränken und ein paar Tischchen im Zuschauerraum.
Wir sind gespannt. Und die Kontaktaufnahme zu den Theatern der Region, die in der Planung früherer Triennale-Intendanten schlichtweg nicht vorkamen und sich deshalb übergangen fühlten, ist eine ausgezeichnete Idee, aus der mehr werden könnte.
Hier noch die Termine von „The Rest is Noise“:
- Schauspiel Essen 5.11.2015
- Schloßtheater Moers 3.12.2015
- Schauspiel Dortmund 21.01.2016
- Theater Oberhausen 04.02.2016
- Theater a.d. Ruhr Mülheim 17.03.2016
- Schauspielhaus Bochum 07.04.2016
„Das ist doch keine Kunst“ – Strips und Cartoons in der Ludwiggalerie Oberhausen

Bilder von Ralph Ruthe, Joscha Sauer und Felix Görmann hängen jetzt in Oberhausen im Schloß. Dieses Motiv ziert den Katalog. (Foto: Ludwiggalerie Oberhausen/Ruthe, Sauer, Flix)
In der Ludwiggalerie im Oberhausener Schloß hängen jetzt Cartoons und Comics an den Wänden. Ralph Ruthe, Joscha Sauer und Felix Görmann („Flix“) heißen die Zeichner, die man namentlich möglicherweise nicht kennt, deren bunte Bildgeschichten jedoch weit verbreitet sind, in Zeitungen und Zeitschriften, im Internet oder auch in Büchern auftauchen. Im Museum jedoch erwartet man Cartoons und Comics eher nicht. Gehören sie überhaupt dort hin?
Dr. Christine Vogt, Direktorin der Ludwig-Galerie, würde diese Frage jederzeit heftig bejahen und vielleicht auf vergangene Projekte verweisen. Ralph König und Walter Moers („Das kleine Arschloch“, „Käpt’n Blaubär“), die beiden wohl bedeutendsten deutschen Zeichner der Gegenwart, hatten in Oberhausen bereits ihre Einzelausstellungen. Ruthe, Sauer und Flix entstammen in gewisser Weise einer nachfolgenden Generation, sind alle in den 70er Jahren geboren, jetzt schon etliche Jahre erfolgreich im Geschäft und bieten sich somit für eine Nachfolge an.
Kurz und klassisch
Ralph Ruthe erzählt seine Geschichten bevorzugt mit dem Einzelbild. Auch wenn er einmal mehrere Bilder verwendet, zielt er doch auf die eine Pointe und den spontanen Lacher. Ganz offenbar ist er ein Freund des gnadenlosen Kalauers, wenn er beispielsweise den Postboten zum Bauern schickt, weil der „ein Feld bestellt hat“. Andere Arbeiten sind poetischer, stiller, doch ein Lacher ist eigentlich immer drin. Von Ruthe stammt übrigens der meist dreibildrige Strip „Frühreif“, dessen Held ein neunmalkluger Bengel in den Wirren der beginnenden Pubertät ist und der unter anderem in der Wochenendbeilage der WAZ läuft.
Akribische Handwerker
Alle drei Zeichner, das macht diese Museumsschau deutlich, sind akribische Handwerker, die offenbar noch ganz altmodisch mit Stiften auf Papier zeichnen und nicht auf das iPad. Vorentwürfe und verschiedene Ausführungen hängen hier nebeneinander, man ahnt die Widrigkeiten, die die Animation der später so schwerelos auftretenden Strichmännchen und –weibchen in manchen Schaffensphasen bereitet. Entwurfsarbeiten sind übrigens meistens größer als die letztlich gedruckten Comics und Cartoons.
Sensenmann und Lemminge
Eine gewisse Abgründigkeit durchzieht das Werk Joscha Sauers. Immer wieder kommt bei ihm der Sensenmann ins Spiel, haben die Lemminge Probleme mit ihrem selbstmörderischen Lebensentwurf. Und dem Hahn auf dem Hof reicht das Krähen nicht mehr, weshalb er dem Bauern bei Sonnenaufgang mit der Wasserspritze auf die Pelle rückt. Sauers Skizzenbuch, Blätter daraus sind in einer Vitrine zu sehen, hat die Anmutung eines wüsten Underground-Comics, doch seine Cartoons sind auf geradezu bedächtige Weise komponiert und ausgeführt.
Konservative Pinselführung
Konventionalität in der Ausführung fällt allerdings bei allen drei Artisten ins Auge. Auch Flix, der vor einigen Jahren dazu überging, dem männlichen Personal seiner Comics trapezförmige glatte Nasen zu verpassen, erzählt ansonsten mit eher konservativem Malduktus. Gleichwohl ist er von allen Dreien der experimentierfreudigste. Perspektiven und Formate wechseln heftig, außerdem scheint er Spaß an vielen schön widergegebenen Bilddetails zu haben. Besonders eindrucksvoll gerieten „Handtuchbilder“ aus der Vogelperspektive, die viele leicht bekleidete Frauen im Freibad auf ihren Handtüchern liegend zeigen. Das eine Männchen im Bild, das von so viel Weiblichkeit geradezu erschlagen dumm dasteht, muss natürlich sein, sonst wäre das Bild nur ein Bild und noch keine Geschichte. Aber Comics und Cartoons erzählen nun einmal abgeschlossene Geschichten, und seien sie noch so kurz. Auch die schnell hingeworfenen Animationszeichnungen von Flix, die in einer Vitrine liegen und ein bisschen an altmeisterliche Skizzenbücher denken lassen, zeugen von dessen Könnerschaft.
Die meisten in Oberhausen ausgestellten Arbeiten sind lieb und nett, enden keineswegs unerwartet. Amerikanische Zeichner wie Robert Crumb oder Gilbert Shelton, die in anstoßerregenden Strips einst Drogenexzesse und sexuelle Obsessionen zu Papier brachten, finden hier nicht ihre Nachfahren. Das ist kein Vorwurf, nur eine einordnende Feststellung.
Und gehört das nun ins Museum oder nicht? Unbestreitbar sind Bilder, die für Printmedien geschaffen werden, dort auch am besten präsentiert. Es ist für sich genommen nicht sinnvoll, verkürzt gesagt, Seiten aus einem Comic-Strip herauszunehmen und gerahmt an die Wand zu hängen. Die Oberhausener Schau erzählt jedoch eine Menge mehr über die drei Zeichner und ihr Werk, und angesichts der klugen und stilsicheren Präsentation verblasst die Frage nach der Sinnhaftigkeit recht bald.
- „Ruthe Sauer Flix – Das ist doch keine Kunst. Comics und Cartoons zwischen Shit happens, Nicht lustig und Schönen Töchtern“
- Bis 17. Januar 2016. Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, Konrad Adenauer Allee 46.
- Geöffnet Di-So 11-18 Uhr, Eintritt 8 Euro.
- Der empfehlenswerte Katalog erschien im Carlsen-Verlag und kostet 29,80 Euro.
- www.ludwiggalerie.de
Von der Kunst in der Fremde – Gine Selles Roman „Ausflug ins Exil“
 Gine Selle ist bildende Künstlerin – eigentlich. Nun legt die Dortmunderin ihren ersten Roman vor. „Ausflug ins Exil“ handelt von Chile heute und Deutschland gestern, von starken Frauen und der Kunst, das Leben zu meistern.
Gine Selle ist bildende Künstlerin – eigentlich. Nun legt die Dortmunderin ihren ersten Roman vor. „Ausflug ins Exil“ handelt von Chile heute und Deutschland gestern, von starken Frauen und der Kunst, das Leben zu meistern.
Gine Selle: Schon ihr Schaffen als bildende Künstlerin ist ungewöhnlich vielfältig. In den vergangenen Jahren arbeitete die 49-Jährige mit Fotografie, Film und Audios. Sie malt und zeichnet, lithographiert und collagiert, knüpft und kopiert. Sie verschickt künstlerisch gestaltete Postkarten an Phantasie-Adressen und schaut, was mit ihnen passiert („Das Rückkehrer-Projekt“). Ebenso breit ist ihr Themenspektrum: Sie beschäftigte sich mit Kommunikation im Allgemeinen und Höhlenmalerei im Besonderen, mit Familienkonstellationen, mit dem Bayerischen Wald (ihrer zweiten Heimat) und, als ausgebildete Heilpraktikerin, mit Medizin-Themen. Das klingt wahllos, ist es jedoch nicht. Der rote Faden durch ihr Werk drängt sich nicht sofort auf, bleibt aber stets sichtbar. Es geht, immer wieder, um die oder das Fremde, um Verfremdung und das Vertrautwerden.
 Dass diese Künstlerin nun einen Roman vorlegt, überrascht nur auf den ersten Blick: Schon mit ihren ersten literarischen Gehversuchen gewann sie vor einigen Jahren den ersten Preis in einem Kurzgeschichtenwettbewerb. Seitdem feilte sie an ihrem Stil, belegte Literaturkurse und ließ sehr langsam den ersten Roman wachsen. Nun ist er fertig – ein Episodenroman, pendelnd zwischen Deutschland und Chile, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Erlebtem und Fiktion.
Dass diese Künstlerin nun einen Roman vorlegt, überrascht nur auf den ersten Blick: Schon mit ihren ersten literarischen Gehversuchen gewann sie vor einigen Jahren den ersten Preis in einem Kurzgeschichtenwettbewerb. Seitdem feilte sie an ihrem Stil, belegte Literaturkurse und ließ sehr langsam den ersten Roman wachsen. Nun ist er fertig – ein Episodenroman, pendelnd zwischen Deutschland und Chile, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Erlebtem und Fiktion.
„Ausflug ins Exil“, so der Titel, basiert auf Gine Selles Erlebnissen und Erfahrungen bei einem Kunst-Aufenthalt in Chile. Es ist die teils unglaubliche, teils phantastische, mal traurige, mal schockierende Geschichte ihrer chilenischen Gastgeberin, die der Deutschen in langen Gesprächen ihr Leben und ihre Erfahrungen im deutschen Exil schilderte. Gine Selle verwebt diese Geschichten mit ihren eigenen Erlebnissen, mit ihrer Sicht auf das heutige Chile.
Olinda, so heißt die chilenische Gastgeberin, war als junge Frau vor Augusto Pinochets Militär-Diktatur geflohen und im Ruhrgebiet gestrandet. Dort fand sie ihr Zuhause in der linken Szene, agitierte gemeinsam mit deutschen Freunden und mit ihrer kleinen Familie, der dieses Engagement zwischen Politik und Party nicht immer gut bekam.
Die deutsche Künstlerin Karla kommt unter ungleich bequemeren Bedingungen in die chilenische Fremde: Sie wird für ein Mauer-Kunst-Projekt nach Chile eingeladen und verbringt mehrere Wochen in dem Land, das sie nie zuvor besucht hat. Sie saugt das Leben in dem Küstenort Vina del Mar bei Valparaiso begeistert in sich auf, beißt sich aber auch an den Stories ihrer Gastgeberin fest. Die bietet verlässlich neues Geschichten-Futter und impft Karla mit ihrem ganz speziellen Blick, dem Blick einer ehemaligen Exilantin auf die veränderte Heimat.
„Episodenroman“ nennt Gine Selle ihren Roman – und tatsächlich erzählt jedes der 31 Kapitel auf den 291 Seiten eine eigene kleine Geschichte. Und doch ist dieser Roman mehr als eine Ansammlung amüsant geschriebener Kurzgeschichten. Geschickt knüpft die Autorin Erzählstränge über mehrere Geschichten, baut Spannung auf und hält sie aufrecht. So wie Karla sich mehr und mehr fesseln lässt von Olindas Geschichten, lässt sich auch der Leser gerne und ganz ein auf die Lebenswege dieser beiden Frauen, die sich nur an einem winzigen Punkt für wenige, aber sehr fruchtbare Wochen kreuzen.
Ein Künstler-Roman ist dieses Buch in dreifacher Hinsicht: Erstens wurde es von einer Künstlerin geschrieben, zweitens handelt es von einer Künstlerin – und drittens enthält es Illustrationen. Das Buch ist bevölkert von charmanten kleinen Litographie-Lebenwesen, die auch auf grafischer Ebene von Fremdheit und Kommunikation, Phantasie und Parallelwelten erzählen.
Eine Vorstellung des Romans gibt es am Samstag, 12. September (18 Uhr) im Jazzclub „domicil“ in Dortmund, Hansastraße. An diesem Tag wird ebenfalls eine Ausstellung von Gine Selle in der domicil-Galerie eröffnet.
Gine Selle: „Ausflug ins Exil“. Episodenroman. Epubli Verlag 2015, 12,80 Euro. Zu beziehen unter gineselle.de oder bei epubli.de.
Auf der Suche nach dem Wesen Westfalens – eine Schau wie aus dem Füllhorn
Was bedeutet heute noch das Wort „westfälisch“, was war und ist sein Wesenskern? Gibt es ein Gemeinschaftsgefühl der Einwohner Westfalens? Mit derlei gewichtigen Fragen hantiert jetzt eine Ausstellung im Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte.
Rund 800 Exponate – hie und da kleinteilig gezählt – bietet man für die Schau „200 Jahre Westfalen. Jetzt!“ auf. Die historische Maßzahl leitet sich vom Wiener Kongress her, nach dem Westfalen anno 1815, fast schon exakt in seinen heutigen Grenzen, zum Bestandteil Preußens wurde.
Weitaus älter als das Rheinland
Harry Kurt Voigtsberger, Präsident der Nordrhein-Westfalen-Stiftung, hält dafür, dass es Westfalen sozusagen „schon immer“ (erste Erwähnung im 8. Jahrhundert) gegeben hat, während das Rheinland sich erst ganz allmählich als solches verstanden habe. Auch Dortmunds OB Ullrich Sierau gab sich bei der Pressevorbesichtigung amtsgemäß lokal- und regionalpatriotisch. An die Frage, ob nun Münster oder Dortmund die wahre Westfalenmetropole sei, wurde dabei jedoch nicht gerührt.

Grubenpferd trabt in Richtung Bergmanns-Wohnzimmer, dahinter ein Kleinstwagen aus westfälischer Fabrikation. (Foto: Bernd Berke)
Es schwirrten jedoch kleine Pfeile in Richtung Düsseldorf und Köln. Die Westfalen, so hieß es, halten, was die Rheinländer versprechen. Fast hätte man denken können, hier ginge es nicht in erster Linie um eine Ausstellung, sondern vor allem um eine regionalpolitische und touristische Maßnahme zur Stützung des manchmal etwas vernachlässigten Teils von NRW. Schirmherrin der Schau ist übrigens NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD), die auch zur Eröffnung sprechen wird.
Klischees und ihre Kehrseite
Es ist wohl nur folgerichtig, dass die Ausstellung gleich zu Beginn die Klischees aufgreift, die über Westfalen seit langer Zeit in Umlauf sind. Demnach sind die hiesigen Landsleute bodenständig, verwurzelt, stur, manchmal auch ein wenig rückständig und provinziell. Das alles kann man natürlich auch positiv wenden. Hier, so die wohlwollende Lesart, macht man eben kein überflüssiges Tamtam, man ist traditions- und kostenbewusst, während man am Rhein immer gleich loslegen will, koste es, was es wolle.

Auch eine Dortmunder Kneipe im Stil der 50er Jahre zählt zum Inventar der Ausstellung. (Foto: Bernd Berke)
Was aber bekommt man in Dortmund zu sehen? Nun, lauter angehäufte Schauwerte, überwiegend dicht an dicht. Hier steht ein Pferd, dort ein Kleinstwagen, dazwischen sieht man das Wohnzimmer eines Bergmanns und seine noch von Kohlenstaub geschwärzte Berufskleidung. In diesem Ambiente dürfen die Besucher sich auch vors alte Röhrenfernsehgerät setzen und betagte Broschüren durchblättern, wobei ihnen besagtes Pferd über die Schulter schaut und nicht etwa das Westfalenross darstellt, sondern ein Grubenpferd, das sein Gnadenbrot bekommt.
Hin und her durch die Zeiten
Einige Schritte weiter ist eine Dortmunder Kneipe der 1950er Jahre aufgebaut, nebenan prangen Dampfmaschinen- und Eisenbahnmodelle, die für die Zeit der Industrialisierung stehen. Eine mit Original-Mobiliar nachempfundene Amtsstube soll uns derweil in die Zeit des Freiherrn vom Stein zurückversetzen, der als preußischer Reformer auch die frühen Geschicke Westfalens bestimmte.
Noch ein Zeitsprung: Zwei Jungs aus Waltrop haben ihr heimisches Zimmer ins Museum gegeben – mitsamt jeweiliger Fan-Bettwäsche. Der eine steht auf den BVB, der andere auf Schalke. So dicht beieinander, wirkt das schwarzgelb-blauweiße Farbenspiel schon beinahe schockierend. Aber gut. Man ist ja tolerant. Beides gehört zu Westfalen.
Es ließen sich noch etliche, mehr oder weniger kuriose Exponate aufzählen, beispielsweise ein als zoologische Rarität präsentiertes Mischwesen („Gänseziege“), das allerdings auf einen Scherz des einstigen Münsteraner Zoodirektors Hermann Landois zurückgeht, der mit seinem bizarren Einfall Besucher anlocken wollte. Hübsche Anekdote. Landleben, Schützenfeste, Karneval und manches andere Thema werden gleichfalls gestreift.
Und. Und. Und. Kurzum: Man fühlt sich insgesamt ein wenig hin- und hergezogen und wähnt sich manchmal gar in einem Labyrinth.
Freihändige Leihgaben der Heimatvereine
Nun war zur Pressekonferenz noch keine Beschriftung der Ausstellungsstücke vorhanden, die Veranstalter haben terminlich „auf Kante genäht“. Somit bleibt zunächst der Eindruck eines Füllhorns, ja eines Wunderkammer-Sammelsuriums, das zuweilen reichlich assoziativ arrangiert worden ist. Mag sein, dass sich all dies im fertigen Zustand besser erschließt. Auch dürfte man sich dann besser in gewisse Einzelheiten vertiefen können. Ein Motto der Ausstellung lautet jedenfalls „Mach dir dein eigenes Bild“. Ja, diese Freiheit wird man sich wohl nehmen müssen.
Zu den 136 Leihgebern zählen zahlreiche westfälische Heimatvereine, deren Dachverband heuer sein hundertjähriges Jubiläum begeht. Die Vereine durften Stücke nach Gusto einreichen, das vielköpfige Ausstellungsteam (Kuratorinnen: Dr. Brigitte Buberl, Carina Berndt) musste dann halt zusehen, ob sie im Konzept unterzubringen waren. Keine leichtes Unterfangen, fürwahr.
Wandelbares Territorium
Die Schau ist in sechs Hauptbereiche gegliedert, welche da heißen: Prolog, Gewächshaus, Siedlung, Horizont, Archiv und Territorium. Klingt nach knirschender Kopfarbeit. Das „Territorium“ wird sich im Laufe der Ausstellungsdauer zweimal grundlegend verändern und vorherige Bestände ins Archiv auslagern. Anfangs steht der Aufbruch in die Moderne im Fokus, hernach wird es ab November u. a. um Wasser als Triebkraft gehen (Talsperren, Kanäle etc.) und schließlich ab Januar 2016 um Einwanderung und Integration in Westfalen. Man hat dies wohl aus nahe liegenden Gründen als Pflichtprogramm verstanden.
Nun verraten wir noch, was es mit dem genannten Kleinstwagen auf sich hat. Es ist ein Kleinschnittger-Cabrio aus den 50er Jahren, hergestellt im westfälischen Arnsberg. Das heute niedlich wirkende Fahrzeug hatte keinen Rückwärtsgang. Und was lernen wir daraus? In Westfalen blickt man nicht nur zurück, sondern oft auch ganz entschieden nach vorn.
„200 Jahre Westfalen. Jetzt!“ 28. August 2015 bis 28. Februar 2016 im Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Dortmund, Hansastraße 3. Tel.: 0231/2 55 22. www.mkk.dortmund.de in Kooperation mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und dem Westfälischen Heimatbund.
Geöffnet Di, Mi, Fr, So 10-17, Do 10-20, Sa 12-17 Uhr. Eintritt 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Katalog 19,90 Euro. Umfangreiches Begleitprogramm, außerdem Aktionen wie Westfälische Büffets und „Selfie“-Fotos an bestimmten Punkten der Ausstellung.
Die Schau wandert – in verkleinerter Form – ab Mai 2016 in neun weitere westfälische Orte: Wadersloh, Brilon, Höxter-Corvey, Lüdenscheid, Lüdinghausen, Bünde, Gescher, Minden und Paderborn.
Aseptische Ereignislosigkeit: Die „Orfeo-Installation“ der Ruhrtriennale

Eurydike in der Unterwelt. Der Teppichboden hat einen sichtlich hohen Synthetik-Anteil. Von Orpheus keine Spur. (Foto: Julian Röder/Ruhrtriennale)
Die arme Eurydike. Isoliert hockt sie in Zimmern herum, die wie eine Vorhölle aus Plastik anmuten, wie ein aseptischer Albtraum zwischen Disneyland und Reha-Klinik. Sprechen kann sie nicht, denn eine Gummimaske mit wulstigen Lippen nimmt ihr Gesicht und Alter.
Geklont wurde sie offenbar auch, denn wir, die Besucher der Ruhrtriennale, begegnen auf unserem Gang durch das Labyrinth neongrell erleuchteter Zellen rund einem Dutzend Eurydikes mit wasserstoffblonden Perücken, die hier ein ebenso rätselhaftes wie freudloses Dasein fristen.
Von Orpheus weit und breit keine Spur. Aber die Musik, die der Komponist Claudio Monteverdi dem sagenumwobenen Sänger der griechischen Mythologie auf den Leib schrieb, begleitet uns als Soundtrack auf dem Weg. Sein Meisterwerk „Orfeo“, das als erste Oper der Musikgeschichte gilt, hallt durch die Weiten der Mischanlage der Essener Zeche Zollverein, wenn auch nur auszugsweise und häufig von elektronischen Klängen überlagert. Gespielt vom 2006 in Berlin gegründeten Solistenensemble Kaleidoskop, lassen die himmlisch reinen Harmonien uns andere Sphären ahnen, gewissermaßen Luft von anderen Planeten, ohne die wir in der seelenlosen Banalität dieser Umgebung womöglich erstickten.
Für die 1977 geborene deutsche Regisseurin Susanne Kennedy, die für die jüngste Produktion der Ruhrtriennale erneut mit dem niederländischen Performance-Duo Suzan Boogaerdt und Bianca van der Schoot zusammen gearbeitet hat, bildet Monteverdis Meisterwerk die Folie für eine Installation, die gut und gerne auch für die Kasseler Documenta taugen könnte. Mit Monteverdi als Stichwortgeber schuf sie eine rund 80-minütige „Sterbeübung“, die von den Besuchern in Gruppen zu maximal acht Personen zu absolvieren ist. Bewusst lässt sie die Figur des Orpheus links liegen, um sich auf die vermeintlich vernachlässigte Eurydike zu konzentrieren und uns so zum Nachdenken über Leben und Tod zu bringen.
Ein bisschen geht es dabei zu wie im Yoga-Unterricht, denn vieles dreht sich um die Kunst des Loslassens, die Orpheus bekanntermaßen nicht beherrschte, trachtete dieser Tropf doch danach, die verstorbene Eurydike durch seinen Gesang der Unterwelt zu entreißen. Und schaute dann auch noch im falschen Moment zurück. Wir aber sollen es besser machen, sollen das Unvermeidliche akzeptieren, wenn unsere Zeit gekommen ist. Dazu fordern uns Texte auf, die mal über Kopfhörer zu hören sind, mal über Video-Leinwände flimmern oder auf handgekritzelten Zetteln an den Wänden haften.

Was hier wie ein Tänzchen aussieht, soll Ausdruck von Seelenqual sein: Eurydike kann nicht leben, aber auch nicht sterben (Foto: Julian Röder/Ruhrtriennale)
Wer kein Englisch versteht, ist bei dieser „Orfeo“-Installation übrigens ähnlich arm dran wie Zuspätkommer und alle, die kein festes Schuhwerk tragen oder nicht gut zu Fuß sind. Weder bietet das Triennale-Team Übersetzungen an, noch gibt es bei der „Sterbeübung“ Sitzgelegenheiten: Sie muss buchstäblich durchgestanden werden. Eine komfortable oder gar angenehme Erfahrung soll dieser „Orfeo“ keineswegs sein. Diesen Anspruch hatte die Regisseurin im Vorfeld formuliert. Dass sie ihn einlöst, kann freilich auch als zweischneidiges Schwert betrachtet werden. Der Besucher muss sich dieser Produktion aussetzen, ihre Ereignislosigkeit ertragen, denn über weite Strecken kann er nichts weiter tun, als verlegen herumzustehen und den starren Blick der Zombie-Eurydikes zu erwidern.
Wenn wir endlich sitzen dürfen, sind wir in einem Wartezimmer wie beim Hausarzt. Wir warten auf unseren Aufruf, mit zunehmend mulmigen Gefühlen. Denn keiner derer, die von den stummen Eurydikes durch zwei symbolbehaftete Türen hinaus geführt werden, kehrt zurück. Sie verlassen das Spiel, nehmen den Ausgang. Was mag sich hinter den letzten beiden Türen verbergen? Was haben jene gesehen, die uns verlassen? Wo gehen sie hin? Es kann keine Antworten geben. Für heute scheiden wir mit der inständigen Hoffnung, dass der Tod, wenn er uns holt, im Gegensatz zu Eurydike wenigstens keine Söckchen mit Delfin-Aufdruck trägt.
Bis 6. September 2015. Ticket-Hotline: 0221/280 210, Informationen und Termine: www.ruhrtriennale.de/de/orfeo
Portraitist der jungen Bundesrepublik – Bilder von Hans Jürgen Kallmann in Haus Opherdicke
Der Kopf von Bert Brecht ist so groß, daß er kaum auf das Blatt paßt; der Kopf von Franz Josef Strauß füllt kaum die Hälfte des Blattes und ähnelt in seiner halslosen Rundheit einer Bowlingkugel. Zufall? Vielleicht schon, zwischen den beiden Pastellen liegen fast 30 Jahre. Vielleicht aber auch nicht. Der Maler Hans Jürgen Kallmann, der von 1908 bis 1991 lebte und dem der Kreis Unna nun in Haus Opherdicke eine Ausstellung ausrichtet, hatte Humor.
Kallmanns Kunst ist anspruchsvoll, aber nicht sperrig, war es wohl auch zu keiner Zeit. Natürlich probierte der junge Mann vieles von dem aus, was in den 20er, 30er Jahren in der Malerei als modern galt, versuchte sich in impressionistischen und expressionistischen Bildauffassungen – doch wenn man durch die Bilderschau im Obergeschoß wandert, sieht man schnell, daß größte Stärken in der Abbildung von Menschen und Tieren liegen.
„Entarteter Künstler“
Den Tieren verdankt Hans Jürgen Kallmann sozusagen seine Einordnung als „entarteter Künstler“, 1937 bereits. Wenn Geschichten wie diese im mörderischen Rassenwahn der deutschen Nationalsozialisten nicht einen so ernsten Hintergrund hätten, müßte man über sie lachen. Eins der Kallmann-Bilder nämlich, die die Nazis aus Ausstellungen in Köln und Berlin entfernten, zeigte eine „Hyäne in der Nacht“, an der den Machthabern mißfiel, daß eine „rassisch minderwertige“ Tierart Hauptthema eines Bildes war. Auf so was muß man erstmal kommen. Hans Jürgen Kallmann konnte mit dem Stigma des „entarteten Künstlers“ einigermaßen leben, wenngleich er bis zuletzt Angst vor Diffamierung und weiterer Repression hatte.
Und nach dem Krieg kam die große Zeit für den Künstler. Politisch unbelastet und dem angesagten Informel der Wirtschaftswunderzeit gegenüber eher ablehnend gestimmt, wurde er schnell zu einem der gefragtesten Portraitisten der jungen Bundesrepublik. Konrad Adenauer, der erste Kanzler, hatte mehrere Sitzungen bei Kallmann, in denen 17 Pastelle entstanden sowie das Ölbild, das im Bundeskanzleramt die Reihe der deutschen Kanzler eröffnet. Die Pastelle, die ähnlich wie Fotoserien verschiedene Perspektiven ausprobieren, gefielen „dem Alten“ – im Entstehungsjahr 1963 war Adenauer 89 Jahre alt – übrigens besser als das naturgemäß recht statuarische Endprodukt in Öl, erinnert sich die Witwe des Künstlers Dr. Gerda Haddenhorst-Kallmann. Sie hat er übrigens 1977 in Öl und im Profil gemalt und das Bild „Gerda in Burgunder“ genannt. Wahrscheinlich ist das burgunderfarbene Kleid der Gemahlin gemeint, doch läßt die Zubereitung „in Burgunder“ durchaus auch ans Essen denken. Ein „lecker Mädchen“ mithin in rheinischer Lesart. Der Maler hatte Humor.
Leuchtende Trompete
Den Bundespräsidenten Theodor Heuss (1884-1963) hat er gemalt, den Philosophen Ernst Bloch (1885-1977), Papst Johannes XXIII (1881-1963) und viele mehr. Nicht alle Bilder entstanden nach persönlichen Begegnungen in Sitzungen. Louis Armstrong beispielsweise malte Kallmann in starker expressionistischer Verknappung, ein konzentrierter Mensch vor dunklem Grund, dessen Trompete, mit großen Händen gespielt, gelbgolden hervorleuchtet.
Überhaupt, die Künstler: Da geht die Reihe von der Opernsängerin Grace Bumbry bis zum Dirigenten Hans Knappertsbusch, vom Autor Rolf Hochhuth bis zur Schauspielerin Tilla Durieux (1880-1971).
Pastelle geraten nach der Natur, hin und wieder jedoch genehmigt sich der Künstler eine pointiertere Deutung seines Gegenübers, wenn er etwa den italienischen Schauspieler Lino Ventura (1919-1987) mit einer momenthaften, jedoch überaus charakteristischen abwägend-zögerlichen Gesichtsmimik zeigt, die optisch durch die vorgestülpte Unterlippe geprägt wird; oder wenn er sich – eine ungewöhnliche Anordnung – im Gespräch mit dem österreichischen Schauspieler Helmut Qualtinger (1928-1986) abbildet und Qualtingers Kopf in dem Bild viel, viel größer ist, als es nach der Natur sein könnte. Vermutlich ist dies eine tiefe Verbeugung des Malers vor dem intellektuellen Bühnenberserker, der an der Welt litt, dem Alkohol zugewandt war und zu früh starb.
Bilder aus Ismaning
Thomas Hengstenberg als Leiter des Fachbereichs Kultur und Sigrid Zielke-Hengstenberg als Kulturrefentin haben die rund 90 Arbeiten in Haus Opherdicke sinnhaft zusammengestellt und klug gegliedert. Die meisten von ihnen sind Leihgaben des Kallmann-Museums in Ismaning, wo der Künstler seit den frühen 60er Jahren lebte.
Bilder wie die jetzt gezeigten, die zahlreichen Pferdebilder zumal, gefallen vielen Menschen auch heute noch. Würde man sie deshalb gefällig nennen, wäre das ungerecht, weil dem Wort eine gewisse Geringschätzung anhaftet. Hans Jürgen Kallmanns Bilder sind harmonisch in Farbe und Strich, handwerklich untadelig, souverän proportioniert und, so weit es die Portraits betrifft, von psychologischer Genauigkeit. Außerdem bieten sie ein oft vergnügliches Wiedersehen mit berühmten Köpfen von früher. Ein großes Aufregerthema jedoch ist dieses Oeuvre nicht. Wer sich über Kunst aufregen will, braucht nicht nach Opherdicke zu kommen.
- Hans Jürgen Kallmann, Haus Opherdicke, Dorfstraße 29, Holzwickede.
- 23. August bis 22. November 2015
- Geöffnet Di-So 10.30 – 17.30 Uhr
- Eintritt 4 €, Katalog 24 €
- www.kreis-unna.de, www.kulturkreis-unna.de
RuhrTriennale: „Nomanslanding“ im Duisburger Hafen überwindet alles Trennende
Auf den ersten Blick wirkt das Ganze wenig spektakulär. Zwei halbierte Rieseneierschalen stehen da irgendwie auf dem Wasser und erinnern an Konzertmuscheln, was aber keinen Sinn ergibt, weil sie sich ja gegenüber stehen und deshalb kein Publikum beschallen können. Stege führen ans Ufer. Die Installation, um eine solche handelt es sich also offenbar, befindet sich im „Eisenbahnbassin“, einem Hafenbecken in Duisburg Ruhrort, das früher einmal der Eisenbahnhafen war und heute mehr oder weniger funktionslos ist. Hier steht das Wasser sehr still, was ein Grund gewesen sein mag, „Nomanslanding“ hier aufzubauen.
„Nomanslanding“ heißt das Gebilde, für das sich eine deutsche Übersetzung nicht eben aufdrängt. „Niemandes Landung“ vielleicht, „keines Menschen Landung“? Jedenfalls sind die beiden Rieseneierschalen im Duisburger Hafen neben Joop van Lieshouts phantasievollem Siedlungsgewürfel vor der Bochumer Jahrhunderthalle die bedeutendste skulpturale Arbeit der diesjährigen Ruhrtriennale. Der Begriff Skulptur indes hilft dem Verständnis nur begrenzt. Vor allem nämlich funktioniert „Nomanslanding“ als Inszenierung.
Und die läuft so ab: Bevor das Publikum sich (abgezählt und sicherheitstechnisch instruiert) über die beiden Stege zu den Muscheln begibt, wird es mit Schwimmwesten ausgestattet, muß es die Teilnahmebedingungen unterschreiben. Dann wird man im Rund der Halbkugel auf einer Sitzbank plaziert – und gewahrt kurze Zeit später fast zufällig, daß sich die eigene Halbkugel auf die andere zu bewegt. Aus einem unsichtbar bleibenden Soundsystem sind derweil Kriegsklänge und vielsprachige Textzeilen zu hören. Immer näher kommt die eine Halbkugel der anderen, schließlich berühren sie einander, es wird dunkel, der Soundtrack bleibt bedrohlich.

Schwimmwesten sind für den Besuch der beiden Muscheln vorgeschrieben. Sie machen ein etwas mulmiges Gefühl. (Foto: rp)
Klagender Gesang ertönt, nach einer weiteren Kunstpause wird es heller im runden Raum, schließlich ergeht die Aufforderung die Hälften zu tauschen. Und nicht unberührt verläßt man das Geschehen, das kaum 30 Minuten dauerte, durch die Halbkugel von gegenüber.
Breit ist der Fundus an Metaphorik, der zur Deutung bereitsteht. An die Überquerung des Flusses Styx ist zu denken, der die Welt der Toten von der der Lebenden trennt, und wenn einem außerdem noch afrikanische Flüchtlingsboote und die dazugehörigen Katastrophennachrichten einfallen, liegt man sicher auch nicht falsch.
Indes, der teilnehmende Künstler Andre Dekker hebt es in seinen Erläuterungen zum Werk ausdrücklich hervor, ist der Bezug ein Gutstück konkreter. Die Arbeit bezieht sich auf den Ersten Weltkrieg, der 1914 ausbrach, will indes nicht Anklage sein, sondern Klage, will der Trauer um die vielen Todesopfer Raum geben. „Ein Klagelied, vielleicht auch ein Wiegenlied“, sagt Dekker. Nämlich dann, wenn aus der traurigen Gewißheit des Geschehenen die vergewissernde Geborgenheit des „Nie wieder!“ sich formt. Sinnliche Symbolhaftigkeit, wenn man so will – und sei es auch nur die Querung von etwas Wasser in einem Duisburger Hafenbecken.
Als die Arbeit 2014 zum ersten Mal in Sydney installiert wurde, jährte sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal. Das war auch für die Australier ein wichtiges historisches Datum, denn als Teil des Commonwealth hatte das Land auf britischer Seite an dem Krieg teilgenommen und hohe Verluste erlitten. Die Duisburger Zweitverwertung 2015 muß nun leider ohne runde Jahreszahl auskommen, und Glasgow im kommenden Jahr (die dritte Station) erst recht. Da kann man sich schon mal fragen, ob der erhebliche Aufwand gerechtfertigt ist. Die Antwort fällt nicht leicht.
Jedenfalls hat der Duisburger Hafen bis zum 13. September eine Attraktion zusätzlich zu bieten, und der Eintritt ist frei. Allerdings bleiben Zweifel, ob die komplizierte Besichtigungsprozedur mit großer Nachfrage, vor allem an Wochenenden, fertig wird. Und ob die alles in allem doch recht komplexe Technik bis zum Ende durchhält und kein Vandalismusopfer wird. Aber man soll nicht unken. Halten wir es mit Kaiser Franz und schau’n wir mal.
Noch ein paar Fakten: Die Künstlerinnen und Künstler, die sich „Nomanslanding“ ausgedacht haben, sind Robyn Backen (Australien), Andre Dekker (Niederlande), Graham Eatough (Großbritannien), Nigel Helyer und Jennifer Turpin (beide Australien).
- Die Adresse ist Duisburg, „Am Eisenbahnbassin“, Autoparkplätze sind rar.
- Geöffnet bis 13. September tgl. 13 bis 23 Uhr, Eintritt frei, „wetterfeste Kleidung empfohlen“.
- Mehr Informationen: www.ruhrtriennale.de, www.urbanekuensteruhr.de
Zwei Strophen des Klageliedes, dem Programmzettel entnommen:
Verse 1
We will meet you at the river
We’ll draw closer on the tide
You can hear us in the water
From the shore to the other side
Verse 2
All our lives brought here together
To flow before your eyes
At last on Nomanslanding
Cast off the line untied
Feine Töne, dicke Mauern – Klangkunst in Haus Kemnade

Kemnade_klingt! Wenigstens hier und da. Und ein Logo hat die Klangschau auch. (Foto: Kunstverein Bochum)
Wenn sich das batteriebetriebene Motörchen in Gang setzt, dann lässt es an federndem Stab eine kleine Holzkugel über die Stahlsaiten des alten Klaviers tanzen, und einige unbeholfene Töne entstehen. Der Motor wird elektronisch ein- und ausgeschaltet, entsprechend schwingen oder schweigen die Saiten. Fünf historische Klaviere im Raum sind mit einer solchen technischen Installation ausgestattet, so dass, wenn im Wechsel sie erklingen, der Eindruck von Kommunikation entsteht.
Stephan Froleyks, Jahrgang 1962, der am Niederrhein und in Münster lebt, hat sich diese Klanginstallation ausgedacht, die die Besucher ins Grübeln bringen kann über Klang, Geräusch, Musik, über Signale jenseits der Stille. Zu sehen und zu hören ist sie bis zum 18. Oktober in Haus Kemnade in Hattingen. Acht Künstlerinnen und Künstler präsentieren in Museumsräumen, in denen Musikinstrumente der Sammlung Grumbt ausgestellt sind. Arbeiten unter dem Titel „Kemnade klingt!“.
In den Siebzigern war Kemnade bekennend multikulti
Für den Bochumer Kunstverein als Ausrichter ist dieses Projekt fast schon eine Nummer zu groß. Deshalb preist sein künstlerischer Leiter Reinhard Buskies voller Dankbarkeit die beiden privaten Hauptsponsoren, die Beckumer Marianne-Blumenbecker-Stiftung und die Herdecker Richard-Dörken-Stiftung. Und man erinnert sich, dass es in dem alten Wasserschloss schon oft „geklungen“ hat – seit den frühen 70er-Jahren nämlich, als hier das „Ausländer-Festival“ unvergeßliche multikulturelle Musikmarken setzte.

Der Ruhrsandstein klingt – jedenfalls vor dieser Mauer, für die Denise Ritter einen speziellen Soundtrack geschaffen hat. Der O-Ton dafür kam aus dem Steinbruch Grandi in Herdecke. (Foto: Stadt Hattingen)
Zurück zum Kemnade-Sound von heute, der nun aus dem Museum kommt und entschieden minimalistischer ist als das vielfältige Festivalgeschrammel von einst. Sparsamkeit prägt das Bild, was weniger einem Arte-povera-Konzept als der ökonomischen Notwendigkeit geschuldet zu sein scheint. So müssen in Simone Zauggs Installation „Luegit vo Bärg u Tal“ Aluleitern die Alpen geben. Oben auf ihnen sind Lautsprecher mit Bewegungsmeldern installiert, und wenn diese Bewegung melden, weil ein Ausstellungsbesucher, was ausdrücklich erlaubt ist, eine Leiter erklommen hat, dann erklingt nämliches Volkslied aus der Konserve, gesungen von der Berner Künstlerin (Jahrgang 1968) persönlich. Der Titel, man ahnte es, ist Schweizerdeutsch und lautet übersetzt in etwa „Blick vom Berg ins Tal“. Wenn zeitnah mehrere Leitern erklommen werden, wird der Gesang polyphon. Dann grüßen sich gleichsam die Alpengipfel, und das klingt schön und seidig durch den Raum und ist leider schnell wieder vorbei. Bis der Bewegungsmelder wieder anschlägt.
Vielstimmiges produziert auch Mathilde ter Heijnes Anordnung von Transistorradios. Leise beginnend ballen historische Brandreden verschiedener Politiker sich schließlich zu einem aufwühlenden Crescendo. Man erkennt die Absicht, doch die Optik des Werks enttäuscht, bietet nicht mehr als kümmerliche Gerätschaften und Strippengewirr auf einigen Quadratmetern Museumsboden. Auch wenn dies fraglos eher eine Veranstaltung für die Ohren ist, wäre etwas visuelle Sinnlichkeit nicht zu verachten.
Grillen im Lautsprecher machen Geräusche
In der Arbeit des Wahlberliners Nik Nowak (Jahrgang 1981) sieht man die Klangerzeuger gleich gar nicht. Dabei sind sie zugegen, und originell sind sie zudem. Nowak nämlich fängt – in zugesichert artgerechter Haltung! – typische Geräusche von Grillen ein, die er verstärkt und durch Frequenzbearbeitung für das menschliche Ohr hörbar macht. Die Grillen sitzen derweil unsichtbar in ihrem Terrarium – in einem zackigen, feindselig wirkenden Lautsprecher-Kubus aus schwarzem Schaumstoff.
Torsten Bruch (Jahrgang 1973) zeigt zwei Videoarbeiten, in denen zum einen vier Chinesen „Die Gedanken sind frei“, zum anderen eine Strophe für Strophe wachsende Kombo das Kinderlied „Laurentia“ singen. Das ist lustig und auch hintersinnig, aber nicht unbedingt eine Kunst, die größere Aha-Erlebnisse zeitigt.

Haus Kemnade beherbergt unter anderem die Musikinstrumentensammlung Grumbt. Einige dieser Instrumente erklangen für Tommy Finkes Musikstück. (Foto. Stadt Hattingen)
Schließlich trifft man im Inneren des alten Wasserschlosses auf die Klanginstallation von T.D. Finck von Finkenstein. Er hat, ist zu erfahren, im Haus Klänge alter Instrumente gesammelt, diese im Studio überarbeitet und zu einem recht süffigen Soundtrack mit lockerer Rhythmusunterlage verrührt. Wir erleben also das Werk eines Musikers, und da kann es nicht mehr erstaunen, dass sich hinter dem barocken Namensungetüm der in Bochum recht bekannte Musiker Tommy Finke verbirgt, der ab der kommenden Spielzeit im Dortmunder Schauspielhaus als musikalischer Leiter die Nachfolge Paul Wallfischs antreten wird.
Draußen vor der Burg hat Dodo Schielein, 1968 in München geboren, eine Art Akustik-Parcours geschaffen; „music for ears/Musik für zwei Ohren“ hat er ihn genannt, eine „Handlungsanweisung“ (Untertitel). Die real existierenden Handlungsanweisungen finden sich auf wetterfesten Informationstafeln am Wegesrand, und mit Kemnade hat das nur wenig zu tun. Schielein lehrt die Menschen, sich der akustischen Wahrnehmung ihrer Umwelt bewusst zu werden oder auch sie zu beeinflussen, indem sie beispielsweise die Hände zu Ohrmuscheln formen.
Der Ruhrsandstein klingt
Und schließlich ist da noch Denise Ritter (Jahrgang 1971), die von langen Pausen unterbrochen das alte Kemnader Gemäuer mit einem speziellen Soundtrack beschallt. Ihr geht es um eine intensivere Wahrnehmung von Stein, Gebäude, Naturraum und Umgebung in ihrer engen Bezüglichkeit – und ein wenig auch im Unterschied zu dem, was heutzutage in dem alten Gemäuer geschieht. Der Mix aus Museum, Naherholungsziel, Standesamt, Baudenkmal und Gaststätte scheint ihr eine „kuriose Nutzung“ zu sein, wiewohl alternativlos. Der Sound – im Studio nachbearbeitet – kommt aus dem Steinbruch „Grandi“ in Herdecke, der als einer der letzten noch Ruhrsandstein abbaut – das lokale Material, aus dem auch Kemnade einst errichtet wurde. Wie immer man dies findet: Indem sie den Ausstellungsort akustisch reinszeniert, ist Denise Ritters Arbeit die einzige, die sich dezidiert mit ihm befasst.
Politisch-kritische Valeurs sind bei den ausgestellten Arbeiten nicht sehr ausgeprägt, sieht man einmal von Bruchs „Die Gedanken sind frei“ singenden Chinesen oder Mathilde ter Heijnes gesammelten Reden ab. Eher beschleicht einen wiederholt das Gefühl, es mit etwas blutleeren Fingerübungen zu tun zu haben, mit fein hergebastelten Arbeitsproben. Allerdings haben sparsam ausgeführte, konzeptionelle Arbeiten wie diese es auch besonders schwer, zu bestehen, sind sie doch der Möglichkeit beraubt, Ideenarmut hinter bombastischer Inszenierung zu verstecken. Jedenfalls bleibt der Kemnader Schau das Verdienst, eine tonlose Sammlung von Musikinstrumenten um etliche Töne zu bereichern. Für einige Zeit jedenfalls.
- Haus Kemnade, An der Kemnade 10, 45527 Hattingen
Tel. 02324 – 30268 - Anfahrt: A 43, Abfahrt Witten-Herbede, Richtung Hattingen
- Bushaltestelle: Hattingen, Haus Kemnade [Linie CE31]
- Öffnungszeiten:
Do. – So., 11 – 17 Uhr (Nov. – April)
Do. – So., 12 – 18 Uhr (Mai – Okt.)
An der Schwelle der Moderne: Vor 125 Jahren starb Vincent van Gogh an einem Schuss

Vincent van Gogh: Ein Selbstporträt mit grauem Filzhut von 1887. Das Bild gehört dem van Gogh Museum Amsterdam. Bis 6. September ist es in der Ausstellung „Van Gogh + Munch“ im Munch Museum Oslo zu sehen. Foto: Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
Seine Sonnenblumen, sein Selbstbildnis, seine Sternennacht: Bilder, die ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind. Millionenfach reproduziert, weltbekannt. Vincent van Gogh, der niederländische Pfarrerssohn und exzentrische Außenseiter, gehört heute zu den populärsten Meistern am Beginn der Moderne – und zu den teuersten Malern im internationalen Kunstmarkt.
1987 wurden knapp 40 Millionen Dollar für eines seiner Sonnenblumenbilder gezahlt; drei Jahre später legte ein japanischer Sammler für das „Porträt des Dr. Gachet“ über 82 Millionen Dollar hin. Erst vor drei Wochen wurde bei Christie’s das frühe Aquarell der „Laakmolen“ bei Den Haag von 1882 für 2 Millionen Pfund versteigert.
Van Gogh war nicht zum Maler geboren. Erst mit 27 Jahren, im Herbst 1880, entschied er sich, Stift und Pinsel zu den Werkzeugen zu machen, mit denen er künftig seinen Lebensunterhalt verdienen – und mehr noch, sich selbst ausdrücken wollte. Die nötigen Kenntnisse eignete er sich selbst an. Er kopierte Zeichnungen und Drucke, um zu lernen, genoss gelegentliche Unterweisungen, etwa von seinem Cousin Anton Mauve. Sein Bruder Theo van Gogh kam für seinen Lebensunterhalt auf und erhielt dafür einen großen Teil von Vincents Werken.
Von der Theologie zur Kunst
Die nur 37 Jahre seines Lebens begannen mit einer Kindheit in Brabant, die van Goghs Liebe zur Natur weckten; mit einer schwierigen, mit 15 Jahren beendeten Schulzeit des eigenbrötlerischen Jungen; mit unglücklicher junger Liebe und der Suche nach einem Beruf.
Die Lehre bei einem bedeutenden Kunsthandel ging schief, weil van Gogh als Verkäufer ungeeignet war. In London fühlte er sich einsam, in Paris kapselte er sich ab und beschloss, ein Studium zu beginnen. An seinen Bruder Theo schreibt er: „Ich wäre unglücklich, wenn ich nicht das Evangelium predigen könnte … wenn ich nicht meine ganze Hoffnung und all mein Vertrauen auf Christus gesetzt hätte …“. Doch fand er die Theologie an der Universität einen „unbeschreiblichen Schwindel“, gab das Studieren auf und besuchte ein Laienprediger-Seminar in Brüssel.

Ging für zwei Millionen Pfund bei Christie’s weg: Vincent van Goghs „Laakmolen bei Den Haag“, ein Aquarell aus dem Jahr 1882. Foto: Christie’s
Eingesetzt als Hilfsprediger im Steinkohlerevier bei Mons in Belgien, identifiziert er sich bis hin zu einer bettelarmen Lebensweise stark mit den Arbeitern. Er malt die einfachen Menschen; er verschenkt Lohn, Lebensmittel, Kleider. Wohl auch, weil er radikal an die Ränder der Gesellschaft ging, wurde seine Anstellung nicht verlängert. Die Zurückweisung ist einer der Gründe, warum sich van Gogh vom Christentum abwandte, zeitlebens aber ein religiös und sozial sensibler Mensch geblieben ist.
In Brüssel, unterstützt von Bruder und Eltern, versucht er, sich zum Maler heranzubilden, besucht Museen, beginnt zu zeichnen. Entscheidend für van Goghs künstlerische Entwicklung ist die Begegnung mit der Kunst des Impressionismus im Paris der Jahre 1886 bis 1888. Van Gogh lebt dort bei seinem Bruder Theo und lernt später berühmt gewordene Maler kennen, von Alfred Sisley über Henri Toulouse-Lautrec bis Paul Gauguin.
Der Einfluss japanischer Farbholzschnitte beeinflusst seine Malweise: Er verzichtet auf Körper- und Schlagschatten und trägt die Farben, wie er selbst schreibt, „flach und einfach“ auf. Die japanische Kunst empfindet er aufregend neu: „Ist, was uns die Japaner zeigen, nicht einfach eine wahre Revolution…?“, schreibt er. Die Bilder von Eugène Delacroix bestärken ihn, seine Farbwahl zu ändern: Er verwendet nun kräftige und helle Farben, die sich gegenseitig verstärken.
Diese Einflüsse und sein gereifter persönlicher Stil führten zu der typischen Malweise, die wir heute mit van Gogh verbinden. Im Februar 1888 flieht der Maler aus Paris nach Arles: Psychisch angeschlagen, genervt von den Streitereien der Malerkollegen, strapaziert von der hektischen Großstadt und zermürbt von Absinth-Exzessen versucht er in Südfrankreich, zu sich selbst zu finden. In Arles will er in der Natur reine, intensive Farben finden, wie sie ihn interessieren: die „schönen Gegensätze von Rot und Grün, von Blau und Orange, von Schwefelgelb und Lila“.
Intensive Farben, symbolische Gegenstände
Van Gogh wählt für seine Bilder nicht mehr die natürlichen Farben der Gegenstände oder der Landschaft. Er entwickelt stattdessen für jedes Bild ein Farbschema, mit dem er eine „gute Wirkung“ erzielen will. Die Farben stehen – wie auch Gegenstände im Bild – für eine symbolische Aussage: „Ich habe versucht, mit Rot und Grün die schrecklichen menschlichen Leidenschaften auszudrücken“, schreibt er etwa zu seinem Bild „Das Nachtcafé“ von 1888. Auch seine Malweise ändert sich: Der dicke Farbauftrag macht die Pinselstriche sichtbar, neben die glatt aufgetragenen treten gestrichelte Farben, die van Gogh in Wellen oder rhythmischer Bewegung anordnet. Dass er seine Bilder schnell und ohne zu überlegen gemalt hat, ist eine Legende. Vielen Motiven gingen intensive Studien voraus.

Das van Gogh Museum Amsterdam. Es zeigt ab 25. September die Ausstellung „Munch – van Gogh“. Foto: Rene Gerritsen/van Gogh Museum Amsterdam
Eine der van-Gogh-Legenden ist auch, dass ihn plötzliche Wahnsinn befallen und er sich sogar ein Ohr abgeschnitten habe. Vermutlich hat er sich lediglich im Rausch am Ohr verletzt. Dass van Gogh psychisch angeschlagen war, hat er selbst in den letzten Lebensjahren als zunehmend belastend erlebt.
Im Mai 1889 ließ er sich in der Nervenheilanstalt Saint-Rémy-de-Provence unterbringen, im Mai 1890 zog er nach Auvers, wo er Patient des heute sehr kritisch betrachteten Arztes Dr. Gachet wurde. Dort entstanden in einem Schaffensrausch rund 140 Werke.
Vor 125 Jahren, am 27. Juli 1890, schoss sich Vincent van Gogh wohl selbst eine Kugel in den Körper. Neue Biographen bezweifeln jedoch die Selbstmord-These. Sie ziehen einen Unfall oder sogar eine Tötung durch einen anderen in Betracht. Zwei Tage später starb er an der Verletzung. Entgegen landläufiger Meinung war van Gogh zum Zeitpunkt seines Todes ein im Kreis seiner Kollegen höchst anerkannter Maler.
Das van Gogh Museum Amsterdam würdigt seinen Namensgeber im 125. Todesjahr mit zahlreichen Veranstaltungen. Ab 25. September ist dort die Ausstellung „Munch – van Gogh“ zu sehen, die Ähnlichkeiten zwischen beiden Malern und den Einfluss van Goghs auf die Entwicklung von Edvard Munch thematisiert. Info: http://vangogheurope.eu/event/munch-vangogh/
Dortmunds Meisterwerke bitte länger zeigen!
„Schade, dass Anfang August schon wieder alles vorbei sein soll.“ Das meinte Rolf Pfeiffer Mitte Mai hier in den Revierpassagen, nachdem er die Ausstellung „Meisterwerke im Dortmunder U“ gesehen und beschrieben hatte. Der 9. August wird als letzter Besichtigungstag auf den Plakaten und Handzetteln genannt, und dieser schnelle Schluss wäre wirklich sehr, sehr schade.
Man kann allen kunstliebenden Menschen nur empfehlen, dem Rat von Rolf zu folgen und sich an einem der noch verbleibenden Tage anzusehen, was in den Archiven der Dortmunder Museen an Schätzen schlief, die nun nur noch zwei Wochen zu sehen sein werden – wenn sich die Ausstellungsmacher nicht doch noch entschließen, den Bildern und Skulpturen von Beckmann, Macke, Liebermann und vielen anderen einen Nachschlag zu gewähren.
Noch interessanter wäre allerdings die Idee, den Gedanken einer ständigen „Dortmunder Gemäldegalerie“ wieder aufzugreifen, der im vorigen Jahrhundert zum Grundstein dieser ungewöhnlich reichhaltigen Sammlung führte. Die für die jetzige Ausstellung umgebaute 6. Etage im „U“-Turm zeigt sehr schön, wie ein solches Projekt einmal aussehen könnte.
Ausstellung „Digitale Folklore“: Damals, als das Internet noch eine freie Spielwiese war
Es gibt Gelegenheiten, bei denen man sich ziemlich alt vorkommt, noch besser gesagt: ziemlich weit ab vom (allerdings auch schon längst verflossenen) Hauptstrom des Geschehens.
Mir war jetzt ein solches Gefühl beim Rundgang durch die Dortmunder Ausstellung „Digitale Folklore“ beschieden. Ohne kundige Führung hätte ich wenig von den technischen Details verstanden. Somit war’s auch gleichsam fremdes kulturelles Gelände.
Dabei ging es gar nicht mal um stürmische Avantgarde, sondern um eine neuere Form der Nostalgie, nämlich um wehmütige Rückblicke auf die Zeiten, als es im Internet gemeinhin noch recht wildwüchsig vonstatten ging; als Hunderttausende, zumeist fröhlich dilettierend, vor allem im angloamerikanischen Sprachraum die Möglichkeiten des noch so jungen Mediums erprobten und vielfach erstaunliche Kreativität freisetzten – auch beim freimütig frechen Abkupfern einzelner Elemente aus anderen Webseiten.
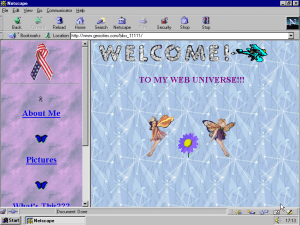
„Willkommen“ (Bild: One Terabyte of Kilobyte Age Archive, Ausstellung „Digitale Folklore“ – © Geocities Research Institute)
Wir sprechen von den 1990er Jahren, als geringste Mittel und Speicherplätze für den Online-Auftritt ausreichen mussten. Gerade diese Beschränkungen stachelten offenbar den Erfindergeist an.
Zoomen wir uns noch etwas genauer heran: Die Netzkünstler und Kuratoren Olia Lialina und Dragan Espenschied richten für den HMKV (Hartware MedienKunstVerein) im „Dortmunder U“ eine Schau über jene Relikte aus, die sie vom einstigen Online-Dienst Geocities gerade noch rechtzeitig durch eilige Kopien haben retten können.
Es sind immerhin 28 Millionen Dateien, die sich nunmehr im „One Terabyte of Kilobyte Age Archive“ befinden und allmählich mühsam gesichtet und erschlossen werden. Manche Zeichen und Abläufe kann man mit heutigen Browsern gar nicht mehr darstellen. Also gilt es zu rekonstruieren und zu restaurieren, wie nur je bei herkömmlichen Kunstwerken.
Es ist ein Forschungsprojekt sondergleichen, bei dem Selbstdarstellungen jeder Couleur, zahllose Fan- und Haustierseiten sowie alle denkbaren Formen der Populär- und Alltagskultur in Betracht kommen. Übrigens: Auch niedliche Katzenbildchen zählten in den frühen Jahren schon zum festen Bestand des Mediums. Auch hierbei ist Facebook nur die Nachhut.
Nach den markanten Kostproben in der Ausstellung kann man es sich lebhaft vorstellen: Da sind wohl diverse Sumpfgelände dilettantischer Hervorbringungen zu durchwaten, aber auch manche Schätze zu heben. Mit der Zeit dürfte sich zudem eine Typologie für die Frühzeit des Internets herauskristallisieren, die bei künftigen Forschungen als Leitseil dienen könnte.

Universale Schöpfung (Bild: One Terabyte of Kilobyte Age Archive, Ausstellung „Digitale Folklore – © Geocities Research Institute)
1994 war die nach Art einer Stadt in Zonen und Viertel gegliederte Geocities-Plattform begründet worden. War man beispielsweise Verschwörungstheoretiker, so siedelte man seine Seite in „Area 51“ an, Fantasy-Freunde gingen hingegen in den Zauberwald.
Doch ach! Die große Freiheit währte nicht allzu lange. 1999 wurde Geocities zum Schrecken vieler Online-Aktivisten an den Konzern Yahoo verkauft, der die virtuelle Globalstadt vernachlässigte und sie 2009 endgültig in den Orkus der Web-Historie stieß, vulgo: löschte. Man darf getrost von einem barbarischen Akt sprechen, bei dem Millionen handgemachter Webseiten verschwunden sind. Von wegen, das Netz vergisst nicht…
Das digitale Archiv, auf dem die flimmernde Ausstellung ausschnitthaft basiert, enthält Überbleibsel von genau 381.934 Geocities-Homepages. In jenen Gründungsjahren nach 1994 war alles noch Experiment. Es gab keine vorgefertigten Tools zum Erstellen von Webauftritten. Die Nutzer bastelten freihändig an neuen Möglichkeiten. Und während heute soziale Netzwerke das Tun und Lassen ihrer User in vorgezeichnete Bahnen lenken, herrschte damals vergleichsweise technische und ästhetische Anarchie.
Besonders die Frames (Rahmensystem, mit dem sich mehrere Dokumente auf eine Seite stellen ließen) und noch mehr die animierten GIFs (Bildformat, dem mehr oder minder trickreich sekundenkurze Bewegung eingehaucht wurde) erwiesen sich als ideale Ausdrucksformen der Pioniertage. Die Ausstellung zeigt frappierende Beispiele dieser Endlosschleifchen, die sich summarisch kaum hinreichend beschreiben lassen. Eines der berühmtesten GIFs war der Peeman (Pinkelmann), der stracks über den Bildschirm lief und hernach auf alles urinierte, was der Netzgemeinde suspekt oder verhasst war – ob nun auf Hitler, die als öde geltende Automarke Ford, Britney Spears oder Geocities selbst…
Es muss eine schier unendlich erscheinende Spielwiese der Improvisationen gewesen sein, die sich da den Amateuren auftat. Allein die immense Vielfalt der „Baustellenschilder“ („under construction“), der Ankündigungen (demnächst neuer Webauftritt) und Abschiede (Website aufgegeben) lässt ahnen, dass hier eine lebendige Netz-Kultur geradezu wucherte, die inzwischen wie weggewischt und fast schon wieder vergessen ist. Insofern kann man wahrhaftig von Medienarchäologie sprechen, die zu restaurieren, zu interpretieren und mit künstlerischen Mitteln anzuverwandeln sucht, was noch übrig ist.
Zusehends haben dann Profis die Definitionsmacht über das Internet an sich gezogen. Sie machten sich im Netz und in Büchern über misslungene Webseiten der Amateure lustig und prangerten sie als Peinlichkeiten an. Heute sehen wir, wofür sie den Boden bereitet haben.
„Digitale Folklore“. 25. Juli bis 27. September beim Hartware MedienKunstVerein, 3. Ebene im „Dortmunder U“ (Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund). Geöffnet Di/Mi/Sa/So 11-18, Do/Fr 11-20 Uhr. Eintritt frei. Öffentliche Führungen sonn- und feiertags 16 Uhr, donnerstags 18 Uhr. www.hmkv.de
Niedliche Brutalität: Joep van Lieshouts Ruhrtriennale-Dorf in Bochum

Die »BarRectum« ist Teil der begehbaren Installation vor der Jahrhunderthalle. © Atelier Van Lieshout
Wer die Rotterdamer Crew um Joep van Lieshout engagiert, weiß nicht nur, was ihn erwartet. Er erwartet auch genau das. Das Atelier Van Lieshout inszeniert das Gelände vor der Bochumer Jahrhunderthalle – und bedient die Hoffnungen der Ruhrtriennale nach einem crazy-verstörenden Festivalzentrum.
Der Künstler bestückt das Areal mit seinen organisch-verrätselten Systemen: Auf die Besucher warten unter anderem ein überdimensionierter Darmausgang, eine Werkstatt für Waffen und Bomben und eine Guerilla-Farm. »The Good, the Bad and the Ugly«, so der Titel des Gesamtkunstwerks.
Riesiger Enddarm und Waffenwerkstatt
Wie muss man sich das vorstellen? So: eine Halle, 15 mal 18 Meter groß und sechs Meter hoch. Sie heißt »Refektorium« und ist Bühne und Bistro zugleich. Die Halle ist der Kern. Wie ein Zahnrad gruppieren sich verschiedene, ebenfalls begehbare Kunstwerke drum herum. Zum Beispiel die »BarRectum« in Gestalt eines Enddarms, oder das »Farmhouse«, ein mobiler Bauernhof. Daran angegliedert: die »Werkstatt für Waffen und Bomben« sowie eine »Werkstatt für Medizin und Alkohol«. Die Installation soll, so das Konzept, das Festivalzentrum zu einer potentiell autarken Gemeinschaft machen.
Auf dem Flachdach des Refektoriums in der Mitte thront der »Domestikator«: eine Skulptur, höher als das Gebäude, auf dem es steht. Auch sie ist begehbar und rätselhaft. Auf der Skizze erinnert sie an einen Roboter, der drohend vor einer Folterbank steht. »Für Proben, Aufführungen, religiöse Menschenopfer«, sagt der Künstler und grinst, »fast wie ein Tempel, um das Tabu zu feiern«.
Die Nutzung ist nicht festgelegt
Wie all die Kunstwerke vor der Jahrhunderthalle Bochum genau genutzt werden, ist nicht festgelegt – die Offenheit gehört zum Konzept. Für van Lieshout passt das exakt zum Ruhrtriennale-Motto »Seid umschlungen«: »Wer als Besucher kommt, weiß erst einmal nicht, ob das für Flüchtlinge ist, etwas Feierliches – oder doch bedrohlich.«
Ein Festival-Dorf wie aus einer Trash-Science-Fiction – wer denkt sich so etwas aus?
Atelier van Lieshout sei ein »interdisziplinär arbeitendes niederländisches Künstlerkollektiv«, ist in der Wikipedia zu lesen. »Wir sind kein Kollektiv, keine Hippie-Kommune«, stellt Sprecherin Rookje Meijerink dann gleich zu Beginn des Atelier-Rundgangs fest. Das hat man sich allerdings schon gedacht: Die Atelier Van Lieshout-Webseite ist eine Show des Namen gebenden Künstlers Joep van Lieshout; außer ihm ist von keinem anderen Künstler die Rede.
Besuch in Rotterdamer Atelier
Im Atelier selbst herrscht die Betriebsamkeit eines mittelständischen Handwerksbetriebs. Ein Mittag Mitte März mitten im Industriegebiet am Rotterdamer Hafen. Die etwa 15-köpfige Crew sitzt an einem langen Holztisch in der Atelier-Kantine, auf dem Tisch Schüsseln mit Salat, Fladenbrot, Kichererbsenbälle – es gibt Falafel. Einige Mitarbeiter sind mit Farbe bespritzt, andere tragen Overall.
Jeder hier ist auf ein anderes Handwerk spezialisiert, auf die Arbeit mit Holz, Metall, Fiberglas oder Stein. An der rechten Wand der Kantine ist eine der Arbeiten von Atelier van Lieshout ausgestellt: Das metergroße 3D-Modell eines erigierten Penis samt Hoden, versehen mit einer Art Pump-Apparatur. Wer ihn beim Essen nicht im Blick haben will, muss sich eben auf die rechte Seite setzen. Aber die Vermengung von Arbeit und Pause scheint nicht das Problem zu sein: Direkt nach dem Essen schaut man sich in der Kantine noch gemeinsam einen Film an, zur Inspiration.
Fiberglas als Zaubermaterial
Währenddessen ein schneller Rundgang durchs Atelier. Hier die Holz-, dort die Metallwerkstatt, hinten der Bereich, in dem mit Fiberglas gearbeitet wird, jenem Kunststoff, mit dem Joep van Lieshout in den 1980er Jahren rasend schnell bekannt wurde. Damals war das Material in der Kunst noch exotisch. Van Lieshout verliebte sich sofort: »Ein Zaubermaterial«, sagt er, »sehr stark und wetterfest. Alles wirkt nahtlos, wie aus einem Guss. Und alle Farben sind möglich – ich liebe Farbe!».
Was van Lieshout mit diesem und anderem Material macht, erschließt sich selten auf den ersten Blick. Seine Arbeiten changieren zwischen Kunst, Architektur und Design. Häufig wirken sie zunächst vertraut und gefällig, man nimmt die poppigen Farben wahr und das glatte, geschmeidige Material – bis man genauer hinsieht. Häufig sind es menschliche, tierische, organische Teile, oft verschmelzen Natur und Apparatur in einer Mischung aus Niedlichkeit und Brutalität. Viele der Arbeiten haben soziale Funktion, wie auch bei der Ruhrtriennale: Dort sollen van Lieshouts Werke aus einem unbelebten Vorplatz ein pulsierendes Festivalzentrum machen.
An den Grenzen des Machbaren
Körper sind Systeme für den 51-Jährigen. Wie sie und andere geschlossene Systeme funktionieren, das interessiert ihn. Er testet Grenzen aus, auch Grenzen des Machbaren. Da ist zum Beispiel »Blast Furnace«, eine riesige Arbeit zum Verschwinden der Industrie, die eine komplette Halle des Ateliers füllt. Sie besteht aus einem sorgfältig nach technischen Zeichnungen zusammengelöteten Hochofen. Anstatt zu verbrauchen und zu produzieren, wird der Hochofen in der Installation zur Wohnung umfunktioniert, erhält Küche, Wohn- und Schlafzimmer. Oder da ist der »Power Hammer« (Maschinenhammer), übermannshoch und gefertigt aus rosa Fiberglas – ein pastellfarbenes Denkmal für die Schwerindustrie, wie eine Versöhnung zwischen Mensch und Maschine.
Graues Kriegsgefühl im Ruhrgebiet
Auch das in Bochum geplante Festivalzentrum ist so ein System, ein Organismus, der erst im öffentlichen Raum zu leben beginnt. Drei Jahre lang wird die Installation während der Ruhrtriennale-Zeit zu sehen, zu begehen und zu bespielen sein. »Es werden Leute kommen, die das Theater lieben, aber auch Spaziergänger ohne Kunst-Hintergrund«, sagt van Lieshout, »das gefällt mir. Meine Arbeit bietet jedem etwas.«
Viele seiner Werke stehen im öffentlichen Raum, überall auf der Welt. Auch in Bochum hat Atelier van Lieshout bereits gearbeitet, im Kulturhauptstadtjahr 2010 installierte er das »Motel Bochum« im Niemandsland an der A 40. Er kennt die Region und mag sie, auch dank seiner Oma aus Moers. »Wegen ihr war ich öfters im Ruhrgebiet, und meine erste Erinnerung an Deutschland ist: überall Grau. Eine Art Kriegsgefühl.« Heute liebe er die Industriekultur und Urbanität, und dennoch: »Das graue Kriegsgefühl spüre ich noch immer.« Wo könnte »The Good, the Bad and the Ugly« besser hinpassen als in diese Stadt der Kontraste?
Neues aus dem Fegefeuer: „Die 7 Todsünden“ im Kloster Dalheim
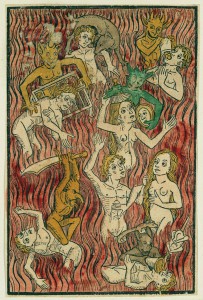
Was dem Sünder im Fegefeuer droht, zeigt dieser Holzschnitt aus dem 15. Jahrhundert. Der Geizhals schluckt Gold, den Zornigen trifft das Schwert, und die Wollüstige beißt eine Schlange. Foto: Kunsthaus Zürich
Sie haben die Ausstellung »Die 7 Todsünden« im Kloster Dalheim noch nicht gesehen? Da haben Sie etwas verpasst. Aber nur kein Neid: Überwinden Sie die Trägheit, gehen Sie einfach hin!
Kleine Augen und ein eckiges Kinn, auch die Nase zeigt spitz nach oben. So sieht er aus, der Neid. Dagegen die Habgier: Eine Hakennase prangt unter Schlitzaugen, die Mundwinkel sind nach unten gezogen. Die Schweizer Künstlerin Eva Aeppli formte die »Physiognomie der Laster« an Bronze-Köpfen. Sie sind die letzte Station vor dem Ausgang im LWL-Landesmuseum Kloster Dalheim in Lichtenau. Da haben die Besucher bereits 1700 Jahre Kulturgeschichte der Laster und Sünden hinter sich. »Die 7 Todsünden« ist die erste museale Beschäftigung mit dem Thema.
Sie beginnt schon im Klostergarten. Dort begrüßt ein Ortsschild den Eintretenden: »Bundesligastadt Paderborn«. Man wundert sich, bis man den von einem Ast hängenden roten Sandsack mit der Aufschrift »Zorn« wahrnimmt, und das Schild an der Rosskastanie, das den unschuldigen Baum als »geizigen Giganten« schmäht. Schließlich sei er wegen seiner kurzlebigen Blütenpracht und der ungenießbaren Früchte ein »Symbol barocker Verkommenheit«. Ob das stolze Ortsschild also für Hochmut steht?
Die Exponate im Garten deuten schon an, was während des Rundgangs immer wieder aufblitzt: Die so genannten Todsünden sind so tödlich gar nicht mehr. Allzu oft in der Kulturgeschichte wurden sie instrumentalisiert oder zumindest umgewertet. Was vorgestern noch tabu war, war gestern gesellschaftlicher Konsens – und wird heute wieder kritisch gesehen.
Gleich zu Beginn schreitet man durch das »Portal der sieben Sünden«, das uns »abholt«: Fotografische Alltagsszenen beweisen, wie die großen Laster sich heute manifestieren. Ein Selfie steht für den Hochmut, der schimpfende Autofahrer für den Zorn. Dazu allgegenwärtige Sprüche aus der Werbung: »Heute ein König!«, »Geiz ist geil!», «Der Duft, der Frauen provoziert.« Heute darf kokettiert werden mit den vermeintlichen Sünden. Sie klingen offenbar noch in uns nach, haben aber längst ihren Schrecken verloren. Das war einmal anders.
Eremitisch in der Wüste lebende Mönche waren es, die im 4. Jahrhundert zunächst acht »Hauptlasten« ausmachten, die den Asketen in Versuchung führen könnten – die Traurigkeit gehörte noch mit dazu. Davon zeugt das älteste Ausstellungsstück, eine beschriebene Keramikscherbe. Papst Gregor machte Ende des 6. Jahrhunderts den Hochmut als Wurzel alles Bösen aus und leitete sieben Kardinalsünden daraus ab. Seitdem gehörten sie fest zur katholischen Morallehre.

Diese Herzdamen gewähren tiefe Einblicke in die Doppelmoral der frühen Adenauerzeit. Spielkarten wie diese durften in den 1950er Jahren nur unter der Ladentheke gehandelt werden. Foto: Wirtschaftswundermuseum, Jörg Bohn
Das Gros der Objekte in diesem ersten Ausstellungsraum stammt allerdings aus dem Spätmittelalter, der Blütezeit der Lehre von den Lastern. Der Kanon der sieben Todsünden wurde populär über Predigten (in der Ausstellung ist ein Ausschnitt zu hören) und durch das Sakrament der Beichte (symbolisiert durch einen Beichtstuhl) aber auch über Abbildungen, Altarbilder oder anderen Kirchenschmuck.
Über die Kirchen gelangten die magischen Sieben in die weltliche Literatur und Kunst, etwa in Peter Dells holzgeschnitzte Statuetten, die die Sünden im frühen 16. Jahrhundert als Frauengestalten zeigen. Aus jener Zeit stammt auch das wohl skurrilste Stück: der gläserne Dildo einer Äbtissin aus dem Damenstift Herford. Unsterbliche, bis heute beliebte Heldenfiguren aus dem Spätmittelalter sind die personifizierte Sünde selbst, etwa Don Juan, die Mann gewordene zornige Wollust. Auch viele Märchenfiguren stehen für eine Sünde: die Frau des Fischers für Völlerei bzw. Maßlosigkeit, die Stiefmütter von Schneewittchen und Aschenputtel für Neid, Pechmarie für Trägheit.
Im Barock dann die erste Umwertung einer Sünde: Völlerei und Verschwendung galten (auch der Kirche) plötzlich als Statussymbole. Schuld war die Kirchenspaltung: Der Barock ist die sinnliche Antwort auf das nüchterne Erscheinungsbild des Protestantismus. Einen Raum weiter wird man sich daran erinnern angesichts der Fotos überladener Büffets und gedankenlosen Genießens in den 1950er Jahren: Nach den Entbehrungen des Krieges hatte man schließlich Nachholbedarf und fand am Schlemmen nichts Schlimmes. Das ist heute, im Zeitalter der Selbstoptimierung und Körperdisziplin, wiederum anders.
Mit der Industrialisierung begann die Beschleunigung des Lebens: Müßiggang konnte die erstarkende Wirtschaft nun wirklich nicht gebrauchen. Dabei war mit der Sünde der »Trägheit« ursprünglich gar nicht nur Faulheit gemeint, sondern Trägheit des Herzens, die Gleichgültigkeit z.B. gegenüber anderen Menschen, ausgedrückt etwa in dem biblischen Gleichnis vom barmherzigen Samariter.
Vielschichtig wird es in dem Teil der Schau, die die Zeit des Nationalsozialismus betrachtet: Die Nazis instrumentalisierten die Sünden geschickt, um ihre Gegner zu diffamieren (die geizigen oder habgierigen Juden) und nutzten die Popularität des Todsünden-Konzepts, um eigene Werte zu propagieren: »Die einzige Sünde heißt Feigheit«, hieß es auf einem Propagandaplakat. Der große Globus aus Adolf Hitlers »Führerbau« in München zeigt das Einstichloch eines Bajonetts, vermutlich von einem alliierten Soldaten – gleichermaßen ein Symbol für Hochmut und Zorn.
Nach dem Krieg machte die sexuelle Revolution Wollust salonfähig, wovon u.a. Ausschnitte aus Oswalt-Kolle-Videos zeugen. Rudi Dutschkes Lederjacke und seine Karteikarten stehen für den Zorn der 1968er. Wie dreidimensionale Mind-Maps hängen beleuchtete Schautafeln für jede Sünde im letzten Raum, zur Wut gibt es die Assoziationen »Wutbürger«, die Figur des »Hulk«, Anti-Stressbälle.
Am Ende kann man dann selbst eigene Gedanken zum Thema an die Wand heften. »Die einzige Sünde ist«, schrieb jemand, »definieren zu wollen, was eine Sünde ist.« Lektion gelernt.
»Die 7 Todsünden« im LWL-Landesmuseum für Klosterkultur in Lichtenau-Dalheim; bis 1. November 2015; Tel. 05292/ 93 190; Katalog: Ardey Verlag, Münster, 29,90 Euro.
„Malerei als Poesie“: Miró-Ausstellung in Düsseldorf
Frau, Vogel, Stern: Diese Motive bilden die Konstanten im Werk des spanischen Malers Joan Miró. Im Laufe seines Künstlerlebens (1893-1983) sind sie in seinen Gemälden immer wieder zu finden.
Doch zeigt die aktuelle Ausstellung in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf (zu sehen bis zum 27. September), wie Miró sich in seinen verschiedenen Schaffensperioden immer wieder neu erfand: Seien es seine Themen, seine Materialien oder seine Farbgebung. Die Zeit spiegelt sich in seinem Werk, mag es vordergründig auch so kindlich daherkommen. Denn es waren beileibe keine friedlichen Zeiten in diesem 20. Jahrhundert, das von zwei Weltkriegen und der spanischen Diktatur unter Franco geprägt war.
Außerdem legt die Ausstellung den Schwerpunkt auf Mirós Beziehung zur Poesie. Denn eigentlich malte er Gedichte. So spielt die Schrift als poetische Zeile oder als grafisches Zeichensystem eine entscheidende Rolle in seinem Werk. In der „Schlange des Aberglaubens“ beispielsweise: Schon vom Format her ist das Bild ein Spruchband, das sich an der Wand entlang schlängelt. Wie eine steinzeitliche Bilderschrift wirken die bunten Hieroglyphen, die nicht ohne Hintersinn auf die Ängste des modernen Menschen anspielen.
Nicht zuletzt zeigt die Schau verschiedene Künstlerbücher, die Miró gemeinsam mit seinen Dichterfreunden wie Paul Éluard, André Breton u.a. geschaffen hat. Joan Miró war ein passionierter Leser: So hat die Kunstsammlung in die Mitte des ersten Saals sozusagen seine Bibliothek nachgebaut und mit Titeln ausgestattet, die Miró selbst besaß. Wer möchte, kann sich in einem Ledersessel niederlassen und ein wenig schmökern.
Auch als Hörprobe spielt die Dichtung in der Ausstellung eine Rolle. Wie Trockenhauben beim Friseur hängen Lautsprecher vor bestimmten Bildern von der Decke, darunter hört man Poesie, auf Französisch rezitiert. „Une étoile caresse le sein d’une négresse“, so der Titel eines Bild-Gedichts von 1938. Die Textzeile ist in weißer Schrift in die schwarze Leinwand hineingeschrieben. Das Bild ist aber nicht als Illustration eines Gedichts zu verstehen, sondern es ist das Gedicht selbst, ein gemaltes Gedicht.
Surrealismus, Kubismus, Fauvismus – an all diesen Strömungen hatte Miró Anteil und man kann sie in seinem Werk entdecken. In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts kam er als junger Mann aus Barcelona nach Paris und taucht tief in die Kunstszene ein. Am liebsten traf er sich mit Literaten aber auch Picasso bewunderte er. Im spanischen Pavillon der Weltausstellung 1937 in Paris stellte Miró neben Picassos „Guernica“ sein Gemälde „Der Schnitter“ aus, das später leider verloren gegangen ist.
Der zweite Saal zeigt Mirós Aufbruch ins Großformat, inspiriert von der 68er Bewegung: Sein Stil wird bewegter, wilder, man spürt den Furor in den Bildern. Die kindliche Schreibschrift weicht einer zeittypischen Druckschrift, auf einem Gemälde lässt sich „Mao“ entziffern. Am Ende des Rundgangs leuchten die Bilder in knalligem Orange; Frau, Vogel, Stern – diese Motive kann der Besucher hier wieder entdecken. So bleibt Miró sich treu, auch in der Veränderung.
Weitere Informationen:
www.kunstsammlung.de
Chancen am Borsigplatz: Der soziale Ertrag des Bierbrauens und andere Aktionen
Bei „Public Residence: Die Chance“, einem künstlerischen Experiment in der Dortmunder Nordstadt, ging es um kulturelle Teilhabe und soziale Kreativität. Das Projekt endete im Mai, soll aber nachwirken. Gastautorin Isabelle Reiff, selbst Mitglied im eingetragenen Verein „Borsig11“, zieht eine Bilanz aus Veranstaltersicht:
„Das ist zynisch, dass Sie das hier machen!“ So begann ein längeres Streitgespräch, das der Künstler Frank Bölter mit einem Politiker der Linken auf dem Kleinen Borsigplatz führte. Anlass dazu bot eine eigenwillige Kunstaktion im Rahmen von „Public Residence: Die Chance“. Das Projekt basiert auf einer Kunstwährung, die an die Quartiersbewohner ausgegeben wird und echte Euros wert ist. Der Geldwert kann sich aber nur in einem gemeinschaftlichen Projekt entfalten.
Diese Bedingung hatten vorher die geldgebende Montag Stiftung und der austragende Verein „Borsig11“ gesetzt. Frank Bölter war also darauf angewiesen, bei den Nachbarn ganz verschiedener Façon und Herkunft den gemeinsamen Nenner zu finden. Und welcher war es dann? Die Liebe zum Bier!

Resultat einer speziellen Kunstaktion unter Anleitung von Frank Bölter: Selbstgebrautes vom Borsigplatz. (Foto: Frank Bölter)
Selber Bier zu brauen ist im Fahrwasser der US-amerikanischen Craft-Beer-Bewegung regelrecht zu uns herübergeschwappt: Immer mehr Menschen fangen hierzulande an, in ihrer Freizeit Bier zu brauen – in der Garage, im Kabuff oder Gartenhaus. Frank Bölter veranstaltete diese Arbeit open air im öffentlichen Raum und zwar an einem Lieblings-Treffpunkt höchst passionierter Biertrinker.
„Hinter jedem einzelnen, der hier den ganzen Tag rumsitzt und säuft, stecken Suchtkrankenakten, kaputte Familiengeschichten, gescheiterte Laufbahnen und Offenbarungseide. Und jetzt kommen Sie und wollen denen zeigen, wie man selber Bier braut!“, beschwerte sich der Lokalpolitiker, während Bölter damit zu tun hatte, Kastanien-Blätter aus dem Sud zu fischen, weil es an diesem Tag wieder so stürmte.
Während der Politiker sich echauffierte, als sei sonst niemand zugegen, mischten an dem Stunden währenden Brauvorgang nicht nur Leute mit, die den Kleinen Borsigplatz zu ihrer zweiten Heimat erkoren haben. Auch Nachbarn, eine angehende Diplom-Braumeisterin und Neugierige rebelten, schroteten und rührten.
Später tauchte noch Kurti auf: Im Knast habe er siebeneinhalb Jahre lang selbst immer Bier gebraut. Das Rezept könne er beim nächsten Mal mitbringen. Gerhard hatte in weiser Voraussicht Malzmyrrhe dabei. Er rühmte sich einer Zusatzausbildung zum Biersommelier. Peter packte nach Ablass des Suds wortlos den übriggebliebenen Brauteig ein und kehrte später unverhofft mit daraus gebackenen Brötchen zurück.
Für Bölter war es ein Etappenziel, „Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, die sich sonst eher aus dem Weg gehen“. Mehr noch „gewinnt man beim Selberbrauen ein Stück weit die an die Sucht abgegebene Verantwortung für die eigene Person durch die gewonnene Portion Selbstermächtigung zurück“. Den Satz sollte man zwei Mal lesen. Ob der Politiker Orhan dann anders darüber denkt, den „Alkis“ vom Kleinen Borsigplatz das Bierbrauen beizubringen?
Alle Künstler während des Public-Residence-Jahres waren (wie vorher schon das Projekt „2-3 Straßen“) vor die schwierige Aufgabe gestellt, Menschen zu mobilisieren, die, was ihre erwerbsmäßigen Beteiligungschancen in dieser Gesellschaft angeht, die Hoffnung mehr oder weniger aufgegeben haben. Dass ihre Väter großteils nur wegen der Arbeit hierher zogen, steht auf einem anderen Blatt. Das Quartier um den Borsigplatz ist heute das mit der höchsten (Langzeit-)Arbeitslosigkeit in Dortmund.

Führung durchs Stadtquartier: Matthias Hecht alias Dr. h. c. Wilfurt Loose (vorn), dahinter (mit roter Kappe) Rolf Dennemann. (Foto: Isabelle Reiff)
Geblieben ist das gelernte Malocher-Verständnis von Arbeit: Arbeit kann nicht Spaß machen, ist Frondienst, bei dem ein anderer das Meiste verdient. Bildungslücken, fehlende Sprachkenntnisse, Schicksalsschläge (wozu auch das Wegziehen ganzer Industrien zählt) erschweren die persönliche Neuorientierung. Übrig bleibt das Gefühl, Opfer der Umstände zu sein, eben nicht seines Glückes Schmied.
Tradierte Sozialprogramme verstärken oft noch diese Selbstwahrnehmung. Können künstlerische Ansätze hier neue Perspektiven eröffnen? Auf dieser Überzeugung fußt das Programm der Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft aus Bonn. Insgesamt 200.000 Euro hat sie für den Borsigplatz bereitgestellt: Der Betrag bildet die Basis der „Chancen“-Währung, außerdem wurde aus diesem Topf die Arbeit von sieben Künstlern bezahlt.
Sie kamen auf die Idee, Straßen umzubenennen, Gärten anzulegen, ein Repair-Café zu gründen. Es wurde öffentlich gekocht, getanzt, Theater gespielt. Ein bis vor Kurzem noch leer stehendes Ladenlokal ist jetzt ein beliebter Nachbarschafts-Treff (Oesterholz 103). Fortbestehen soll auch das Geschmacksarchiv, bei dem vergessene Rezepte nachgekocht werden, genau so die Jugend-Theatergruppe Kielhornschule. Einige im Quartier bieten jetzt sogar selbst Workshops an – vom Möbelbau aus Paletten bis zum Meditationskurs.
Aber viele machen auch nicht mit; umso mehr Chancen sind übrig geblieben – also Noten mit echtem Geldwert. Jeder Anwohner hat ein Anrecht auf 100 davon. Ungefähr die Hälfte hat ihre Chancen noch gar nicht ergriffen. Das bedeutet, dass viele, die rund um den Borsigplatz leben, immer noch Gelegenheit haben, sich auf etwas zu einigen, was sie in ihrem Stadtteil verwirklichen und dann gemeinsam mit denen ihnen zustehenden Chancen finanzieren wollen.
Ohne sehr viel Kommunikation und Überzeugungsarbeit kann das nicht gelingen. Jetzt müssen andere in die Lücke springen, die die Künstler hinterlassen haben. Einer ist immerhin hier geblieben, weil er seit 15 Jahren in der Oesterholzstraße wohnt: Rolf Dennemann hat als freischaffender Künstler, Autor, Regisseur und Schauspieler (und gelegentlicher Mitarbeiter der „Revierpassagen“) vorher schon Partizipationsprojekte angezettelt, in den Kleingärten in der Nordstadt zum Beispiel, auf dem Hauptfriedhof oder in einem Rentnerwohnblock in Essen. “Bitte kein Wasser runterschütten”, hieß eine der Aktionen.
Dennemann ist nicht der gefällige Typ, so einer „will auch nicht andere um Chancen anbetteln“. Dafür weiß er, wie das Quartier am Borsigplatz tickt. Er hat die Veränderungen, denen es unterworfen ist, über viele Jahre beobachtet. Und er kennt die wichtigen Protagonisten im Viertel. Ein klarer Vorteil gegenüber den kurzfristig zugezogenen Künstlern. Und so kommt die von Dennemann initiierte Stadtteilführung „Borsig-VIPs“ so gut an, das man ihm unaufgefordert Chancen zusteckt. Er hat sich dafür aber auch die stadtbekannte Annette Kritzler ins Boot geholt und Matthias Hecht, der alias Dr. h.c. Wilfurt Loose den Quartiersforscher zum Allerbesten gibt. Dennemann ist daher weiter auf „Spurensuche“, sammelt Geschichten und Erinnerungen von Anwohnern und deckt en passant die geheimen Berühmtheiten im Viertel auf.
Wenn die stadtbekannte Kritzler diese ehrenvollen Namen bei ihrer Führung sonor verortet und Loose das auch noch akademisch untermauert, kommt man kaum umhin, zu glauben, dass die östliche Nordstadt in Wirklichkeit voller öffentlichkeitsscheuer Stars steckt. Wahrscheinlich sind sogar noch längst nicht alle aufgespürt. Drum: Wer ungeahnte Anekdoten, verschollene Dokumente oder sonstige Quartiersgeheimnisse auf Lager hat, sollte Dennemann was erzählen. – Vielleicht ist der Borsigplatz in ein paar Jahren – weit über seine Bedeutung für den BVB hinaus – ein Stadtteil mit vielen Mythen und Legenden.
Die Kunst, den Kern zu treffen: Zum Tod des Karikaturisten Bernd Gutzeit

So haben ihn noch manche Kolleg(inn)en in Erinnerung: Bernd Gutzeit an seinem WR-Schreibtisch. Jetzt (August 2019) erhielt das Dortmunder Institut für Zeitungsforschung fast 1500 Original-Karikaturen aus seinem Nachlass (siehe nachträglichen Kommentar zu diesem Beitrag). (Foto: Bodo Goeke)
Ein Nachruf auf den Künstler und Karikaturisten Bernd Gutzeit, verfasst von Gastautorin Ilka Heiner, der langjährigen Leiterin der WR-Lokalredaktion Schwerte:
Politische Karikaturen zeichnete er seit seinen frühen Studienjahren, fast 30 Jahre lang hat er seine Kommentare für die Seite 2 der Westfälischen Rundschau (WR) mit Zeichenfeder und Pinsel festgehalten. Jetzt ist Bernd Gutzeit zwei Tage nach seinem 79. Geburtstag nach langer Krankheit in seiner Wahlheimat Schwerte gestorben.
Seine Karikaturen fügten sich in der Erkenntnis, dass sich die Welt mit keinem Federstrich in Ordnung bringen lässt. Frontal angreifend, listig spottend, skurrilen Hintersinn ausstrahlend verfolgten sie stets das Ziel, den Kern zu treffen.
In seiner aktiven Zeit wurden Bernd Gutzeits Zeitungszeichnungen häufig nachgedruckt, von deutschen, aber auch von ausländischen Blättern, die ihren Lesern diese spezielle Sicht eines deutschen Künstlers auf sein eigenes Land, aber auch auf die Welt zur Kenntnis bringen wollten. Bernd Gutzeit war einer der letzten festangestellten politischen Karikaturisten, die es im bundesdeutschen Blätterwald noch gab.
„Der Künstler“ wurde er liebevoll von seinen Kollegen genannt und das wies auf das zweite – vielleicht das eigentliche? – Leben des Karikaturisten hin, in Bildern, Skulpturen und Objekten, in experimenteller Musik oder theaterähnlichen Inszenierungen seine Fantasie fliegen zu lassen.
Nicht das Endprodukt hatte der Maler, Zeichner und Bildhauer im Visier, sondern den Prozess. Auch war es ihm immer ein besonderes Anliegen, Menschen mit seinen zeichnerischen und bildhauerischen Operationen aus ihrer Eindimensioniertheit hinaus auf den Weg zu bringen: „…um die Augenblicke zu erhaschen, durch die man den Kopf hebt – und vielleicht mit Staunen wieder so ein Stückchen Leben entdeckt“, wie das der Wortgewandte anlässlich einer Vernissage einmal selbst formuliert hat.
Seine Karikaturen, aber auch seine Malerei, Grafik und Skulpturen wurden in zahlreichen Ausstellungen, unter anderem im Schwerter Kunstverein und im Ruhrtalmuseum, gewürdigt.
Bernd Gutzeit, 1936 in Dortmund geboren, stammte aus einer musisch-künstlerischen Familie. In Schwerte besuchte er das Friedrich-Bährens-Gymnasium, und noch bevor er an der Werkkunstschule in Dortmund sein erstes Semester absolvierte, reihte er sich in die Phalanx der Kinomaler ein, die damals noch auf großflächigen Transparenten den Inhalt des Films in eindringlichen Bildern und Portraits darstellten. „Da habe ich einen ganz schönen Schuss mitbekommen“, blickte er einst zurück.
Später unterrichtete er musisches Gestalten am Dortmunder Fritz-Henßler-Haus, war als Kunsterzieher tätig und gab als Dozent für Grafik und Grundlehre an der Werkkunstschule Dortmund sein Wissen weiter. In Schwerte hatte Gutzeit mit Ehefrau Anne, selbst Grafikerin, für viele Jahrzehnte seine Heimat gefunden.
______________________________________________________________
(Der Nachruf ist in ähnlicher Form auch in RN und WR erschienen).
Rascher Rückzug, gespenstisch geräuschlos: Dortmunds Museums-Chef Kurt Wettengl geht
Nicht ohne Verwunderung ist zu berichten vom überraschend plötzlichen, äußerlich nahezu gespenstisch geräuschlosen Abschied des Ostwall-Museumschefs im Dortmunder „U“, Prof. Kurt Wettengl.
Gestern verbreitete die Stadt Dortmund die offenbar brandeilige Nachricht, dass Prof. Wettengl (Jahrgang 1954) seine Museumstätigkeit bereits „Mitte Juni“ beenden werde.
Ohne offizielle Verabschiedung
Schon heute war sein letzter Arbeitstag. Laut „Ruhrnachrichten“ soll es nicht einmal eine offizielle Verabschiedung geben. Seltsam genug. Was wohl hinter den Kulissen geschehen ist? Man muss Konflikte vermuten.

Heute war schon sein letzter Arbeitstag im Dortmunder „U“: Prof. Kurt Wettengl. (Foto: Stadt Dortmund)
Wettengl wollte zu dem Vorgang und zu seinen Dortmunder Jahren (fast 100 kleine und größere Ausstellungen an beiden Standorten seit 2005) nicht Stellung nehmen. Wobei man sagen muss, dass er ohnehin kein leichter Interview-Partner war. Im Gegenteil: Es war ungemein schwierig, ihm konkrete Aussagen abzugewinnen. Er wirkte stets übervorsichtig, wenn er sich zu Fragen äußerte, die über die Kunsthistorie hinausreichten.
Künftig kein passender Posten vorhanden?
Die Umstände seiner Demission klingen jedenfalls nach überstürztem Aufbruch, ja beinahe nach Flucht. Die Stadt befindet sich seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Persönlichkeit für eine Art „Generalintendanz“ des Dortmunder „U“. Diesem Mann oder dieser Frau wäre Wettengl wohl formal unterstellt gewesen, wenn er denn seine Arbeit fortgesetzt hätte. Oder es wäre gar kein passender Platz mehr für ihn geblieben. Derlei Fährnisse hat jemand gegen Ende seines aktiven Berufslebens doch nicht mehr nötig…
Erbärmlich geringer Etat
Ein weiterer Grund für den raschen Rückzug Kurt Wettengls dürfte der beschämend geringe Ausstellungsetat des Hauses gewesen sein – noch dazu verknüpft mit überzogenen Erwartungen aus dem politischen Raum, was die Besucherzahlen angeht. Apropos: Ausgerechnet die letzte Ausstellung, die Wettengl in Dortmund kuratiert hat („Arche Noah“ – über Mensch und Tier in der Kunst), verbuchte in dieser Hinsicht immerhin einen Achtungserfolg. Nach dieser Genugtuung, so darf man annehmen, fällt Wettengl der Abschied vielleicht etwas leichter. Seinen kunstgeschichtlichen Lehrauftrag an der TU Dortmund wird er übrigens weiterhin wahrnehmen.
Wie sinnvoll war der Umzug ins „U“?
Wettengl suchte aus der finanziellen Schräglage eine Tugend zu machen, indem er den Blick – immer wieder anders fokussiert – auf die Dortmunder Sammlungsbestände richtete. Eigenbesitz ist nun mal am günstigsten vorzuzeigen. Es war jedoch klar, dass ein Schwerpunkt wie Fluxus-Kunst nicht die Massen anziehen würde. Ein bleibendes Verdienst Wettengls ist sicherlich, mit seinem Team den Umzug des Kunstmuseums vom Dortmunder Ostwall ins Dortmunder „U“ bewältigt zu haben.
Allerdings kann man sich rückblickend fragen, ob der dauerhaft und folgenreich kostspielige Umzug in den ehemaligen Brauereiturm überhaupt sinnvoll gewesen ist. Doch diese Entscheidung hat gewiss nicht Kurt Wettengl zu verantworten.
Überstürzt, weil politisch gewollt, musste partout noch im Kulturhaupstadt-Jahr 2010 dieser neue Ort der Kunst und der sogenannten „Kreativwirtschaft“ eröffnet werden. Um es mal zurückhaltend zu formulieren: Nicht durchweg konnte man dabei von sorgfältiger, vorausschauender Planung sprechen.
„Im großen Stil“: Abgründiger Kunstmarkt-Krimi in Wien und Berlin
Der Schlaf der Vernunft, das wusste schon Goya, gebiert Ungeheuer. Zum Beispiel einen Kunstmarkt, der seltsame Blüten treibt. Da tummeln sich dubiose Händler, notorische Fälscher und gewissenlose Gefälligkeitsgutachter, dreiste Diebe, großspurige Mäzene und milliardenschwere Sammler.
Wo Kunst zur Geldmaschine wird, sind auch Gier und Neid nicht weit. Das müssen auch die Wiener Inspektorin Anna Habel und der Berliner Kommissar Thomas Bernhardt erfahren. Nachdem fast zeitgleich ein Kunstgutachter in Wien und ein Kunsthändler in Berlin ermordet werden, versinken die beiden Polizisten in einem Sumpf aus Hass und Intrige, Geldgier und Rachsucht. Denn wo „Im großen Stil“ Kunst verkauft wird, wird nicht nur gefälscht und geklaut, gelogen und betrogen, sondern auch blutig gemordet.
„Im großen Stil“ ist der vierte Fall für das vom Krimi-Duo Bielefeld & Hartlieb erfundene Polizei-Gespann Habel & Bernhardt, das auf wundersame Weise immer wieder zusammen arbeiten und kompliziert verschlungene Mordfälle in kulturellen Gefilden aufklären muss. Mal geht es um den Literaturzirkus („Auf der Strecke“), mal ums Theatermilieu („Nach dem Applaus“), mal um noblen Wein („Bis zur Neige“). Jetzt ist der kriminelle Kunstmarkt an der Reihe.
Wohin die hyperaktive Habel in Wien und der mufflige Bernhardt in Berlin auch kommen, überall begegnen ihnen neue Rätsel: Sind die Bilder, die sich in der Villa des toten Kunsthändlers finden, echt oder falsch? Und welche von den Gutachten, die der ermordete Kunstexperte verfasst hat, sind nichts als Lug und Trug?
Draußen ist der schönste Frühling, und sowohl der melancholische Zyniker Thomas Bernhardt als auch die zum sympathischen Chaos neigende Anna Habel würden gern ihren Gefühlen freien Lauf lassen, sich frisch verlieben, das Leben genießen. Doch diese Momente des kleinen privaten Glücks bleiben rar. Zu vertrackt und zu verschachtelt sind all die Fährten, Fäden und Finten, die entwirrt und entschlüsselt werden müssen. Was haben der ehemalige Stasi-Mann und die eitle Schauspiel-Diva, der süffisant lächelnde Mäzen, die von muskulösen Personenschützern umringte Kunsthändlerin und der charmante Bilder-Sammler mit den Morden zu tun?
Wer befürchtet haben könnte, die literarisch-kriminalistische Berlin-Wien-Verbindung nutze sich allmählich ab, wird angenehm überrascht. Mit ironischem Lokalkolorit, psychologischem Feingefühl und tiefem Einblick in Abgründe des Kunstbetriebs werden die (ehemaligen Literaturkritiker) Claus-Ulrich Bielefeld und Petra Hartlieb immer besser. Ihnen auf der abgründig-mörderischen Schnitzeljagd zu folgen, ist einfach ein großer, anspielungsreicher, spannender Spaß.
Bielefeld & Hartlieb: „Im großen Stil.“ Diogenes Verlag, Zürich, 416 Seiten, 14,90 Euro.
Ruhrfestspiele: Klatschen wie Bolle – Brambach liest Bukowski, die Zucchini-Sistaz swingen
Frankreich ist, wie bekannt, in diesem Jahr der kulturell-regionale Schwerpunkt der Ruhrfestspiele. Viel Französisches allerorten im Spielplan, aber doch nicht nur. In den Randbereichen des üppigen Programms blüht einiges, was mit dem Schwerpunkt auch beim besten Willen nichts zu tun hat.
Zwei Veranstaltungen, beide auf kleinerer Bühne, interessierten besonders. Wenn man nun wiederum zwischen ihnen etwas Gemeinsames suchte, so könnte man vielleicht sagen, daß sie beide in US-amerikanischer Kultur wurzeln. Aber das ist schon etwas gequält herbeigezaubert. Schauen wir also mal – erst auf Herrn Brambach nebst Gattin Christine Sommer, sodann auf die Zucchini-Sistaz.

„Roter Mercedes“ – Martin Brambach, Christine Sommer, Matthes Fechner (von links) Foto: Ruhrfestspiele/Peter Kallwitz
Brambach und Bukowski
Martin Brambach also, den man vom Fernsehen kennt und vielleicht auch aus früheren Zeiten vom Bochumer Schauspielhaus, ist ab und zu mit einem Bukowski-Abend unterwegs. Allzu oft aber wohl nicht, auch intensivste Internet-Recherchen förderten nicht mehr zu Tage als einen vorhergegangenen Auftritt 2014 in Dorsten. Jetzt war das Paar Brambach/Sommer in Begleitung des Gitarristen Matthes Fechner im FRinge-Zelt bei den Ruhrfestspielen zu erleben.
Die Veranstaltung hinterließ, sagen wir es zurückhaltend, einen uneinheitlichen Eindruck. Grandios waren die ausgesuchten Bukowski-Texte, gleichnishafte, auf den Punkt durchformulierte graue Alltagsgeschichten über Suff, Sex und Gewalt, durchlebt und durchlitten von alternden Losern beiderlei Geschlechts. Da eskaliert die Eifersuchtsnummer im abendlichen Ehebett zum mörderischen Finale mit der Zweiundzwanziger, da vergewaltigen und ermorden Einbrecher eine junge Frau, der sie zufällig im Haus begegnen, und mit dem prügelnden Ehemann, der aus den ehelichen Gewaltexzessen so etwas wie Selbstbewußtsein zieht, hat man fast Mitleid.
Ein bißchen wie in Hoppers Bildern
Doch obwohl die Brutalität vieler Szenen schwer erträglich ist und Bukowski auch in den schlimmsten Momenten nicht wegsieht, wohnt ihnen atmosphärisch so etwas wie ein unbeteiligtes Schweben inne, eine Globalsicht auf Männer und Frauen und die Einsamkeit und den Gang der Welt. Man fühlt sich an Hoppers trostlose Bilder erinnert, im Glauben an die Unveränderlichkeit der Verhältnisse sind Maler und Autor sich recht nah.
Auch Martin Brambach ist ganz nahe dran an den Elendsbildern aus der Bukowski-Welt. Meistens liest er den Text nur vor, doch immer wieder auch wechselt er – für einen einzelnen Ausruf oder auch für eine ganze dramatische Passage – ins Schauspielen. Dann gibt er nicht nur, nein, dann ist er der verspannte, gehemmte, gehetzte amerikanische Mittelstandsbürger, immer um Fassung bemüht und immer dazu verurteilt, in diesem Streben zu scheitern. Wenn er die Beherrschung verliert, schreit und um sich schlägt und sich im nächsten wieder einzufangen versucht, voll von schlechtem Gewissen über den selbstverschuldeten Kontrollverlust, dann ist das im Kleinen ganz großes Schauspieler-Theater.
Angeschrägter Charakter
Martin Brambach gehört zur kleinen Schar der etwas angeschrägten Charaktere, die in ihren Interpretationen meisterlich zwischen persönlichen Eigenheiten und dem Streben, äußerlicher Erwartung zu genügen, switchen können, ohne (scheinbar) beides in Einklang zu bringen. Ihr sperriger Charakter steht ihnen sozusagen immer im Weg, wenn sie eigentlich kühl, beherrscht und hundertprozentig auftreten wollen; Künstler wie Wolfgang Michael oder Michael Maertens sind Brambachs Brüderchen im Geiste.
Womit das Beste über diesen Abend allerdings auch gesagt wäre. Preisen wollen wir noch Christine Sommer, die nicht nur beim Lesen mit verteilten Rollen eine gute Figur macht, sondern auch als (mitunter männlicher) Dialogpartner.
Nicht preisen wollen wir den Gitarristen, dessen fingerpickendes Spiel zwar handwerklich untadelig ist, dessen Interpretationen gleichwohl sehr viel Gewolltheit innewohnt. Zur Schärfung der Authentizität rauht Matthes Fechner sich die Stimme, doch zum lebensgegerbten Blues-Barden wird er so noch lange nicht. Relativ kurze Textvorträge wechseln ab mit relativ langen „bluesigen“ Klassikern aus dem American Songbook, in Sonderheit der 60er- und 70er-Jahre.
Dem, der gekommen war, um Brambachs Kunst zu schauen, mißfiel die Menge der Musik und die Art ihres Vortrags, die ihren Tiefpunkt übrigens mit der Darbietung von Janis Joplins „Red Mercedes“ als Klatschmarsch erreichte. Oh Lord, – klatsch – won’t you buy me – klatsch – a Mercedes-Benz – klatsch. Mit dunklem Humor könnte man fragen, was wohl Herr Bukowski von einem solchen Liederabend gehalten hätte.
Gute Musikerinnen
Die Zucchini-Sistaz nun, die mit Brambach/Bukowski, wie gesagt, nichts zu tun haben, sind Teil des kurzweilig-juvenilen „Fringe“-Programmes, treten aber in der Sparkasse Recklinghausen auf, wo das Publikum zu einem beachtlichen Teil der Generation Silberlocke, 50 plus X, entstammt. Das ist an sich auch nicht verwunderlich, wenn man ein Programm à la Andrew-Sisters erwartet, denn die hatten ihre großen Erfolge vor 70, 80 Jahren (Kinder, wie die Zeit vergeht!).
In Kürze: die Drei, die jetzt in Münster wohnen, sind erstaunlich gute Musikerinnen und haben, wenn man einmal so sagen darf, eine Menge Swing und Backbeat im Blut. Sinje Schnittker bläst ins Blech, Jule Balandat, übrigens aus Dortmund gebürtig, zupft am Kontrabaß und macht die Conference, Tina Werzinger weiß mit Banjo und Gitarre umzugehen, und singen können sie alle drei, auch dreistimmig. Und Andrew Sisters könnten sie auch, ganz bestimmt.
Deutsche Texte
Leider aber bevorzugen die drei Zucchini-Frauen in ihren zucchinigrünen Nostalgiekleidern deutsche Texte und Inhalte, die in Sonderheit die Westfalenmetropole Münster preisen. Die Texte sind nicht völlig schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Es wird nicht ganz klar, warum gerade sie zum Vortrag gelangen, die schlüssigen Pointen fehlen.
Befremdlich ist weiterhin, daß das Publikum heftigen Mitmach-Appellen ausgesetzt ist, befremdlicher aber noch, daß es ihnen so freudig nachkommt. Begeistert rufen sie den Damen auf Nachfrage ihre Wohnorte zu, imitieren kaputte Autohupen und klatschen wie Bolle den Rhythmus mit.
Na gut, man will ja nicht den Miesepeter spielen. Wenn’s den Leuten gefällt… Trotzdem hätten die Sistaz doch auch ein paar Klassiker aus den Vierzigern singen können, „Rum & Coca Cola“ zum Beispiel, oder „Bei mir bis du schön“. Aber das ist zugegeben schon keine Kritik mehr, sondern nur noch Ausdruck persönlicher Enttäuschung, wozu die Damen nichts können. Jedenfalls: Wenn sie sich noch einmal künstlerisch umorientieren sollten – mehr Musik, weniger Ringelpiez – ginge ich gerne wieder hin.
So viel, für den Moment, vom munteren Rand der Ruhrfestspiele. Selbstverständlich gibt es hier noch viel mehr zu hören und zu sehen, man kann ja nicht überall sein. Bei nächsten Mal geht es wieder ins große Haus, zu Yasmina Reza und „Bella Figura“.
Ein Traum wird wahr – Dortmunder U zeigt Meisterwerke aus den Magazinen
Weiße Wände, freie Durchgänge und sinnhafte Sichtachsen; gut diffundiertes Oberlicht für die Gemälde und schummerige Kabinette für empfindliche Papierarbeiten – besser läßt sich Kunst kaum präsentieren, zumal dann, wenn es sich ausschließlich um flache Bilder und wohnraumkompatible Skulpturen handelt.
Die Räume haben Themen und Nummern, das Publikum wandert gleichsam von den magisch-mystischen Sehnsuchtsmotiven eines Caspar David Friedrich durch insgesamt 18 Abteilungen bis zum harten, illusionslosen Spätexpressionismus eines Max Beckmann. Und da eine „Zwangsführung“ nicht installiert wurde, sind Abweichungen in alle anderen Richtungen jederzeit möglich. Eine, warum sollte man es nicht jetzt schon sagen, schöne, kluge Präsentation.
Zu sehen ist die Ausstellungen mit dem Titel „Meisterwerke im Dortmunder U“ vom 14. Mai bis zum 9. Oktober allda in der 6. Etage, auf der so genannten Sonderausstellungsfläche. Die Werke, und das ist schon etwas Besonderes, stammen überwiegend aus den Beständen der beiden Dortmunder Kunstmuseen, also des Museums für Kunst und Kulturgeschichte (MuKuK) an der Hansastraße und des Ostwall-Museums (MO), das seit längerem leider nicht mehr am Ostwall residiert, sondern in der vierten und fünften Etage des Dortmunder U.
Traditionelle Werke im MuKuK, klassische Moderne im Ostwallmuseum: „Die Trennung der Sammlungen um 1900 herum ist wenig sinnvoll“, urteilt Gerhard Langemeyer, der diese Ausstellung als „Gastkurator“ zu verantworten hat und von dem natürlich jeder weiß, daß er in Dortmund auch Museumsdirektor, Kulturdezernent und Oberbürgermeister war.
Jetzt ist Langemeyer Pensionär, mehr oder weniger, und hat sich sozusagen endlich den Traum erfüllt, die Ausstellung zu machen, die er immer schon machen wollte. Beziehungsweise: In einer Ausstellung exemplarisch vorzuführen, wie es aussehen könnte, wenn der Museumsentwicklungsplan der Stadt Wirklichkeit geworden wäre, der seit 2002 existiert und unter anderem die Zusammenführung der beiden städtischen Sammlungen vorsieht.
Warum also nur ausnahmsweise zusammen hängt, was (nicht nur aus kunsthistorischer Sicht) durchaus zusammengehört – das hat auch mit der etwas schmerzhaften Entstehungsgeschichte des Dortmunder U zu tun, die ja noch immer nicht beendet ist. Wir erinnern uns: Rechtzeitig zum Kulturhauptstadtjahr 2010 mußte das ehemalige Sudhaus der Union-Brauerei mit seinem das Stadtbild prägenden leuchtenden U auf der Spitze in seiner neuen Funktion als Kultur- und Ausstellungsgebäude fertig werden – als Attraktion und Wahrzeichen ebenso wie als förderungswürdiges Kulturhauptstadtprojekt.
Die Förderung mit Landesmitteln jedoch war an Auflagen gebunden wie die, hier nicht ausschließlich ein größeres Kunstmuseum entstehen zu lassen sondern ein Kulturzentrum mit vielfältigen Aktivitäten. So zogen unter anderem die Hochschulen der Stadt auf „ihren“ Etagen ein, ohne indes in der Folge durch bemerkenswerte Aktivitäten zu glänzen. Das Ostwall-Museum wurde auf zwei Etagen gequetscht, die Sonderfläche muß Sonderfläche bleiben (und wurde in den vergangenen Jahren mit einigen Themenausstellungen bespielt).
Für eine Dauerpräsentation der Dortmunder Kunstschätze bedeuteten diese Planungen auf absehbare Zeit das Aus. Zwar war in den Folgejahren das eine oder andere Magazin-Werk im MuKuK zu sehen, werden bedeutende Werke immer wieder einmal an andere Häuser ausgeliehen, doch eine Dauerpräsentation von rund 150 Werken, die jetzt in der Sonderschau zu sehen sind, muß in der Regel Wunschtraum bleiben. Wenigstens jedoch kann Gerhard Langemeyer nun vorführen, wie er sich das damals dachte; und hoffen, daß der künftige, noch unbekannte Intendant des U die Idee der Bestände-Ausstellung in irgendeiner Form aufgreifen wird. (Und selbstverständlich kann der neue Intendant auch weiblichen Geschlechts sein.)
So gilt’s, das vorerst endliche Vergnügen zu preisen. 150 Gemälde, Skulpturen und Grafiken sind, wie gesagt, insgesamt in der Ausstellung zu sehen. 16 Gemälde stammen aus Dortmunder Privatbesitz, zudem eine Druckgraphik-Mappe der Künstlervereinigung „Die Brücke“ mit 16 Blättern. Allein 47 Arbeiten, um auch diese Zahl noch zu nennen, stammen aus dem Depot des Ostwall-Museums.
Caspar David Friedrichs „Junotempel von Agrigent“ – man erinnert sich dunkel an einen Streit vor etlichen Jahren, ob dieser Tempel denn nun er echte sei – ist fraglos eins der kostbarsten Bilder aus dem Dortmunder Bestand und empfängt das Publikum.
In den ersten Abteilungen geht es noch heftig romantisch zu, träumen sich die Künstlerseelen in Gegenden, wo man auch heute noch gern Urlaub machen würde. Junge Männer singen zur Laute, junge Damen lauschen hingebungsvoll; doch steht auch die Portraitkunst in Blüte. Begüterte Bürger lassen sich malen, die Perfektion der Ausführung ist viele Male frappierend, beispielhaft in Friedrich Wilhelm von Schadows „Bildnis einer Dame“ von 1815.
Der Portraitist Theobald von Oer, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts wirkte, erhält breiten Raum; das thematische Spektrum erfährt Weitungen durch Genrebilder (wie Franz Kels’ „Westfälische Bauernhochzeit“, 1856) und herzige Allegorien, Andreas Achenbach als herausragender Vertreter der Düsseldorfer Schule zieht furchtlos hinaus in winterliche nordische Gebirge (1838). Und so fort. Keineswegs ist die vormoderne Malerei langweilig.
Gleichwohl fasziniert die Wandlung in die Moderne, wie sie im Oeuvre des Wahl-Hageners Christian Rohlfs besonders deutlich wird. Mit Hilfe einiger Leihgaben des Hagener Osthaus-Museums kann man ihn in Dortmund prominent präsentieren. Wir sehen einen fast noch klassisch zu nennenden Rückenakt (1879), erfahren von pointillistischen Versuchen im Bild „Das Ruhrtal bei Herdecke“ (um 1902), begegnen dem wütenden Expressionisten (Clownsgespräch, 1912 u.a.) und meinen Vorstufen des Informellen wahrzunehmen, wenn Christian Rohlfs 1937 eine „Glühende Gewitterwolke“ malt.

Caspar David Friedrichs „Junotempel von Agrigent“ (entstanden nach 1826) zählt zu den prominentesten Dortmunder Bildern. (Foto: Madeleine Annette Albrecht/Dortmunder U)
Und schwuppdiwupp sind wir schon bei den Modernen, bei Emil Nolde, Paula Modersohn-Becker, Macke, Jawlensky, Kirchner, Mueller, Schmidt-Rottluff und all den anderen. Brücke und Blauer Reiter, Liebermann und Berliner Sezessionisten, Lehmbrucks kantige junge Männer und schließlich auch, fast ist man ein wenig dankbar dafür, Ernst Barlachs tief entspannter, selbstvergessener Singender von 1928.
Natürlich hängt und steht hier noch viel mehr Kunst, als hier Erwähnung finden kann. Die Dortmunder Meisterwerke-Schau fühlt sich an wie die Versammlung vieler guter Bekannter, die zwar alle einzeln begrüßt sein wollen, deren Anwesenheit jedoch an sich schon eine Freude ist.
Die zu preisende Ausstellungsarchitektur, die dem von der letzten Ausstellung her noch als eng und verwinkelt erinnerten Räumlichkeiten Luft und Transparenz verleiht, mußte übrigens aufwendig hergestellt werden. Alte Wände wurden eingerissen, neue erstellt, U-Architekt Eckhardt Gerber selbst plante diesen Umbau. Von all den Mühen sieht man nichts, es ist hier oben jetzt gerade so, wie es auch sein müßte. Schade, daß Anfang August schon wieder alles vorbei sein soll.
- „Meisterwerke im Dortmunder U – Caspar David Friedrich bis Max Beckmann“
- 14. Mai bis 9. August 2015
- www.dortmunder-u.de
- Ein empfehlenswerter Katalog entstand in Zusammenarbeit mit der Dortmunder Galerie Utermann und kostet 19,90 Euro.
Acht Städte zwischen Rhein und Ruhr zeigen zeitgenössische Kunst aus China
Warum, beginnen wir den Aufsatz ruhig ein bißchen ketzerisch, gibt der Bundeswirtschaftsminister wohl den Schirmherrn für diese Ausstellung? Ein Grund könnte sein, die Chinesen zu erfreuen und so die Wirtschaftsbeziehungen zu ihnen zu verbessern.

„Big Woman and Little Man“ (2012) von Zhang-Xiaogang hängt jetzt in der Küppersmühle (Foto: Zhang Xiaogang/china8)
Das Interesse der Wirtschaft an diesem Ausstellungsprojekt ist jedenfalls erheblich, unter anderem sponsern Duisburger Hafen und Düsseldorfer Flughafen, Evonik Industries und Deutsche Bahn und last not least, qua Stiftungsauftrag dazu veranlaßt, die Brost-Stiftung.
Veranstalter der Mammutausstellung ist die Stiftung für Kunst und Kultur e.V. in Bonn, der Walter Smerling vorsteht, der in Personalunion auch die Duisburger Küppersmühle leitet. Der Eigenanteil der beteiligten Städte am Ausstellungsprojekt hingegen ist übersichtlich. „Das Projekt haben wir privat gehoben“, gibt Smerling selbstbewußt zu Protokoll.

„The Night of Time Vivarium“ (2015) von Sun Xun ist im Hagener Osthaus-Museum zu sehen. (Foto: Sun Xun/china8)
Rund 500 Werke von 120 Künstlern
Nun ist es keineswegs verwerflich, wenn die Wirtschaft die Kunst fördert, und sei es die chinesische. Zu sehen also gibt es – viel. Rund 500 Werke von rund 120 Künstlerinnen und Künstlern in neun Museen in acht Städten. Küppersmühle und Lehmbruck in Duisburg, NRW-Forum in Düsseldorf, Folkwang in Essen, Kunsthalle Recklinghausen, Skulpturenmuseum Glaskasten Marl, Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr, Osthaus Museum Hagen und Kunstmuseum Gelsenkirchen.
Düsseldorf zeigt einen üppigen Querschnitt, die anderen Häuser haben sich spezialisiert. So widmet Essen sich der Fotografie, Recklinghausen setzt einen Schwerpunkt bei besonders jungen Positionen, die Küppersmühle bietet exklusive Vergleichsmöglichkeiten und präsentiert zu den zehn chinesischen Künstlern, „deren Entwicklung wir seit 20 Jahren intensiv verfolgen“, in etwa zeitgleich entstandene Werke der Herren Baselitz, Beuys, Götz, Kiefer, Lüpertz, Richter, Schultze und so fort. Sie entstammen der Sammlung Ströher, die Küppersmühle hat da einiges zu bieten.

„Sidewalk“ (2014) – ein Tintenstrahlausdruck von Alfred Ko, jetzt in Essen zu bewundern. (Foto: Alfred Ko/china8)
Pioniertaten in Duisburg
Seit er das Haus im Duisburger Innenhafen leitet, hat Walter Smerling sich in Bezug auf chinesische Kunst zahlreiche Verdienste erworben. Lange Zeit war er der einzige, der in einem Museum (Galeristen waren da häufig schon weiter) chinesische Zeitgenossen breit präsentierte.
Wie es scheint, war Smerling unter den Museumsleuten auch die treibende Kraft für „China 8“, doch beansprucht er den Lorbeer nicht für sich allein. Dankbar erinnert er sich an einen Besuch bei Ferdinand Ullrich in der Recklinghäuser Kunsthalle vor etwa zwei Jahren, wo dieser „Kunst aus Beijing“ aus der Sammlung eines niederländischen Industriellen präsentierte, der ungenannt bleiben wollte. Viele der Werke hatte auch Smerling schon gezeigt, als sie noch nicht Teil jener niederländischen Sammlung waren. Da wurde gleiches Interesse spürbar; und so reiften erste Pläne für die China-Schau.

„Appearance of Crosses“ (2007-10) von Ding Yi – jetzt in der Duisburger Küppersmühle. (Foto: Ding Yi/china8)
Warum kommt Ai Wei Wei nicht?
Kenner der Materie mögen mich geißeln, aber ich kann nicht behaupten, auch nur einen der präsentierten Künstler zu kennen – sicherlich eine Mißlichkeit, die durch ausgiebigen Ausstellungsbesuch behoben werden könnte.
Der einzige wirklich weltberühmte chinesische Künstler wäre wohl Ai Wei Wei, doch der wollte nicht teilnehmen. Man hatte ihn, beteuert Smerling, angefragt, und für diese Anfrage hatte es von den chinesischen Behörden grünes Licht gegeben.
Ai Wei Wei kommt angeblich also aufgrund einer persönlichen Entscheidung nicht. Was ihn so entscheiden ließ und ob Repression im Spiel war, unterliegt der Spekulation. Allerdings, so Smerling, sei ja auch bekannt, daß der regimekritische Künstler Gruppenausstellungen nicht liebe.
Was nun aber gibt es zu sehen? Viel Öl auf Leinwand, viel Acryl auf Leinwand, einige Videos, einige Installationen, gut plazierbares Skulpturales. Von den Formaten her fühlt man sich oft an die Art Cologne erinnert, wo (ganz anders als im zeitgenössischen deutschen Ausstellungsbetrieb mit seinen immer komplizierteren konzeptionellen Verschwurbelungen) solide Flachware dominiert, gut ins Wohnzimmer zu hängen. Gleiches gilt sinngemäß für die prominent präsentierbaren Skulpturen und Blumenvasen. Keine Experimente – allerdings sollten die Wohnzimmerwände eine gewisse Größe haben, um die ausladende Chinakunst aufzunehmen.

Die Skulptur „Bang!“ (2002) von Xiang Jing ist 162 cm hoch und steht jetzt im Duisburger Lehmbruck-Museum. (Foto: Xiang Jing/china8)
China-Pop adé
Und inhaltlich? Verglichen mit den poppig bunten, oft auf sehr eindringliche Art gesellschaftskritischen Werken, die in den vergangenen Jahrzehnten bei uns zu sehen waren, ist die „China 8“-Kunst bedenklicher, bedeckter, kontemplativer, in gewisser Weise europäischer. Die Farbigkeit wirkt häufig zurückgenommen, gesellschaftskritische Botschaften sind zwar wahrzunehmen, dominieren aber nicht. Doch selbstverständlich sind Globalbewertungen wie diese immer schwierig. Das Schaffen von 120 Künstlerpersönlichkeiten läßt sich nicht seriös auf einen Punkt bringen.
Die Karte des Reviers, die die teilnehmenden Museen verzeichnet, weist im Raum Dortmund lediglich eine weiße Fläche auf. Wollten die nicht, konnten die nicht? Ferdinand Ullrich, der nicht nur die Recklinghäuser Kunsthalle leitet, sondern auch den Ruhr-Kunstmuseen vorsteht, in deren Kontext das China-Projekt entstand, kann es nicht erklären, findet den Umstand aber auch nicht sehr bedeutsam. Für ihn wurde andersherum ein Schuh daraus. Immerhin nehmen acht Häuser teil, das bewertet er als großen Erfolg.

Das „New China Series Car No. 1“ (2009) von Ma Jun steht im Hagener Osthaus-Museum und ist aus Porzellan (Foto: Ma Jun/china8)
Daß die Dortmunder nicht mitgezogen haben, mag der personellen Situation geschuldet sein, dem Machtvakuum auf der Leitungsebene im Dortmunder „U“. Bekanntlich sucht man einen „Intendanten“ für das kompliziert strukturierte Haus, der wohl auch den derzeitigen Museumschef Kurt Wettengl beerben wird. Doch sind das einstweilen noch Spekulationen.
Weil aber Spekulieren so viel Freude bereitet, spekuliere ich noch etwas weiter und wage die nicht allzu mutige Prognose, daß die Menge der chinesischen Kunst auf dem Kunstmarkt in den nächsten Jahren enorm wachsen wird. Es gibt viel gelangweiltes Geld, das man im Austausch mit den Kunstwerken einsammeln kann. Zur Freude der Chinesen und ihrer deutschen Partner.
- „China8“
- 15. Mai bis 13. September 2015.
- Neun Ausstellungen in acht Häusern
- Duisburg: Küppersmühle und Lehmbruck-Museum
- Düsseldorf: NRW-Forum in Düsseldorf
- Essen: Folkwang-Museum
- Recklinghausen: Kunsthalle
- Marl: Skulpturenmuseum Glaskasten
- Mülheim/Ruhr: Kunstmuseum
- Hagen: Osthaus-Museum
- Gelsenkirchen: Kunstmuseum
- Öffnungszeiten und Eintrittspreise sind unterschiedlich.
- An den Wochenenden verkehren kostenlose Bus-Shuttles zwischen den Museen.
- Für die ganze Schau wird auch ein Kombi-Ticket zum Preis von 18 Euro (erm. 10 Euro) angeboten, mit dem in der gesamten Laufzeit des Projekts jede Ausstellung einmal besichtigt werden kann.
„Green City“: Kunstschau erkundet die versehrte Stadtlandschaft des Ruhrgebiets
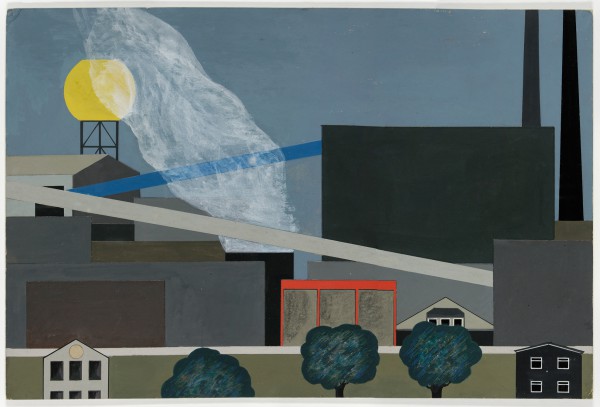
Werner Graeff: „Skizzen zur farbigen Gestaltung des Ruhrlandes“, 1952 (© Museum Wiesbaden, Schenkung Ursula Graeff-Hirsch, Foto Museum Wiesbaden)
Ja, wo leben wir denn? Hier im Revier. Und was heißt das? Um mal ein doch recht treffliches Wortspiel zu wagen: Wir leben in einer ebenso extrem vernetzten wie verletzten Stadtlandschaft.
Eine Kunstausstellung in Oberhausen geht nun den Spuren nach, welche sich in die (allemal manipulierte, künstlich her- und zugerichtete) Landschaft eingezeichnet oder auch eingegraben haben. Diese Strukturen definieren geradezu das Ruhrgebiet. Wo sie sich verflüchtigen, hört auch das Ruhrgebiet auf. Nur ganz allmählich ändert sich diese Zuschreibung, allem Strukturwandel zum Trotz.
„Green City“ heißt die Schau in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen. Gemeint ist keine einzelne Kommune, sondern die weitläufige, in sich schier grenzenlose Stadtlandschaft der Region. Hat der Titel seine Berechtigung? Tatsächlich ist Grün im Ruhrgebiet in vielerlei Bestands- und Schwundstufen vorhanden. An manchen Ecken und Enden erobern sich Pflanzen sogar ihr Revier zurück. So begünstigt hie und da industrieller Verfall ein neues, ganz anderes Wachstum.
Apropos „Green City“ und Ökologie: Schirmherr der Ausstellung ist NRW-Umweltminister Johannes Remmel, und der ist nun mal bei den „Grünen“. Nebenbei: Als Sponsor tritt u.a. eine Stiftung des Energieriesen RWE in Erscheinung.

Luftbild von Rita Rohlfing: „moments“, 21. Juni 2014, 2014-2015 (© Rita Rohlfing, VG Bild-Kunst, Bonn 2015)
Es herrscht eine insgesamt recht diffuse Gemengelange – und dieser verwirrende Eindruck teilt sich auch beim Rundgang durch die Ausstellung mit. Klärung darf man wohl nicht verlangen. Das Etikett „Green“ bezieht sich nicht zuletzt auf die Sehnsucht der Menschen nach intakten Naturzusammenhängen. Doch ist es hier nicht selten als Negation oder Ironie zu verstehen, denn „natürlich“ thematisieren etliche Künstler in erster Linie die versehrte Landschaft, deren klaffende Wunden zumal auf Luftbildern erkennbar sind, besonders eindrucksvoll in Rita Rohlfings Serie „moments“ von 2014/15.
Gleich 64 Künstlerinnen und Künstler werden zur Bestandsaufnahme aufgeboten, viele davon noch recht unbekannt. Die Ausstellung, kuratiert von Nina Dunkmann, verficht keine erkennbare These, sie versammelt vielmehr eine Unzahl von gegenwärtigen „Positionen“, wie man es so gängig nennt. Mögliches Motto älterer Lesart: Wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen.

Axel Braun: „Und wer in diesen Bannkreis tritt, wird vom Geist der neuen Zeit ergriffen“ (Detail), 2014 (© Axel Braun)
Das Ruhrgebiet wird – extremer als die meisten anderen Gegenden Deutschlands – durchzogen und zerschnitten, doch eben auch innig verbunden von Straßen, Schienen, Kanälen, Energie-Trassen und Brücken, die sich zu komplexen Netzen summieren. So viele Schneisen, solch ein Geflecht und Dickicht. Somit gerät übrigens schon die Anfahrt nach Oberhausen zur stadtlandschaftlichen Einstimmung. Die Ausstellung wiederum gliedert sich (nicht immer lupenrein) in Kapitel, die z. B. Straßen, Wasserwegen oder Energie gewidmet sind.
Zeitgeschichtlich betrachtet, beginnt der Reigen 1952. Damals, als das rußige Ruhrgebiet Grau in Grau gerade erst wieder erstanden war, setzte der Maler Werner Graeff farbige Akzente in die ansonsten düstere Industriekulisse, als wär’s eine frühe Vision der heute so beliebten „Landmarken“ gewesen.
Über die Gruppe „B 1“, die sich gegen Ende der 1960er Jahre schon im Namen auf die zentrale Strecke des Ruhrgebiets bezog und Stadträume neu zu deuten suchte, und eine Figur wie wie HA Schult, der 1978 eine künstlerische Ruhr-Tour durch die Region unternommen hat, spult die Ausstellung sehr rasch in die heutige Zeit vor.
Gewiss: Da gibt es auch ein paar lässliche oder gar alberne Zugriffe aufs Thema (sehet selbst), doch auch originelle und erhellende Kreationen wie etwa Klaus Dauvens „Putzlappenzeichnungen mit Naturmotiven“, Eva Ketzers transportables und auf schrill-komische Weise falsches Naturidyll „Naherholung“ oder Johannes Jensens frech-fröhliche Ausrufung eines Kompostaates (Kompost-Staates) mit eigener Botschaft, Flagge und allem sonstigen Drum und Dran. Einen poetischen Zugang eröffnet Nikola Dickes Arbeit „Der verborgene Garten“. Und Hendrik Lietmann tauft kurzerhand gleich die ganze Region um: Seine Fotoserie „Das Rohrgebiet“ zeigt das chaotisch wuchernde System der Rohrleitungen rings um Garten- und Kleingarten-Areale.
Stellenweise wird deutlich, wie sich die künstlerische Wahrnehmung des Reviers mittlerweile in verschiedenen Zeitschichten gleichsam abgelagert hat, aber eben auch aufgefrischt werden kann. So reagiert etwa der Künstler Axel Braun explizit auf die anfangs so umstrittenen, monumentalen Landmarken eines Richard Serra („Terminal“ in Bochum, Bramme auf der Schurenbachhalde in Essen-Altenessen), und zwar mit großem Respekt, aber nicht in erstarrender Ehrfurcht, sondern auch mit kritischen Untertönen; wie denn überhaupt das Revier jetzt aus anderen Distanzen und mit anderen Ansprüchen vermessen wird als ehedem.
Selbst Stätten, die man zu kennen meint, wirken im Kontext dieser Ausstellung verfremdet, so dass sich der Blick womöglich weitet. Hier kann man (auf einer imposanten Fotografie von Matthias Koch) noch einmal sehen, wie die heftig umgepflügte Landschaft aussah, nachdem das einstige Hoesch-Stahlwerk verschwunden war und bevor dort der Dortmunder Phoenixsee entstanden ist. Hier kann man auch noch einmal Zustände der brutal schnurgeraden und der renaturierten Emscher vergleichen.
Manch eine dieser Zeit- und Ortsbestimmungen lässt innehalten: Welch ein Wandel liegt da hinter uns! Und was steht noch bevor?
„Green City. Geformte Landschaft – Vernetzte Natur. Das Ruhrgebiet in der Kunst“. Ludwiggalerie Schloss Oberhausen (Konrad-Adenauer-Allee 46). Eröffnung am Samstag, 9. Mai 2015, 19 Uhr. — Bis 13. September 2015, Öffnungszeiten Di bis So 11-18 Uhr. Mo geschlossen, aber Pfingstmontag (25. Mai) geöffnet. Eintritt 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Katalog 29,80 Euro. Reichhaltiges Führungs- und Begleitprogramm. Info-Telefon: 0208/41 249 28. www.ludwiggalerie.de
Recklinghausen: Franzose Daniel Buren verwandelt Ruhrfestspielhaus und Kunsthalle

Das Recklinghäuser Festspielhaus, versehen mit Daniel Burens Farbfolien. (Foto: Kunsthalle Recklinghausen)
Die Kunstausstellung der Ruhrfestspiele überschreitet diesmal das museale Gehege und erfasst die Architektur zweier markanter Gebäude in Recklinghausen: Festspielhaus und Kunsthalle.
Nach je eigenen Prinzipien hat der namhafte französische Künstler Daniel Buren (Jahrgang 1938) die Anmutung beider Bauten mit farbigen Folien grundlegend verändert. Besonders das serielle Raster der gigantischen Festspielhaus-Glaswand erhält durch die Farbrhythmen gänzlich neue Akzente. Festlicher und somit empfänglicher gestimmt, könnte man auch sagen: Buren verwandelt, ja verzaubert die Architektur, die im Falle des Festspielhauses (Entwurf Auer+Weber+Partner) ohnehin schon 2001 mit dem Deutschen Architekturpreis ausgezeichnet wurde.
Die Farbfolien hat Buren alphabetisch nach (deutschsprachiger) Bezeichnung auf die Scheiben des Festspielhauses gesetzt: Blau, Goldgelb, Grün, Rosa. Die Kunsthalle erstrahlt in einem ähnlichen Spektrum – mit Ausnahme von Grün. Beide Arbeiten folgen dem minimalistischen Kunst-Vokabular, das Buren über viele Jahre hinweg für sich perfektioniert hat.
Es ließe sich schier endlos darüber theoretisieren, doch muss man gerade solche raumgreifenden Arbeiten natürlich „vor Ort“ selbst in Augenschein nehmen. Während das Festspielhaus von innen und von außen ganz verschiedene Ansichten darbietet (auch Wetterverhältnisse spielen dabei eine Rolle), ist die farbige Umgestaltung der Kunsthalle, da von innen beleuchtet, nur von außen angemessen wahrzunehmen und entfaltet erst bei Dunkelheit ihre ganze Wirkung.

Außenansicht der Kunsthalle nach Daniel Burens farblicher Intervention. (Foto: Ferdinand Ullrich/Kunsthalle Recklinghausen)
Wie man sich denken kann, sind es Arbeiten auf Zeit, die nach dem 26. Juli nur noch in der Erinnerung (bzw. medial gespeichert) fortleben werden. Ähnlich wie etwa Christos Verhüllungen, verändern solche Eingriffe die Wahrnehmung der Bauten freilich auch auf Dauer. Wie fremd oder auch kenntlich werden einem Festspielhaus und Kunsthalle wohl vorkommen, wenn die Farbfelder wieder verschwunden sind?
Kunstausstellung der Ruhrfestspiele: Daniel Buren – Zwei Werke für Recklinghausen (Festspielhaus, Otto-Burrmeister-Allee 1 – Kunsthalle, Große-Perdekamp-Str. 25-27). 1. Mai bis 26. Juli 2015. Zahlreiche Führungen und „Kunstspaziergänge“. Infos: www.kunst-re.de, 02361/50-1935.
Eröffnung der Ruhrfestspiele am 1. Mai ab 13 Uhr mit dem traditionellen Volksfest rund ums Festspielhaus. Das Motto des Festivals lautet diesmal „Tête-à-Tête“ und verspricht ein vielfältiges Kultur-Rendezvous mit Frankreich. www.ruhrfestspiele.de
Vom Mikro zur Motorsäge – die zweite Karriere von Pia Lund („Phillip Boa & the Voodooclub“)
Sie war Sängerin bei Phillip Boa & the Voodooclub, der einzig wirklich erfolgreichen und international anerkannten Dortmunder Band. Heute arbeitet Pia Lund alias Pia Bohr als bildende Künstlerin im Dortmunder Klinikviertel. Unser Gastautor Michael Westerhoff hat sie dort besucht.
Pia Bohr arbeitet dort, wo sie lebt. In einem Hinterhof-Loft des Dortmunder Klinikviertels. „Hier ist nichts richtig gedämmt, im Winter ist es sehr kalt“, bremst Pia Bohr meine Begeisterung. Ihr Hund hat es sich auf einem Teppich gemütlich gemacht. Wir sitzen in ihrer Küche, die gleichzeitig Schlafzimmer und Wohnzimmer ist. Halt ein großer Raum, in dem sich das Leben abspielt.
Außer der Kunst. Die hat Pia Bohr ausgelagert. In einen Vorraum des Lofts. Wenn sie Baumstämme mit der schweren Motorsäge bearbeitet, staubt es mächtig. Holz für ihre Skulpturen holt sie einmal im Jahr in Italien: „Ich packe dann so viel wie möglich in den Kofferraum und fahre mit dem schwer beladenen Wagen nach Hause“.
Nach Hause – das ist seit einigen Jahren wieder Dortmund, nachdem sie einige Zeit mit ihrem früheren Partner Phillip Boa auf Malta gelebt hat. „Ich bin viel unterwegs und froh, wenn ich wieder hier hin komme“, erzählt sie. Pia weiß, dass Dortmund nicht der Nabel der Kunstwelt ist, sie fühlt sich hier aber wohl. Übrigens genauso wie ihr Ex-Partner Boa, der mittlerweile wieder zeitweise in der Stadt lebt.
„Du hast dich mit ihm im Café Strickmann getroffen? Da hat er schon früher immer seine Interviews gegeben.“ Es ist ein, zwei Jahre her, dass wir dort über Musik, aber insbesondere über Musiker, die an Streams und Downloads kaum noch etwas verdienen, gesprochen haben. Das ist durchaus auch für Pia ein Thema: „Die sollen schön weiter auf Tour gehen“, grinst sie. Bohr ist Mit-Autorin der meisten Lieder, bekommt also Tantiemen, wenn ihr Ex Phillip Boa mit den Songs auf Tour geht…
Mit Musik hat sie sonst nicht mehr viel zu tun. 2013 ist Pia Bohr ein zweites Mal beim Voodooclub ausgestiegen. Es hatte mal wieder Krach gegeben. „Ich würde gern mal wieder einen Song schreiben, das fehlt mir“, sagt sie. Die Auftritte mit der Band weniger. Doch sie hat den kreativen Prozess vom Schreiben bis zum Aufnehmen der Songs genossen.
Sie ist stolz auf ihre musikalische Vergangenheit: „Wir haben uns nie verbogen.“ Mit „Container Love“ oder „This is Michael“ hatten Phillip Boa & the Voodooclub ein paar passable Hits, arbeiteten mit dem Produzenten von David Bowie und verkauften in 30 Jahren immerhin rund zwei Millionen Tonträger. Dass sie keine Superstars wurden, lag wohl eher daran, dass sie Promotion und Marketing weitgehend vermieden haben.
Das Potenzial hatten sie. Auch wegen der einprägsamen Stimme von Pia Lund, wie sie sich damals nannte. „Sie haben sich durch ihre unnahbare Art viel kaputt gemacht“, sagen manche Kritiker. An Pia Bohr kann es nicht gelegen haben. Sie ist eine offene, sympathische Frau, mit der es Spaß macht, über Gott und die Welt zu reden.
Tim Renner holte die Band in den 80ern vom eigenen Independent-Label zur großen Polydor. „Der Renner ist ja jetzt Staatssekretär für Kultur in Berlin“, sagt Bohr. „Und er legt sich gerade heftig mit Claus Peymann an“, ergänze ich. „Naja, mit dem kann man sich ja auch gut anlegen“, antwortet Bohr. Und schon sind wir beim nächsten Thema.
Auf dem Esstisch liegt ein Buch von Kim Gordon, Ex-Sängerin von Sonic Youth. Wie Bohr Musikerin, die in den frühen 80ern begonnen hat, wie Bohr bildende Künstlerin und wie Bohr eine der wenigen Frauen, die in der musikalischen Macho-Welt der 80er als Frau bestehen konnte.
Für Wehmut gibt es jedoch keinen Anlass: „Heute kann ich entscheiden, was ich arbeite und wie ich arbeite, ich muss nicht mehr in einer Gruppe agieren.“ Sie genießt sie ihre Unabhängigkeit: „Ich muss keine Kompromisse mehr machen, kann tun und lassen, was ich will. Das war schon immer mein Traum“.
Ein lauter Traum, von dem die Kinder in der Tagesstätte gegenüber sicherlich ein Lied singen können. Wenn sie den Motorschleifer anwirft, ist das schon Punk: „Mehr als drei Stunden am Tag schaffe ich nicht, das Gerät ist zu schwer.“ Wegen der schönen Struktur bearbeitet sie in erster Linie Birnen- und Oliven-Baumstämme.
Bohr hat zwar einen Plan, wenn sie einen der Baumstämme zu großen Skulpturen verarbeitet. „Aber dabei bricht schon mal was ab.“ Das durchkreuzt regelmäßig ihren Plan. „Man muss mit dem Holz gehen, mit ihm kommunizieren.“ Bis eine Skulptur fertig ist, können Wochen vergehen.
Demnächst stellt Bohr in Berlin aus: „Da gibt es eine richtige Kunstszene, die die Arbeiten schätzt“, sagt sie mit einem kleinen Seitenhieb auf Dortmund. „Die Dortmunder wollen kleine, quadratische Bilder.“ Allenfalls Ärzte und Rechtsanwälte kaufen im Ruhrgebiet ihre Skulpturen. Trotzdem engagiert sie sich im Vorstand der „Dortmunder Gruppe“, einer Künstler-Vereinigung, die 1956 gegründet wurde, beteiligt sich an Kunstaktionen und öffnet ihr Atelier regelmäßig für Besucher.
Auftragsarbeiten macht Bohr eher ungern, aber manchmal kann sie nicht nein sagen. Sie zeigt mir zwei kleine Holzstücke, die sie vorsichtig in Handtücher eingeschlagen hat. „Sieht man, dass das Büffelköpfe sind?“ Die Hörner und der Kopf sind klar erkennbar. Man wird sie demnächst an der Tür eines Burgerladens im Kreuzviertel bewundern können.
„Das mechanische Corps“ – Technik der Jules-Verne-Romane inspiriert Kunst von heute

Die Kiste kann wandern, die Lokomotive fahren; bewegliche Kunst auf den Spuren von Jules Verne (Bild: David Brandt, HMKV im Dortmunder U)
Ein Messingobjekt, das in seiner kardanischen Aufhängung einem Schiffskompaß ähnelt, zeigt muntere Bewegung; ebenso sein Gegenüber, dessen Vorbild nicht so ohne Weiteres zu deuten ist, in dem sich etwas dreht, klassisch geradezu angetrieben von einer Technik, die lineare Schub- und Zugbewegungen einer Treibstange in Rotation überführt.
An der Decke bewegen sich rhyhthmisch die Paddel einer Luft-Galeere, weiter hinten hebt und senkt eine verrottete Nähmaschine in völliger Nutzlosigkeit den Nadelschaft. Mit aufgesetzter, zweckentfremdeter Miniaturskulptur der New Yorker Freiheitsstaue fräst eine Kernbohrmaschine ein Loch in die Museumswand, über Monitore laufen Sequenzen aus Filmen, die den Menschen vor rund 100 Jahren stumm erzählten, wie die Zukunft sein würde. All dies, und noch manches mehr, ist jetzt im Dortmunder U zu sehen.
Wenn man der Unterzeile des Ausstellungstitels glauben darf, wandeln die hier vorgestellten, überwiegend noch recht jungen Künstlerinnen und Künstler „auf den Spuren von Jules Verne“. Als „mechanisches Corps“ werden sie vom Kurator Christoph Tannert bezeichnet, der die Ausstellung zusammen mit dem vestorbenen Peter Lang für das Künstlerhaus Bethanien in Berlin realisierte.
Die Zukunft wird militärisch
„Das mechanische Corps“ ist auch der Titel der Ausstellung, und natürlich geschieht die Verwendung des eigentlich ja militärischen Begriffes Corps mit Hintersinn. Fortschritt, der utopische zumal, nahm in den Phantasien der Schriftsteller des 19. Jahrhunderts oft paramilitärtische Formen an. Zukünftige Gesellschaftsordnungen fußten auf militärischer Disziplin, Maschinen, mit denen Unmögliches möglich werden könnte – in Sonderheit die Reise zum Mond – waren Kanonen, Granaten, Torpedos und Raketen.
Gleichwohl wäre es vermessen, im Kollektiv der ausstellenden Künstler militärisch-elitäre Trends zu suchen. Der Titel der Ausstellung, anders gesagt, greift ein wenig ins Leere. Am ehesten noch eint die Ausstellenden doch die Freude an der (motorisch generierten) Bewegung, an der Nachvollziehbarkeit mechanischer, uhrwerkhafter, sichtbarer Abläufe.
Zwar ist in unserer Zeit fast alles in Bewegung, die Bewegungen der Maschinen indes sind fast unsichtbar geworden. Was bewegt sich noch in einem Kraftwerk, an einer Elektrolok? Bewegung findet im Alltag vieler Menschen größtenteils virtuell auf dem Computerbildschirm statt, ein unbefriedigender Zustand, der die ausstellenden „Retrofuturisten“ (O-Ton Tannert) beflügelt haben mag.

Hier darf die Nähmaschine sein, was sie immer schon war: ein kinetisches Objekt (Foto: David Brandt/ HMKV im Dortmunder U)
Dampf verändert alles
Zudem war die quasi-militärische Organisation der Industriearbeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die die Zukunftsphantasien vieler Autoren prägte, den immer komplexeren Produktionsabläufen geschuldet. Sie ließen sich seinerzeit nur in militärgleich gestalteten Befehlsstrukturen meistern, denn die computergestützte Meß- und Regeltechnik, die heutzutage oft auch Robotern die Arbeit zuteilt und mit ihnen plaudert (Stichwort Industrie 4.0), gab es noch nicht. Leider bleibt dieser Aspekt in der Schau weitgehend unbeachtet.
Aber vielleicht greift das schon zu hoch. Wenn Kurator Tannert die jungen Künstler auf Jules Vernes Spuren wandeln sieht, so auch deshalb, weil dessen Bücher reich bebildert waren und die wunderbar bewegliche Technik des 19. Jahrhunderts so eindrucksvoll in Szene setzten, daß uns das noch heute zu inspirieren vermag.
Neben den Raketen war natürlich der Dampf das Faszinosum jener Zeit, der in immer größeren Kolbenmaschinen mit viel rhythmischer Bewegung arbeitete und die menschliche Zukunft radikaler und ungleich schneller verändern würde als alle Erfindungen zuvor. Auch Reisen, Messen, Berechnen und Beobachten – Letzteres vor allem mit starken Teleskopen – waren andächtige Handlungen in den Illustrationen. Eine sorgfältig zusammengestellte Diaprojektion, übrigens noch mit museumstypischen Karussell-Projektoren und richtigen Dias, zeigt dafür etliche Beispiele.
Steam-Punker lieben es rüschig
Übrigens findet die Science-Fiction-Ästhetik des 19. Jahrhunderts heute ihren jugendkulturellen Ausdruck im düsteren, viktorianisch-rüschigen Steam-Punk, dem einige der Ausstellenden huldigen und der sich als Designvariante in recht kommerziellen Produkten findet, in Armbanduhren im Kapitän-Nemo-Look zum Beispiel oder in hochgradig retromäßigen Computertastaturen mit messingglänzender Registrierkassenoptik. Auch solche Objekte hat Kurator Tannert in die Ausstellung genommen, weil sie das Gesamtbild ergänzen.
Hingegen wirken die kindlich-ungelenken, bunten Bilder von Fluggeräten und Fliegern, die an einer Wand hängen, auf den ersten Blick deplaziert. Sie stammen von Karl Hans Janke, 1909 geboren, 1988 gestorben und bei Wikipedia als Vertreter der „Outsider-Art“ gelistet. Einen Großteil seines Lebens verbrachte er in der Psychiatrie, nachdem man ihm im Krieg Schizophrenie attestiert hatte. Janke hat vor seiner Erkrankung einige patentierte Erfindungen gemacht, sich später an der Konstruktion eines „Schwingenflugzeuges“ erfolglos abgearbeitet. Erfunden hat er bis zuletzt, weshalb man ihm in der Psychiatrie „Erfinderwahn“ bescheinigte. Doch hat er auch zeitlebens den Traum vom Fliegen geträumt, vielleicht, wie verschwommen auch immer, vom Flug in eine bessere Zukunft.
„Das mechanische Corps – Auf den Spuren von Jules Verne“. Hartware Medienkunstverein (HMKV) im Dortmunder U, Leonie-Reygers-Terrasse, Dortmund. Bis 12. Juli 2015. Geöffnet Di+Mi+Sa+So 11-18 Uhr, Do+Fr 11-20 Uhr. Eintritt 5 €. Katalog des Berliner Künstlerhauses Bethanien 29 €. Infos: www.hmkv.de
Bilder einer aufstrebenden Gesellschaft – Recklinghausen zeigt Ikonen aus Varna
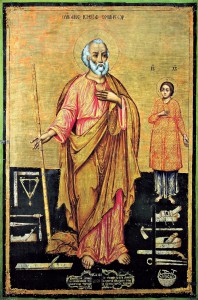
Der Heilige Joseph, der halbwüchsige Christus und reichlich Schreinerwerkzeug. Die Ikone der Schreiner-Innung entstand um 1850 in Bulgarien. (Foto: Ikonen-Museum Recklinghausen)
Hier ist er der Mittelpunkt: Joseph, Ehemann von Maria und, wie man das immer etwas verschämt nennt, Ziehvater des Jesusknaben. Wegen göttlich herbeigeführter Jungfrauenschwangerschaft war er ja nicht der biologische Vater. Mitte des 19. Jahrhunderts jedoch hat man sich in Varna seiner angenommen und ihm in einer großen Ikone den Ehrenplatz zugewiesen.
Und da steht er nun, wallend das Gewand, doch bescheidend schauend, einen Zollstock in der Hand. Rechts im Bild und wesentlich kleiner ein barfüßiger Halbwüchsiger, den der Heiligenschein als Messias ausweist. Weiter unten im Bild jedoch ist eine Menge Zimmermannswerkzeug zu sehen, Winkel, Zirkel, Hobel, auch ein Töpfchen Nägel. Diese Dinge machen die Wertschätzung verständlich, die dem guten Josef hier zuteil wird: Auftraggeber des Werkes nämlich war im Jahre 1850 die Schreinergilde von Varna, die im Lobpreis ihres Schutzpatrons auch noch ein wenig Werbung in eigener Sache unterbrachte.
Der zu späten Ehren gelangte Heilige Josef ist jetzt im Recklinghäuser Ikonenmuseum zu bewundern, eine von etlichen Leihgaben des Ikonenmuseums in Varna, Bulgarien. „Wunder des Lichts“ heißt die kleine, aber vorzügliche 40-Bilder-Schau, die in ähnlicher Zusammenstellung zunächst im niederländischen Dordrecht zu sehen war. Dordrecht ist Partnerstadt von Recklinghausen ebenso wie von Varna am Schwarzen Meer, über einige gute städtepartnerschaftliche Kontakte kam das Projekt zustande.
Osmanen respektierten den orthodoxen Glauben
Die Tradition des orthodoxen Christentums der Bulgaren ist alt. Kyril und Method, beide auch heute noch verehrt, missionieren das slawische Volk schon lange vor der ersten Jahrtausendwende. Auch später, während der 500 Jahre währenden Osmanen-Herrschaft, die erst im 18. Jahrhundert ihr Ende findet, behalten die Bulgaren ihren orthodoxen Glauben.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts malte der Bulgare Vionos die Heilige Marina mit Szenen aus ihrem Leben (Foto: Ikonen-Museum Recklinghausen)
Dann jedoch – der osmanische Sturm auf Wien ist abgewehrt, das adelige Europa gefällt sich in pompösem Barock – bricht neues nationales Selbstbewusstsein sich Bahn, das seinen Ausdruck auch in der Ikonenkunst findet. Großformatige, lichte, farbenfrohe Gemälde vereinigen oft erstaunlich leichthändig rituelle Pflicht, Volksbelehrung und den wachsenden Geltungsdrang einer aufstrebenden städtischen Gesellschaft. Nationalfarben, Patrone, Entstehungsjahre und last not least Namen von Künstlern und Auftraggebern werden den Motiven zugesellt. An die Stelle frommer Statuarik tritt eine oft erstaunliche Individualität. Die heilige Marina aus dem 18. Jahrhundert zum Beispiel, die ein Maler namens Vionos mit Eitempera auf Holz erstehen ließ und die, wie die Legende aus dem 3. Jahrhundert berichtet, trotz schlimmster Folter nicht von ihrem Glauben ließ, bis man sie am Ende köpfte, diese heilige Marina begegnet uns auf der 107 mal 75 Zentimeter großen Tafel in dynamischer, geneigter Körperhaltung und mit einem skeptischen Blick, der aus gesenktem Haupt in die Ferne schweift und Drohendes zu ahnen scheint. Diese Ikone ist personalisiertes Portrait, positioniert vor einem wunderschönen Landschaftshintergrund. 22 kleine Bilder umfassen das Hauptmotiv und berichten en detail vom Martyrium der jungen Frau.
Selbstbewußt und oft auch heiter
Natürlich gibt es auch die üblichen Heiligen zu sehen, Georg, Nikolaus, Petrus und Paulus, den heiligen Dimitrij von Priluki und die heilige Julitta mit ihrem Sohn Kyrikos und viele, viele mehr. Zahlreich sind die Interpretationen Marias. Mal ist sie ausschließlich liebende und tröstende Mutter (wie in einer anonymen Darstellung aus dem 19. Jahrhundert), mal Königin der Königinnen, selbstbewusst und stark vor goldenem Grund, wie der Bulgare Hadji Anagnosti sie 1839 schuf. Gern auch zeigt man sie als „Lebensspendende Quelle“, so wie Mitte des 19. Jahrhunderts Zacharias Tsanjuv. In dessen Bild füllt Heilwasser aus zwei Speiern unter Mariens Thron ein Becken, aus welchem Kranken spontane Heilung zuteil wird. Der Tote erwacht in seinem Bett und wundert sich, der Besessene wundert sich ebenfalls nach Wasserguss, während ein schwarzer Dämon, der offenbar in ihm war, mit rauchender Spur die Flucht ergreift. Man kann wirklich nicht sagen, dass diese Bildergeschichten immer ganz humorfrei wären.

Das Archäologische Museum Varna. Von hier stammen die Leihgaben, die jetzt in Recklinghausen zu sehen sind. (Foto: Ikonen-Museum Recklinghausen)
Der Katalog zur Ausstellung, wenn man ihn so nennen will, ist in Deutsch und Niederländisch erhältlich und verdient besondere Erwähnung. Weitgehend stammt er aus der Feder der Recklinghäuser Hausherrin Eva Haustein-Bartsch und ihres Varnaer Kollegen Konstantin Ugrinov; er hat Taschenbuchformat und gibt erschöpfend Auskunft über die Ausstellungsstücke und über viele Details, die sich nicht von allein erklären.
- „Wunder des Lichts. Bulgarische Ikonen aus Varna“
- Ikonen-Museum Recklinghausen, Kirchplatz 2a, Recklinghausen
- Bis 14. Juni.2015
- Geöffnet Dienstag bis Sonntag und feiertags: 11 bis 18 Uhr
- Eintritt 6 Euro, Katalog (240 S., 112 farb. Abb.) 15 Euro
- www.ikonen-museum.com
Bonner „Hommage an Michelangelo“ untersucht seine Wirkung auf andere Künstler

Werkstatt von Frans de Vriendt, genannt Floris: Brustbild des Michelangelo, um 1550. Foto: Kunsthistorisches Museum Wien
Schon zu Lebzeiten galt er als Legende. Seine Wirkung auf die europäische Kunst war und ist auch 450 Jahre nach seinem Tod enorm: Michelangelo Buonarroti (1475-1564) hat sich als herausragender Künstler der europäischen Renaissance vor allem durch seine virtuose Darstellung des menschlichen Körpers unsterblichen Ruhm erworben. Die Bundeskunsthalle Bonn widmet seinem jahrhundertelangen Einfluss auf die europäische Kunst eine Ausstellung. Die Schau ist bis 25. Mai zu sehen.

Der ideale menschliche Körper: Raffael zeichnete 1505/08 Michelangelos David vor dem Palazzo Vecchio in Florenz. Foto: The British Museum, London
Die „Hommage an Michelangelo“ stellt nicht dessen eigenen Werke in den Mittelpunkt, sondern fragt nach der Inspiration, die andere Künstler in der Auseinandersetzung mit seinem Werk erfahren haben. Gezeigt werden Gemälde, Drucke, Zeichnungen und Skulpturen von Künstlern wie Raffael, Caravaggio, Rubens, Tintoretto, Füssli, Delacroix, Rodin, Cézanne und Moore – bis hin zur Moderne mit Arbeiten von Robert Mapplethorpe, Markus Lüpertz oder Thomas Struth.
Seine innovative Rhetorik des Körpers begründet den über Jahrhunderte andauernden Einfluss Michelangelos. Er schuf ein Repertoire an Ausdrucksformen für menschliche Bewegungen, Haltungen und Affekte, die eine geradezu archetypische Kraft erwiesen haben. Die Interpretationen seiner Kunst reichen von Nachahmung und Hommage bis zu konzeptioneller Auseinandersetzung und kritischer Distanzierung.
Die Kuratoren Georg Satzinger und Sebastian Schütze stellen in der thematisch gegliederten Ausstellung die beispielgebende Wirkung der legendär gewordenen Arbeiten Michelangelos in den Mittelpunkt: der florentinische David oder der Auferstandene aus Rom etwa stehen für die Aktstatue, das Marmorrelief der Kentaurenschlacht oder das Jüngste Gericht für die großen, vielfigurigen Werke.
Beleuchtet wird auch die Wirkung bedeutender Werkkomplexe wie der Sixtinischen Decke oder der Figuren der Medici-Kapelle. Die Ausstellung zeigt zugleich die Medien, in denen sich das Studium der Werke Michelangelos vollzog und ihre Kenntnis festgehalten wurde: Abgüsse und Gemälde, kleinplastische Kopien, Nachzeichnungen, Drucke und Fotos.

Auswirkungen bis in die Moderne: 1938 schuf Henry Moore diese „Liegende Figur“. © The Henry Moore Foundation. Foto: Michael Furze. All rights reserved/VG Bild-Kunst, Bonn 2015.
- Zur Ausstellung ist im Hirmer-Verlag München ein Katalog erschienen: „Der Göttliche. Hommage an Michelangelo“, herausgegeben von der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Er umfasst 288 Seiten und etwa 400 Abbildungen in Farbe und kostet vor Ort 29 Euro.

Konstruktivistische Nacktheit: Aus der „Thomas“-Serie von Robert Mapplethorpe (1987). © Robert Mapplethorpe Foundation New York.
- Von 29. bis 30. April beleuchtet eine internationale Fachtagung in etwa 20 Beiträgen die umfassende und bis heute andauernde Wirkung Michelangelos in den Bildkünsten. Am 20. Mai, 19 Uhr, liest Markus Lüpertz eigene Gedichte und Sonette Michelangelos. Und am 21. Mai geht es in einer Abendveranstaltung unter dem Titel „Von Michelangelo bis Lagerfeld“ darum, ob der Künstler- und Starkult ein Phänomen oder eine kalkulierte Strategie ist.
- Die Bundeskunsthalle Bonn ist Dienstag und Mittwoch von 10 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet pro Ausstellung 10, ermäßigt 6,50 Euro; die Familienkarte 16 Euro. Das Kombi-Ticket für alle Ausstellungen ist für 15 bzw. 10 Euro und für Familien für 24 Euro zu haben. Im Online-Vorverkauf (Ticket plus Fahrausweis) gelten erhöhte Preise.
- Info: www.bundeskunsthalle.de