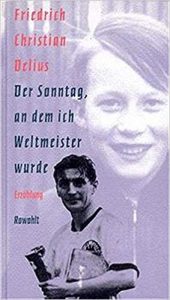„Berliner Orgie“: Im schäbigen Garten der Lüste
Vor seinen Feldforschungen für dieses Buch hat Thomas Brussig nach eigenem Bekunden nie ein Bordell betreten. Das ganze Milieu der käuflichen Sexualität war ihm völlig fremd.
Der Autor wird in „Berliner Orgie” nicht müde zu betonen, wie unwissend und „unschuldig” er sich ans Thema herangepirscht habe. Er bescheinigt sich selbst „die köstliche Freiheit des Naiven” und stellt klar, dass es auch im Verlauf seiner jetzigen Recherchen kein einziges Mal zum Äußersten gekommen ist. Das hatte er vorher seiner Frau versprechen müssen. Ist ja schon gut. Jetzt wissen wir’s: Brussig („Sonnenallee”) ist offenkundig kein Asphaltdichter, sondern ein Gegenbild zu abgebrühten, szenekundigen Poeten wie etwa Wolf Wondratschek.
Brussig hat sich also staunend in diversen Rotlicht-Vierteln und Sexhandels-Bezirken der Hauptstadt umgetan. Seine Wege führen vom miesen Straßenstrich bis zum vermeintlichen Edelpuff, von der schummrigen Kontaktbar über die Escort-Agentur bis zum weitläufigen Swingerclub und in Porno-Kinos.
Die Namen der Stationen lauten branchenüblich verheißungsvoll: „Lustgarten”, „Sexyland”, „Artemis”, „La Folie”, „Tempel-Oase” oder „Villa Venus”. Doch hinter den glitzernden Fassaden sieht’s oft ganz anders aus. Wer hätte das gedacht? Mal ehrlich: Ein guter Journalist hätte mindestens ebenso tragfähige Ergebnisse erzielt. Doch Brussigs Name macht sich natürlich besser auf einem Buchdeckel. Wofür Schriftsteller sich früher allerdings geniert hätten: Er war im Auftrag des Berliner Springer-Boulevardblattes „B. Z.” unterwegs. Der Zeitungsverlag zahlte die Spesen. Problem des Autors: Fast überall war’s schwierig, Quittungsbelege zu bekommen. Jedenfalls erhoffte sich die Zeitung wohl knackige Resultate.
Die liefert Brussig freilich kaum. Vielfach schildert er redlich und nüchtern die schäbige Ödnis der Etablissements, in denen meist routiniertes Abzocken (Nepp mit Schampus & Co.) angesagt ist. Die Metropole Berlin erscheint dabei vielfach als trübes, ja nahezu „totes” Gelände – und das zur angeblich so brünstigen Zeit der Fußball-WM 2006. Vom Weltstadt-Knistern keine Spur. Aus Brussigs Streifzügen erwächst denn auch ein (weitgehend negativer) Stadtführer; stets werden die besuchten Adressen benannt.
Zuweilen gibt sich Brussig geradezu rührend gestrig. Herkömmliches „Anbaggern”, so meint er, bestehe hieraus: „Kreide fressen, Mit-Blumen-Antraben, den Romantiker mimen, Schwüre schwören usw.” Ist das wirklich noch so? Immer erst glühende Schwüre, bevor es lustvoll ins Bett geht?
Beim Sex für Geld hingegen, so Brussig, herrsche allemal Sachlichkeit. Hier hätten die Frauen das Heft in der Hand, sprich: Die Huren bestimmen die Regeln. Klingt fast nach Befreiung – und ist sicherlich nur der kleinere Teil der Wahrheit. Übrigens glaubt Brussig den Mädchen und Damen des Gewerbes auch ihre standardisierten Lebensgeschichten, als könnten es keine Legenden sein.
Nur zweimal lässt sich der literarische Berichterstatter zur Begeisterung hinreißen. Nach einem Stelldichein im Swingerclub sinniert er: „Die Orgien haben starken Eindruck auf mich gemacht.” Über ein anderes Lusthaus (ohne würdeloses Gefeilsche um die Preise) heißt es sogar euphorisch: „Ich habe die Zukunft der Prostitution gesehen.” Ob dieser starke Werbespruch dort wohl bald über dem Eingang prangen wird?
Thomas Brussig: „Berliner Orgie”. Piper Verlag. 205 Seiten. 16,90 Euro.