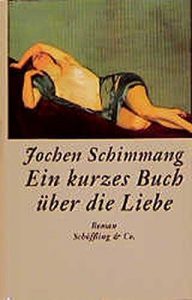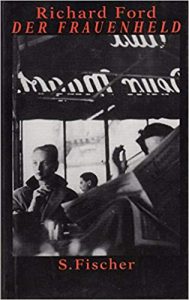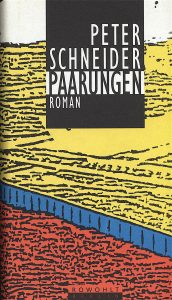Wie beim Tratsch im Treppenhaus – Martin Walsers Roman „Der Lebenslauf der Liebe“
Von Bernd Berke
Man könnte diese Susi Gern beneiden. Mit ihrem Gatten, dem Star-AnwaIt Edmund Gern, lebt sie in einem 390 Quadratmeter großen Düsseldorfer Dachwohnungs-Paradies. Er fährt einen Bentley, sie begnügt sich mit Porsche. Von Edel-Garderobe und Kunstsammlung reden wir gar nicht erst. Damit alles hygienisçh bleibt, gönnen sie sich fünf Putzfrauen.
Für seinen neuen Roman „Der Lebenslauf der Liebe“ hat sich Martin Walser nicht gerade in den Elendsquartieren umgetan. Geld ist (zunächst) reichlich vorhanden, und auch an Wortreichtum lässt es der Autor nicht mangeln: Auf 525 Seiten breitet er Susis schweres Eheschicksal und Vorfälle aus ihrem Umfeld derart redselig und uferlos aus, dass man sich fast beim Tratsch im Treppenhaus wähnt. Ungleich besser formuliert als zwischen Tür und Angel, gewiss; doch meist nicht so funkelnd, wie wir es bei Walser lieben. Es ist, als hätte ihn eine Torschlusspanik ergriffen, als wollte er seine Zettelkasten-Bestände restlos auserzählen.
Ausharren bei einem Scheusal
Schweres Eheschicksal? Nun ja. Die Seelenpein ist gut gepolstert, jedoch vorhanden: Mit der munteren, doch geistig zurückgebliebenen Tochter Conny (ärztlicher Kunstfehler bei der Geburt) haben sie ihre liebe Last. Sohn Andreas gleitet derweil ins halbkriminelle Milieu ab. Vor allem aber ist der beruflich so gewiefte Vertrags-Schmied Edmund ein Sex-Maniak, den es seit ehelicher Frühzeit zum Gruppensex treibt. Die Absprache lautet: alles dürfen, aber einander nichts verschweigen. Doch das steht die im Grunde treuherzige Susi (die widerstrebend ihrerseits Männer ausprobiert) nicht ohne seelische Verwahrlosung durch.
Edmund braucht drei Dauer-Geliebte, dazu reichlich Spontan-Beischlaf. Selbst als die Parkinson-Krankheit ihn zum zittrigen Bettnässer degradiert, schleppt er sich noch zu anderen Frauen hin. Ächzend wankt er heim – und pinkelt wieder die Wohnung voll. Susi, aus deren Perspektive Walser schreibt, ekelt sich und hegt sogar Mordgedanken. Doch sie liebt das Scheusal. Trotz allem.
Diese Frau ist eine beinahe biblische Dulderin, die immerzu wartet, dass das Leben sich bessert. Doch bloßes Aushalten in der Fäulnis kostet „Feigesuse“, „Doofesuse“ (so nennt sie sich bisweilen selbst) alle Kraft. Trost bezieht sie aus dem Umgang mit Tochter Conny, ihren Kätzchen und jenen Sinatra-Songs: „My Way“, „Strangers in the Night“.
Der erste von drei Teilen („Sonntagskind“) spielt 1987. Börsencrash. Der sonst so souveräne Edmund verspekuliert sich, alles gerät ins Rutschen, riesige Schulden häufen sich. Nach und nach wird der Besitz verscherbelt, Susi und Conny müssen mit einem Appartment auskommen und allseits um Zahlungsaufschub betteln.
Verhurte Welt und kleines Glück
Diese bittere Fügung erlebt der bis zuletzt ruchlos optimistische Edmund nicht mehr. Parkinson rafft ihn dahin. Man denkt an „Jedermann“: Tod des reichen Mannes, Vergänglichkeit irdischen Habens. Die bewegendsten Strecken des Romans handeln von Verfall und Alter, vom Abbröckeln der Sexualität. Schonungslos.
Als Dieter Wellershoff „Der Sieger nimmt alles“ schrieb, nannte man ihn „Balzac der Deutschen Mark“. Walser bewirbt sich nun um den Posten „Balzac des Börsenfiebers“. Er zeigt uns eine verhurte Geld-Welt im Niedergang.
Strahlend wie eine (zerknitterte) Heilige hebt sich Susi mit ihrer Sehnsucht nach Dauer und der Absage an jede rechnende „Vernunft“ davon ab. Am Ende wird ihr eine quasi-religiöse Salbung zuteil. Zum Jahrtausend-Silvester 1999 darf sie sich, 68 Jahre alt, des neuen Gefährten endlich sicher sein. Arm aber glücklich: Das Schlussbild zeigt sie in glorioser Dreieinigkeit mit dem 31-jährigen Marokkaner Khalil und Tochter Conny. Die zieht das rheinische Fazit: „Mer blewe zusamm wie Kätzke und Tätzke bis zum Lewejottsdach.“ Amen.
Martin Walser: „Der Lebenslauf der Liebe“. Roman. Suhrkamp. 525 Seiten, 49,80 DM.