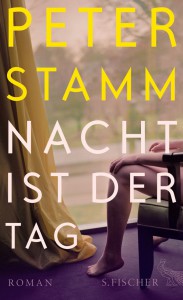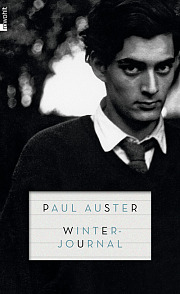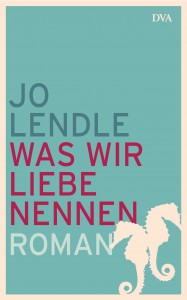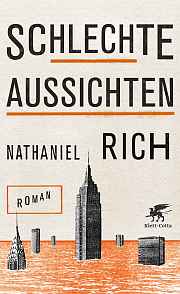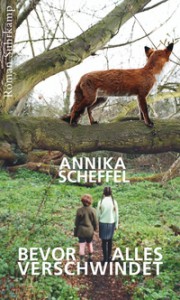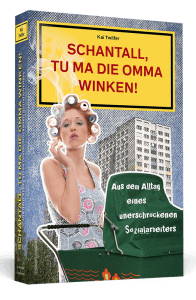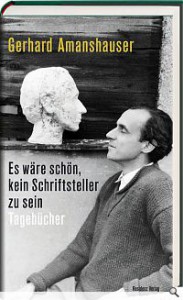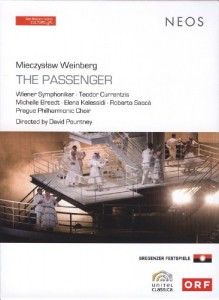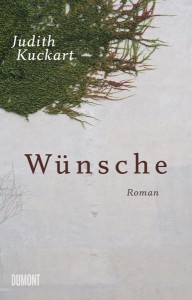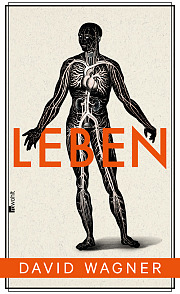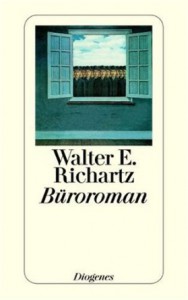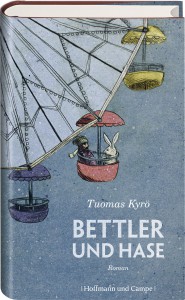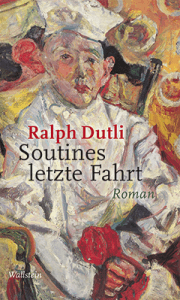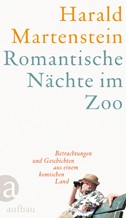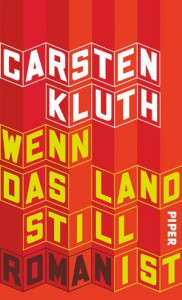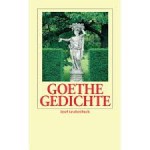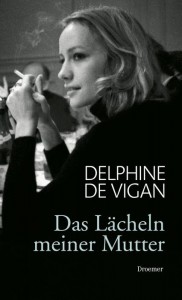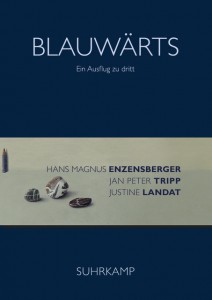Oben und unten, drunter und drüber – „Das Ungeheuer“ von Terézia Mora
Darius Kopp war „der einzige Mann auf dem Kontinent“, die Hauptfigur in Terézia Moras vorangegangenem Roman. Liest man nun die Fortsetzung „Das Ungeheuer“, so wünscht man sich inständig, er wäre – zumindest in der Fiktion – einfach der einzige Mann geblieben und niemand müsse sich die Mühe machen, ihn auf seinen weiteren, von Selbstmitleid geprägten Wegen zu begleiten.
Im „einzigen Mann“ beginnt die komplizierte Liebe zwischen dem IT-Experten Darius und der dolmetschenden Gelegenheitskellnerin Flora, einer gebürtigen Ungarin. „Das Ungeheuer“ nun beginnt mit einem Schock. Flora hat Selbstmord begangen. Darius fühlt sich in dem, was er Trauer nennt, gefangen. Er hat Aufzeichnungen Floras in ihrer Muttersprache gefunden und lässt diese übersetzen. Doch erst nach einem Jahr selbstgewählter Klausur in seiner Wohnung wagt er sich an die Lektüre, während er Flora auf ihren Vergangenheitswegen hinterher reist. Vor sich selbst rechtfertigt er den Aufwand dieser Reise mit dem Vorwand, einen Ort zu finden, an dem er Floras Asche beisetzen kann. Doch ihn treibt eher Unverständnis und ein diffuses Schuldgefühl sowie absolutes Unvermögen, mit seinem Leben weiterzumachen.
Die Seiten im Roman sind zweigeteilt. Die obere Hälfte erzählt von Darius Kopps rastloser Reise, die untere enthält Floras Aufzeichnungen einer Identitätskrise zwischen Retortenbaby und Hure. Es weist sich, dass Darius die Frau, die er liebte, nie gekannt hat. Nun offenbart sie sich ihm in ihren Aufzeichnungen. So hätte es eine zweite Liebesgeschichte werden können. Hätte. Es wurde nur ein klassischer Fall von „gut gemeint“.
Im oberen Teil kreist also Darius um sich selbst, im unteren lamentiert Flora über ihre Männergeschichten und repetiert Jean Amérys „Hand an sich legen“. Oben teilt Darius Teile seiner Reise mit Zufallsbekanntschaften wie der Tramperin Oda, unten mäandert Flora zwischen anspruchslosen Rezepten für Nudelsoßen und küchenpsychologischen Verhaltensregeln für Panikattacken. So anspruchslos die Rezepte, so anspruchslos sind auch die Regeln. Hauptsache, man kann eine Dose öffnen und gut durchatmen. So nimmt es kaum Wunder, dass Darius so gut wie nie auf das eingeht, was im unteren Teil geschieht. Das zeigt sich schon auf den ersten Seiten, wo Darius sich daran erinnert, wie seine Frau in ihren letzten Monaten mutlos in der Wohnung blieb. Ihn sorgte das nicht, er freute sich darüber, hatte er sie doch so ganz für sich alleine.
Die gebürtige Ungarin Terézia Mora, studierte Theaterwissenschaftlerin und ausgebildete Drehbuchautorin, schreibt seit Ende der neunziger Jahre als freie Autorin. Sie erhielt zahlreiche renommierte Preise und Stipendien, darunter auch den Ingeborg Bachmann Preis. In diesem Jahr erhielt sie für „Das Ungeheuer“ den Buchpreis des deutschen Buchhandels. Man kann sich allerdings ernsthaft fragen: Warum? Das Jury-Mitglied Thomas Böttiger sagte am Abend der Preisverleihung dazu wortwörtlich in den Tagesthemen : „Der Autor, der den Buchpreis bekommt, hat eine sehr hohe Auflage und für die Jury ist die Herausforderung, diese hohe Auflage auch ästhetisch zu rechtfertigen“.
Jaha. Das hätte man schöner nicht formulieren können. Fragte man sich schon während der Berichte über die diesjährige Buchmesse, wie zielführend es sein kann, wenn der Buchhandel Aufregung über File-Sharing und Self-Publishing propagiert und zeitgleich Becker, Katzenberger und Konsorten als Stars des Messe plakatiert. Nun fragt man sich auch noch, ob bloße Ästhetik wirklich das Parameter für einen Buchpreis sein kann. Wie wäre es denn mal mit Lesbarkeit gewesen? Man sieht sie förmlich vor sich, die Möchtegern-Bescheidwisser und Teilzeit-Intellektuellen unter den Kunden der großen Buchhandels-Ketten, wie sie blasiert zum „Ungeheuer“ greifen, es gerne auch verschenken, beweist man doch so literarischen Sachverstand. Wer das Buch nun tatsächlich liest, bleibt dahingestellt.
Auch wenn der Verlag freundlicherweise gleich zwei Lesezeichen-Bändchen implementiert hat, das Buch ist auch für geübte Leser sehr schwer lesbar. Der Lesefluss wird nicht nur durch die ständige Unterbrechung gestört, Mora wechselt auch gerne zwischen Erzählung in der ersten und dritten Person, zwischen Gegenwart und Vergangenheit – und das alles durchaus bevorzugt in nur einem einzigen Satz. Terézia Mora selbst sagte, die Störung des Leseflusses durch die zwei Ebenen sei gewollt. Das beruhigt nur marginal, einen Gefallen tut sie dem Leser und damit sich selbst nicht. Natürlich kann man als Autor den Lesefluss zwischendurch stören, man muss es sogar. Aber so wie hier, das ist des Wildwuchses zuviel. Das sind verquaste, selbstverliebte Manierismen.
Ebenso, wie der Text an sich weniger Reflektion denn larmoyantes Gejammere ist. Terézia Mora kann unbestritten schreiben, sie hat ein großes erzählerisches Talent. Sie hält die Tonlagen, das ausschließlich auf sich selbst Reflektierende hält sie in beiden Ebenen gut durch. Immer wieder gibt es Momente im Buch, da hat sie den Leser gepackt und tief in ihre Geschichte gezogen. Allerdings nur, um ihn sofort wieder herauszureißen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die wenigsten Leser dazu 760 Seiten lang bereit sind.
Zum Schluß des Buches greift die Autorin so richtig in die Symbol-Kiste. Es gibt eine Schlägerei mit rechtslastigen Parolen, Floras Asche im Kofferraum droht in Flammen aufzugehen und dann gibt es auch noch – Achtung! – Gasalarm. Damit dürfte wohl auch dem Letzten klar geworden sein, dass es ohne die Schatten der Vergangenheit keine derart verzweifelte Frau gegeben hätte.
Nun denn, Darius rettet die Asche und beschließt eine Fortführung der Reise nach Sizilien. Nichts kann ihn mehr schrecken, auch nicht die italienische Mafia. Und so lautet der neue Plan: Zu Fuß den Ätna besteigen, die Asche in den Krater kippen – das endlich soll er sein, der Platz , an dem niemand seiner Frau mehr etwas tun kann. Der Leser atmet auf, wünscht Darius Kopp einen erfolgreichen Tanz mit dem Vulkan und anschließend eine veritable Stärkung in einem sizilianischen Restaurant. Am besten mit einem Pastagericht, dessen Zutaten nicht aus der Dose kommen.
Terézia Mora: „Das Ungeheuer“. Roman. Luchterhand Verlag, 760 (zum Teil nur halb bedruckte) Seiten, € 22,99.