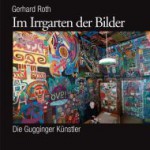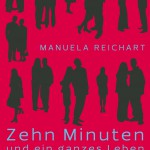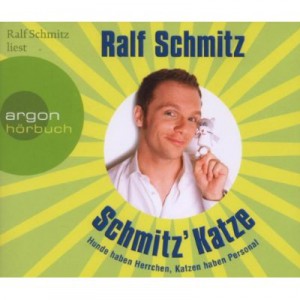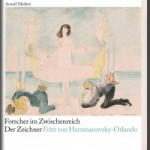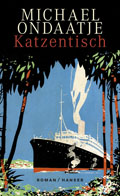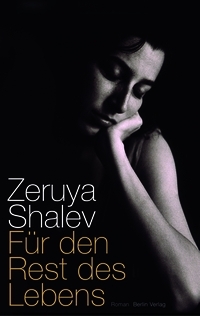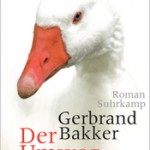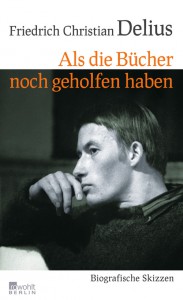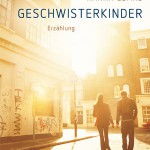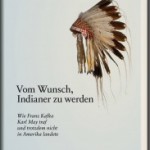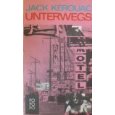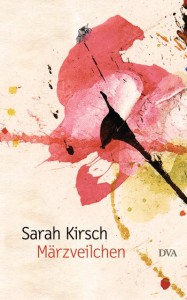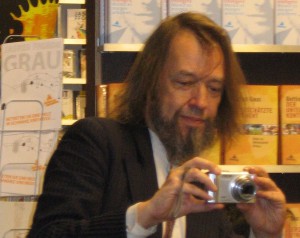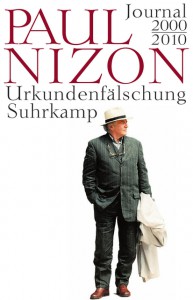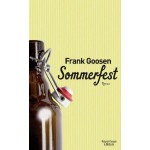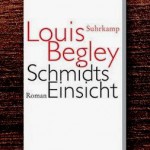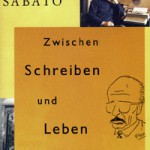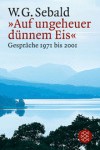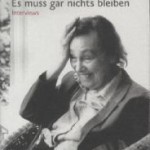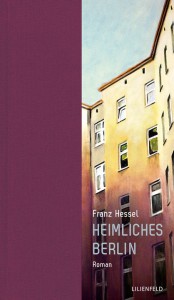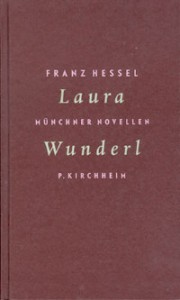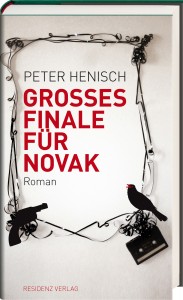Auf dem Berg der Wahrheit – Ein Spaziergang auf den Spuren von Hermann Hesse
Eigentlich ist er nur ein Hügel und sein richtiger Name ist Monte Monescia, doch das weiß heute kaum einer mehr. Weithin ist er als Monte Verità bekannt, als Berg der Wahrheit, ein legendenumwobener Hügel, über den Villendächern des einstigen Fischerdorfes Ascona im schweizerischen Kanton Tessin thronend.


Anfang des 20 Jahrhunderts sammelten sich auf diesem Berg reformbeseelte Künstler, Pazifisten und Gründer der sogenannten Alternativbewegung. Schon früh – 1907 – fand auch Hermann Hesse den Weg auf den Monte Verita. Bis heute unbestätigten Gerüchten zufolge soll er sich dort von seinen Alkoholproblemen entzogen haben. Schnell zeigte er sich inspiriert von der dortigen Künstlerkolonie, die in gewissem Maße das Hippieleben der 60erJahre vorwegnahm. Man lebte spartanisch in Hütten oder einfachen Steinhäusern, aus dem Granit der Tessiner Berge gebaut.
Besonders dem Propheten Gusto Gräser, einem langhaarigen bärtigen, stets in eine Tunika gewandetem Mann, schloss sich Hesse an. Gräser lebte zeitweilig in einer Höhle, seiner Waldgartenwelt nahe des Dorfes Arcegno im Tal hinter dem Monte Verita. Unklar ist, ob Hesse ihn dort nur besuchte oder auch mit ihm in dieser Höhle lebte.
 Zu Arcegno behielt Hesse eine enge Bindung, die über seinen Tod hinaus wirkte. Bis heute leben dort die Nachlaßverwalter seines literarischen Werkes. Sein ältester Sohn Heiner, 2003 verstorben und heute sein Enkel Silver. Arcegno gilt dem Wanderer im Tessin als Ausgangspunkt für die „Suche nach dem Schluss vom Ende der Welt“ und ist auch der einzige Ort aus dieser Gegend, dem Hesse ein explizites Werk widmete, in dem es aufschlussreich heisst:
Zu Arcegno behielt Hesse eine enge Bindung, die über seinen Tod hinaus wirkte. Bis heute leben dort die Nachlaßverwalter seines literarischen Werkes. Sein ältester Sohn Heiner, 2003 verstorben und heute sein Enkel Silver. Arcegno gilt dem Wanderer im Tessin als Ausgangspunkt für die „Suche nach dem Schluss vom Ende der Welt“ und ist auch der einzige Ort aus dieser Gegend, dem Hesse ein explizites Werk widmete, in dem es aufschlussreich heisst:
„Hier ist mein heiliges Land,
hier bin ich hundertmal
Den stillen Weg der Einkehr in mich selbst
Im Sinnbild einsamen Geklüfts gegangen.“*
 Hermann Hesse verbrachte einen Großteil seines Lebens im Tessin, er wählte den bei Lugano gelegenen Ort Montagnola als sein eremitisches Ziel. Immer wieder jedoch kehrte er an den Monte Verità und nach Ascona zurück. Auffällig ist, dass der Monte Verità viele Künstler anzog und inspirierte, doch ihre bekanntesten Werke entstanden allesamt woanders. Eine bleibende, typische Kunst des Monte Verità gab und gibt es nicht. Dennoch finden sich viele Ansätze, die eine Interpretation zulassen, dass sich der Geist dieses sonderbaren Ortes in etlichen von Hesses Werken wiederfindet. So die Erzählung in den Felsen bei der man sofort an die besagte Höhle denken muss.
Hermann Hesse verbrachte einen Großteil seines Lebens im Tessin, er wählte den bei Lugano gelegenen Ort Montagnola als sein eremitisches Ziel. Immer wieder jedoch kehrte er an den Monte Verità und nach Ascona zurück. Auffällig ist, dass der Monte Verità viele Künstler anzog und inspirierte, doch ihre bekanntesten Werke entstanden allesamt woanders. Eine bleibende, typische Kunst des Monte Verità gab und gibt es nicht. Dennoch finden sich viele Ansätze, die eine Interpretation zulassen, dass sich der Geist dieses sonderbaren Ortes in etlichen von Hesses Werken wiederfindet. So die Erzählung in den Felsen bei der man sofort an die besagte Höhle denken muss.
Informiert man sich über Gusto Gräser, den Mitbegründer des Monte Verita Projekts denkt man unwillkürlich an den Propheten Eduard van Vlissen aus dem Weltverbesserer. Ziemlich sicher spielt Demian, das frühe Hauptwerk Hesses, auf dem Monte Verità und die Vermutung liegt nahe, dass Gräser sich auch in der Figur des Max Demian widerspiegelt. Gräsers stets und ständig gepredigtes Credo war „Sei Du selbst“ – und im Demian heisst es als Quintessenz „Wir empfanden einzig dies als Pflicht und Schicksal: dass jeder von uns ganz er selbst werde.“ Schlussendlich aber war der Geist des Monte Verità ihm wohl auch eine Warnung und liess ihn zu einem Gegner jeder absoluten Menschheitsbeglücker-Theorie werden. Deren Heilsversprecher nannte er in späteren Werken gerne barfüßige Propheten, Kohlrabi-Apostel oder Körndlfresser, wie in der Erzählung Dr. Knölges Ende.
Und heute? Heute ist der Monte Verità eine Art Gemischtwaren-Angebot aus der reichen Palette esoterischer Lehren. Man kann anthroposophisch geprägte Regenbogenwege gehen und fernöstlichen Zeremonien beiwohnen. Für dezente 38 Schweizer Franken kann man eine japanische Tee-Zeremonie erleben und dabei Tee verkosten, der tatsächlich im hügeligen Mikroklima auf einer kleinen Teeplantage angebaut wird.
 Man kleidet sich als Besucher des Monte Verità gerne hell, licht und luftig, wandelt entrückt auf den Wegen, ganz in sich selbst versunken, sorgsam darauf bedacht, niemanden zu grüßen – wie sonst auf Spazierwegen in der freundlichen Schweiz üblich. Da wirkt das in den vierziger Jahren auf den Hügel geklotzte Hotel im Bauhaus-Stil – an sich nicht gerade ein Prunkstück der Bauhaus Architektur – in seinen strengen klaren Linien geradezu erholsam.
Man kleidet sich als Besucher des Monte Verità gerne hell, licht und luftig, wandelt entrückt auf den Wegen, ganz in sich selbst versunken, sorgsam darauf bedacht, niemanden zu grüßen – wie sonst auf Spazierwegen in der freundlichen Schweiz üblich. Da wirkt das in den vierziger Jahren auf den Hügel geklotzte Hotel im Bauhaus-Stil – an sich nicht gerade ein Prunkstück der Bauhaus Architektur – in seinen strengen klaren Linien geradezu erholsam.
 Es ist ein Ort, der wie Ascona zwischen Magie und Spießbürgertum verharrt, ein Ort, der sein Versprechen auf Wahrheit niemals einlösen kann, ein Ort bornierter Manierismen. Ich zitiere derzeit zu gerne Dea Loher aus ihrem Roman „Bugatti taucht auf„: dieser schreckliche Monte Verità mit seinen traurigen, sich esoterisch spreizende Gebäuden und Anlagen ist nur der fürchterlichste, weil vollkommen belanglose Ausdruck dieser Langeweile und Abgehobenheit. Ich bin mir sicher, Hermann Hesse hätte sich dort oben auch nicht mehr wohlgefühlt. Wer Orte der Sehnsucht und Kraftquellen im Tessin sucht, frage lieber Einheimische und Ortskundige. Die findet man auf dem Monte Verita nämlich auch eher selten.
Es ist ein Ort, der wie Ascona zwischen Magie und Spießbürgertum verharrt, ein Ort, der sein Versprechen auf Wahrheit niemals einlösen kann, ein Ort bornierter Manierismen. Ich zitiere derzeit zu gerne Dea Loher aus ihrem Roman „Bugatti taucht auf„: dieser schreckliche Monte Verità mit seinen traurigen, sich esoterisch spreizende Gebäuden und Anlagen ist nur der fürchterlichste, weil vollkommen belanglose Ausdruck dieser Langeweile und Abgehobenheit. Ich bin mir sicher, Hermann Hesse hätte sich dort oben auch nicht mehr wohlgefühlt. Wer Orte der Sehnsucht und Kraftquellen im Tessin sucht, frage lieber Einheimische und Ortskundige. Die findet man auf dem Monte Verita nämlich auch eher selten.
*Bei Arcegno, 1925 veröffentlicht Weitere Quellen: Wikipedia/ Ascona und sein Berg Monte Verita, ArcheVerlag Zürich, 1979 / Ständige Ausstellung Monte Verità in der Casa Anatta/Bilder alle von Britta Langhoff