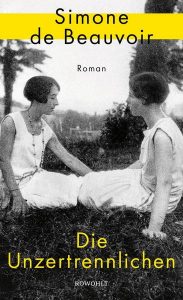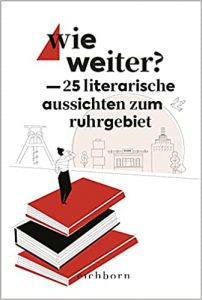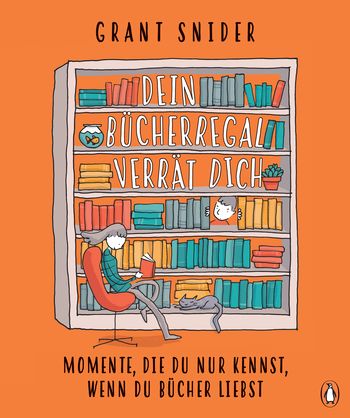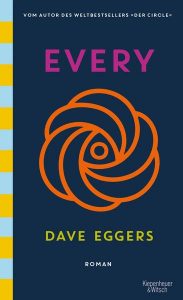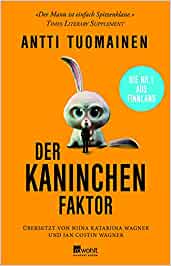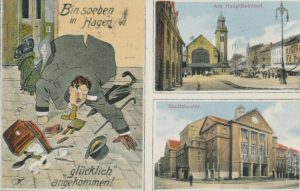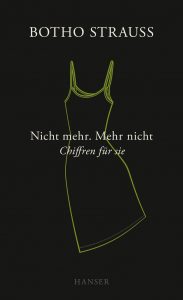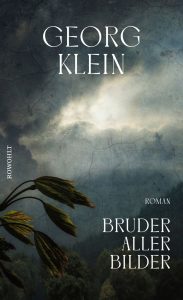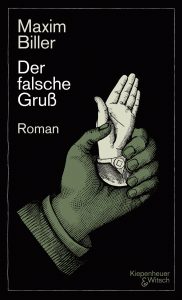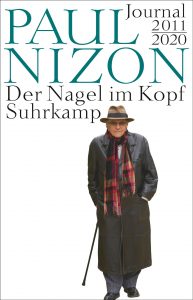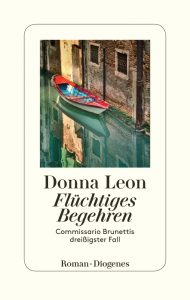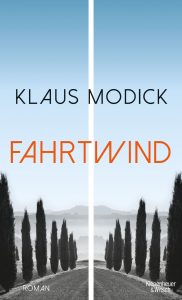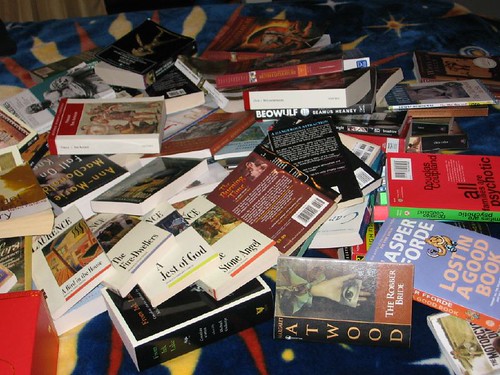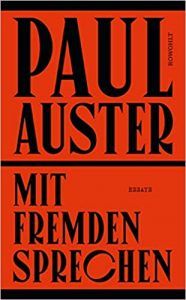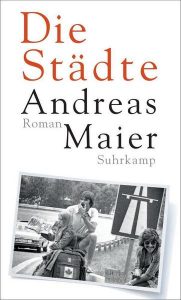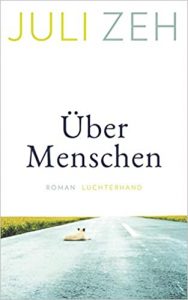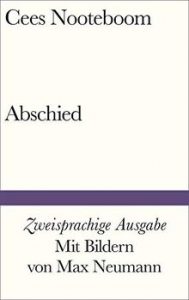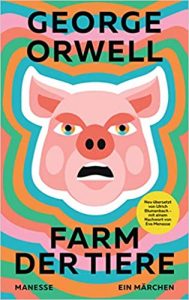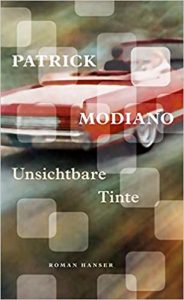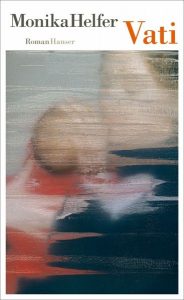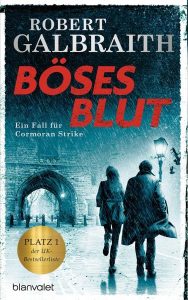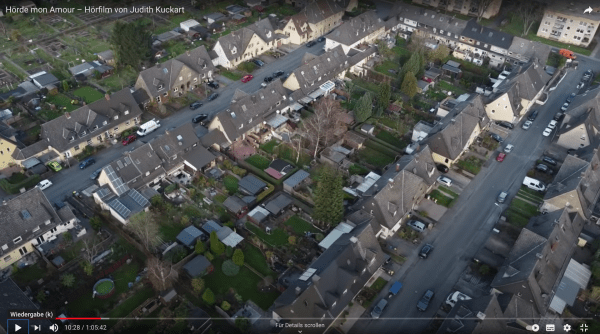Joris-Karl Huysmans, vor allem bekannt geworden durch ein Buch, das oft als „das Brevier der Dekadenz“ bezeichnet wird – den 1884 erschienenen Roman À rebours (deutsch meistens: Gegen den Strich) –, wandte sich im Laufe seines Lebens zunehmend dem Katholizismus zu. Jetzt liegt erstmals in deutscher Übersetzung ein Werk vor, das am Ende dieses Weges steht: Lourdes. Mystik und Massen (Originaltitel: Les Foules de Lourdes, 1906).

Bereits nach dem Erscheinen von À rebours sah Huysmans‘ Schriftsteller-Kollege Barbey d’Aurévilly in einer Besprechung im Constitutionnel am 28. Juli 1884 voraus: „Nach einem solchen Buch bleibt dem Verfasser nur noch die Wahl zwischen der Mündung einer Pistole und den Füßen des Kreuzes.“ Huysmans entschied sich nicht für den Suizid; er starb 1907 im Alter von 59 Jahren an einem Tumor im Unterkiefer. Sein Buch über den Wallfahrtsort Lourdes, wo er sich in den Jahren 1903 und 1904 jeweils für mehrere Wochen aufhielt, war das letzte seiner Bücher, das zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurde.
Schon der dekadente Adlige Des Esseintes in À rebours hatte sich eine Sammlung mit Werken frühchristlicher und mittelalterlicher Autoren zugelegt. Gegen Ende des Romans empfindet der Protagonist die Sinnleere dieser mit sich selbst beschäftigten Ästhetik und sehnt sich nach seiner Zeit im Jesuiten-Internat zurück. In den nachfolgenden Werken Là-bas (1891, dt.: Tief unten), En route (1895, dt.: Unterwegs), La Cathédrale (1898, dt.: Die Kathedrale) und – nachdem Huysmans 1900 selbst Laienbruder (Oblate) im Benediktinerorden geworden war – L’Oblat (1903, dt.: Der Oblate) lässt sich seine allmähliche Annäherung an den christlichen Glauben mitvollziehen.
Mittelalterliche Frömmigkeit
In einer Besprechung von Paul Verlaines religiösen Gedichten (Sagesse, 1880), die auf Deutsch in der Zeitschrift Sinn und Form erschienen ist (Heft 2/2017), hebt Huysmans auf die verlorene und bei Verlaine wiedergefundene Frömmigkeit des Mittelalters ab. Es ist eine „fast volkstümliche Ungeniertheit, diese zutiefst rührende Zerknirschung“, die er hier entdeckt. Verlaine habe „als einziger nach Jahrhunderten die Töne der Demut und Unbefangenheit, der klagenden und zaghaften Gebete, den Jubel des kleinen Kindes wiedergefunden, die seit der Rückkehr jenes stolzen, Renaissance genannten Heidentums vergessen waren.“ Eine Rückkehr zur vollkommenen Hingabe strebt er auch in seinem Buch über Lourdes an.
Drastische Beschreibung von Krankheiten
Jedoch ist Huysmans weniger ein religiöser Schwärmer als vielmehr ein scharfsinniger Beobachter und leidenschaftlicher Kritiker seiner Zeit. Den Eingangssatz zum ersten Kapitel seines 300-Seiten-Buchs, „Wenn es einen gibt, der niemals den Wunsch gehabt hat, Lourdes zu sehen, dann bin ich es“, darf man ihm abnehmen. Er, der seine literarische Geburtsstunde in der Gruppe der Naturalisten um Émile Zola erfuhr, bevor er mit À rebours auch Anhänger der symbolistischen Schule für sich einnahm, ist dem naturalistischen Stil der exakten Beschreibung treu geblieben. Das zeigt sich vielleicht am drastischsten in der detaillierten Beschreibung von Krankheiten, die er im Spital oder an der Heilquelle in der Grotte der Jungfrau Maria beobachtet. Bei den vom „Wundschleim der Kranken“ getrübten Wasserbecken, in denen die Wundergläubigen eintauchen oder gebadet werden, könnte man annehmen, dass sie mehr Krankheiten hervorrufen als heilen.
Kritiker der Geschäftemacherei
Ein großes Thema der Naturalisten um Zola, das aber ebenso im ästhetizistischen Roman À rebours aufscheint, ist die Kritik am modernen Kapitalismus. Huysmans geißelt die Geschäftemacherei, die sich in Lourdes entwickelt hat. Einige riesige Heil-Industrie hat sich dort entwickelt; nationale Wallfahrten wurden organisiert; in den kleinen Ort am Fuße der Pyrenäen reisten aus ganz Frankreich Zehntausende in speziellen Sanitätszügen, den Trains Blanches, begleitet von vielen freiwilligen Helfern. Zusätzlich kamen zahlreiche Reisegruppen aus dem Ausland. Die Stadt verwandelte sich in ein gigantisches Beherbergungslager; Souvenirläden und Devotionalienhandlungen eröffneten in großem Ausmaß. Huysmans zieht es hin zu den wenigen Rückzugsorten, in die – auf seinen späteren Reisen nicht mehr existierende – alte Kirche Saint-Pierre, „eine bezaubernde Dorfkirche“, wo er noch stille Einkehr erleben durfte, zu einer abseits der Pilgerströme gelegenen Kapelle auf der anderen Seite des Flusses Gave de Pau und zu dem kleinen und ärmlichen Kloster der Klarissen, wo die Oberin ihm ein langes Gespräch gewährt.
Basilika als „Blutsturz des schlechten Geschmacks“
Dagegen ist die 1889 fertiggestellte, erst 1901 eingeweihte und bis zu 1.500 Personen fassende Rosenkranz-Basilika im neobyzantinischen Stil für ihn ein „Blutsturz des schlechten Geschmacks“. Architektonisch sei sie gründlich misslungen und, mehr als das, geradezu ein Werk Satans: „Ohne Einflüsterungen aus einer bösartigen Jenseitswelt kann der Mensch allein Gott nicht in dieser Weise entehren.“ Auf dem Gebiet der Ästhetik erweist sich die Radikalität seines Urteils ganz besonders, und schon die älteren Werke Huysmans machen deutlich, wie wichtig für ihn Liturgie und Form waren. Was er dagegen in Lourdes ansehen musste, „ist ziemlich erbärmlich, es reizt dazu, die Stadt zu verlassen und sie niemals wieder zu betreten.“ Von unfassbarem Kitsch und nicht geeignet, das Heilige zu repräsentieren, ist eine Station auf dem Kreuzweg, und tatsächlich wurde sein 1906 erschienener Verriss von der Kirche ernst genommen und die von ihm besonders geschmähte Station des Kreuzwegs daraufhin umgestaltet.
Das andere Gesicht von Lourdes – die soziale Utopie
Nicht alles an Lourdes stößt ihn ab. Das Massenphänomen der Pilgerschaft und Heilsuchenden erzeugt auch ein tiefes Gefühl von Gemeinschaft – „all diese wachenden Menschen, so fern ihrer Heimat, sagen das Gleiche in den unterschiedlichen Sprachen und denken das Gleiche.“ Die Erfahrung von Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe beeindruckt ihn tief. In den vielen freiwilligen Helfern, Pflegerinnen und Pflegern, Krankenträgern und Ärzten, die die Schwerkranken und Gebrechlichen begleiten, sieht Huysmans ein Stück sozialer Utopie verwirklicht. „In dieser Stadt der Jungfrau lebt das Urchristentum wieder auf (…).“ Angesichts des Leids scheinen soziale Unterschiede keine Rolle zu spielen. Es ist die zeitweise Verschmelzung der Klassen. Die Frau von Welt verbindet und wäscht die Arbeiterin und die Bäuerin, der Herr in gehobener Stellung wird Tragesel für den Handwerker und den Landmann, fungiert als Badehelfer in ihrem Dienst.“
„Die Wunderheilungen: Für und Wider“
Vielleicht wäre Huysmans‘ Buch über Lourdes nicht entstanden, hätte nicht sein früherer Lehrmeister, der acht Jahre ältere Émile Zola, 1894 einen Roman mit dem Titel Lourdes veröffentlicht. Zolas Protagonist ist ein junger Priester, der in Begleitung eines Pilgerzugs zur Erkenntnis gelangt, schwere Krankheiten würden die meisten Menschen ohne ihren Glauben gar nicht ertragen. Geschäftsleute und ein Teil des Klerus nutzten die Not der Gläubigen aus. Dem jungen Priester schwebt eine neue Religion vor, die nicht die Illusionen nährt, sondern vor allem materielle Gerechtigkeit herstellt.
Indem Zola die „Wunder“ auf Hysterie und Autosuggestion zurückführt, greift er auf die Suggestionstheorie des Pathologen und Neurologen Jean-Martin Charcot zurück. Huysmans wendet sich in dem Kapitel „Die Wunderheilungen: Für und Wider“ seines Lourdes-Buchs gegen Zola und Charcot und argumentiert, Wunderheilungen wirkten auch bei Personen, die im Zustand der Bewusstlosigkeit nach Lourdes gebracht worden seien oder bei Säuglingen, die sicherlich keiner Suggestionen anheimgefallen sein dürften. Es habe nachweislich in Lourdes auch Heilungen abseits der Massenveranstaltungen, der großen Messen, der Prozessionen gegeben. Huysmans geht davon aus, dass wesentlich mehr Wunder geschehen sind als beim Konstatierungsbüro in Lourdes gemeldet und „amtlich“ anerkannt wurden.
Ratio und Glaube schließen sich nicht aus
Huysmans zitiert einen „bewundernswerten Mönch“, der über seine Ordensbrüder zu ihm sagte: „Gott segnet sie nicht mehr, sobald sie vernünfteln!“ Das mag an den Kirchenlehrer Petrus Damiani (um 1006–1072) erinnern, für den das Denken seinen Ursprung im Teufel hat und vor Gott nichts gilt. Für den jedoch, der es gewohnt ist, Ratio und Glauben als gewisse Gegensätze aufzufassen, mag bei der Lektüre von Huysmans‘ Lourdes-Buch die Entdeckung verblüffen, wie wenig sich für ihn vernünftige Analysen und tiefe Frömmigkeit ausschließen. Das wird gerade im Kontrast zu manchen seiner Zeitgenossen deutlich. Bei Monsieur Teste beispielsweise, dem überragenden Intellektuellen, den Paul Valéry ungefähr zeitgleich erschaffen hat, ist es die Ehefrau Emilie, die feststellt, ihr Mann habe das Wesen ihrer inbrünstigen Seele perfekt erforscht und verstehe ihre Gläubigkeit treffend zu erläutern, doch fehle seiner Nachbildung das Eigentliche: die Hoffnung. Es gibt kein Körnchen Hoffnung im ganzen Wesen von Herrn Teste.
Maria als tatsächlich Handelnde
Bei Huysmans dagegen, wenn er auch seine Epoche verabscheute, war Hoffnung in großem Maße vorhanden, bis hin zu einer Wundergläubigkeit, die aufgeklärten Menschen naiv erscheinen mag. Im Sinne mittelalterlicher Frömmigkeit ist es für ihn eine Realität, dass die vom Konstatierungsbüro geprüften und anerkannten Wunderheilungen einen übernatürlichen Ursprung haben. Er betrachtet Maria als ein tatsächlich handelndes, in die Geschicke der Menschen eingreifendes Wesen. „Es ist übrigens vernünftig, in diesem Heilmittel (hier geht es um das Wasser der Quelle) nur eines derjenigen zu sehen, die von der Jungfrau nach ihrem Willen angewendet werden, denn oft wählt sie es auch nicht.“ Auch in seiner Beschreibung der geschichtlichen Vorläufer von Lourdes ist es Maria, die den Ort bestimmt, in dem sie sich niederlässt. „Die Jungfrau zog von den Alpen in die Pyrenäen, und dort erschien sie nicht auf einem Berggipfel, sondern am Fuß eines Berges in einer Grotte, als ob sie näher herbeikommen wollte in irdische Reichweite.“
Ohne den festen Glauben an Heilung gäbe es keinen solchen Wallfahrtsort. Nicht als ein Standbild, sondern als eine Person, mit der man reden kann und die sie hört, betrachten auch die Pilger die Jungfrau Maria. Wenn Bitten allein nicht hilft, wollen sie mit ihr verhandeln; sie rechnen die eigene Hingabe gegen das von einer solch aufwendigen und kostspieligen Reise erwartete Wunder auf, verlangen „für ihren derartig großen Glauben, ihre Geduld und ihren Mut“ eine „Gegengabe“. Und der Autor schließt sich ihrem Hadern mit der Gottheit an: „Was tut sie denn, für die es doch so einfach wäre, all diese Menschen zu heilen?“
Sinngebung des Schmerzes
Dann aber weist Huysmans‘ große Belesenheit überraschend auf ein Paradoxon hin, das sich für den frommen Christen aus dem Wunsch nach Heilung ergibt. Er erinnert an eine vor allem im 14. und 15. Jahrhundert epochentypische Richtung des Katholizismus, die sich „Dolorismus“ nennt. Ihre Anhänger sahen sich in der Nachfolge Christi als „Schmerzensmann“ und glaubten, durch eigenes Leiden Christi Werk, das Leiden für die Menschheit, fortsetzen zu können – gemäß Paulus‘ Brief an die Kolosser 1,24, in dem es (in der Übersetzung Martin Luthers) heißt: „Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde.“ Mit einer solchen mystischen Haltung wäre es, wie Huysmans bemerkt, inkonsequent, sich in Lourdes die Befreiung vom Leiden zu wünschen. Sie würde den Zweck der Wallfahrt ad absurdum führen – „denn letztlich müsste man vor der Grotte statt der Linderung seiner Leiden ihre Verschlimmerung erbitten, um sie als Sühneopfer für die Sünden der Welt anzubieten! Lourdes wäre so gesehen die Zentrale menschlicher Feigheit.“ Huysmans nimmt damit vorweg, was in Peter Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft als „Algodizee“ auftaucht, in dem Fall eine apologetische Sinngebung des Schmerzes.
Huysmans‘ Lourdes-Buch ist das stilistische Meisterwerk eines außergewöhnlichen Autors, der ebenso aus seiner Zeit fiel, wie er vermutlich in keine Epoche gepasst hätte. Mit einem erhellenden, kenntnisreichen Nachwort des Übersetzers Hartmut Sommer liegt uns die erste deutsche Ausgabe in der schön gestalteten Reihe der Lilienfeldiana endlich vor.
Huysmans, Joris-Karl: Lourdes – Mystik und Massen. Aus dem Französischen übersetzt und mit einem Nachwort von Hartmut Sommer, mit historischen S/W-Fotografien, Lilienfeld Verlag, Düsseldorf, 2020 (Reihe: Lilienfeldiana, Band 23), 320 Seiten, 22 Euro.