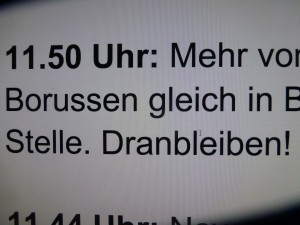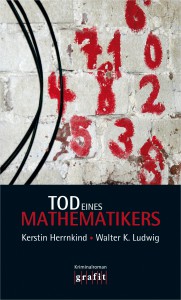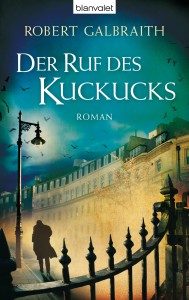Wozu denn der ganze Zinnober? – Zwei Jahre als Autor beim Netzwerk „Seniorbook“
Zwei Jahre lang habe ich nebenher Texte für den Münchner Internet-Auftritt seniorbook.de verfasst. Jetzt habe ich mich dort per Mail als Autor verabschiedet; leichten Herzens und aus guten Gründen.
Dabei fing damals alles recht manierlich an. Vorwiegend habe ich Beiträge über TV-Sendungen geschrieben. Warum nicht? Das haben wir ehedem bei der Zeitung in langjähriger Übung praktiziert; vielfach auch in Form der schnellen Abend- und Nachtkritik. So auch jetzt.
Die Idee, ein soziales Netzwerk für gereifte Leute (worunter „50 plus“ verstanden werden sollte) aufzuziehen, fand ich zudem gar nicht übel und sogar zukunftsträchtig. Nicht zu vergessen: Die Honorare pro Artikel gingen in Ordnung.
Ein Bauunternehmen im Hintergrund
Ein wenig stutzig wurde ich allerdings, als ich hörte, dass hinter dem Auftritt eine Baufirma steht, die u. a. Seniorenresidenzen errichtet. Man muss kein Schelm sein, um sich dabei was zu denken. Nun, so lange man ihnen nicht nach dem Munde schreiben muss…
Die Seniorbook-Mitarbeiterin, die mich angeworben hat, war als Journalistin und Netzadministratorin ausgesprochen fähig. Damals konnte man von einer ebenso freundlichen wie vernünftigen und zielgerichteten Autorenbetreuung reden. Sie ließ einem weitgehend freie Hand. Absprachen wurden beiderseits stets eingehalten. Es war zeitweise eine Freude. Die Zahl der Klicks und Zugriffe konnte sich sehen lassen. Seinerzeit gewährte man den Autorinnen und Autoren noch einen Einblick in diese statistischen Daten und hielt sie ständig auf dem Laufenden über die Mitgliederzahlen des Netzwerks. Gut für die Selbsteinschätzung.
…und dann kam der „Vorstand“
Doch leider verließ besagte Community-Managerin nach einigen Monaten das Haus, um sich Besserem zuzuwenden. Und wie es so oft in derlei Fällen geschieht: Damit änderte sich praktisch alles zum Nachteil. Die Bühne betrat nun jemand, der sich volltönend als „Vorstand“ bezeichnete und allzeit mit dem Wort „viral“ um sich warf. Alles müsse „viral“ sein. Gute Genesung kann man da nur wünschen.
Mit ihm wehte alsbald ein anderer Wind. Er ließ rasch die besagte Möglichkeit der statistischen Selbstkontrolle kappen. Ganz klar, man sollte nicht mehr mit Fug behaupten können, ein Beitrag sei gut gelaufen. Dass außerdem jede Möglichkeit unterbunden wurde, Autoren untereinander kommunizieren zu lassen, versteht sich beinahe von selbst. Teile und herrsche. Das uralte Prinzip der Macht-Männchen.
Statt dessen drängten sie einen, sich zusätzlich beim Netzwerk Google+ anzumelden und beide Profile zu verknüpfen, auf dass man mit Autorenbild in den Google-Fundstellenlisten erscheinen sollte. Welch‘ substanzielle Neuerung! Dumm nur, dass Google die Funktion kurz darauf tilgte.
Anbetung der Suchmaschine
Heilig war nun die besinnungslos gehandhabte Suchmaschinen-Optimierung. Gleich nach Einführung der neuen Leitlinien wurde einer meiner Texte im Sinne der maschinellen Auffindbarkeit dermaßen idiotisch verhunzt, dass praktisch in jedem Satz der Name eines bestimmten TV-Promis vorkam; völlig penetrant, ohne jegliche Variation. Das las sich hanebüchen – und stammte absolut nicht mehr von mir. Selbstverständlich habe ich mich beschwert. Fortan wurden meine Texte nicht mehr angetastet. Immerhin.
Ein weiterer Hebel setzte bei der Unterstützung der Autoren an, die nunmehr praktisch entfiel. Beiträge verliefen im Sande – ohne besondere, netzaffine Aufbereitung, geschweige denn, dass sie den Usern empfohlen worden wären. Wozu dann überhaupt der ganze Zinnober? Wozu noch Autoren? In der Tat kann man sich ja fragen, ob ein soziales Netzwerk Autorenbeiträge braucht – oder ob ein bisschen Trallala-Animation reicht.
Talkshows bis zum Abwinken
Eigentlich überflüssig zu erwähnen, dass die anfänglich bewusst seriöse Ausrichtung, in deren Rahmen sich ein besonderes Augenmerk auf die Kulturkanäle 3Sat und arte richtete, sich jetzt flugs erledigt hatte. Überhaupt wurden plötzlich ganz andere, ja geradezu gegenteilige Themenparolen ausgegeben. Was bis dato ein Schwerpunkt war, sollte gefälligst unterbleiben: Keine „Tatorte“ mehr besprechen (die werden ja auch nur von ein paar Millionen Menschen gesehen); statt dessen sollten Talkshows (immer und immer wieder Jauch & Co.) mit ihrem ewiggleichen öden Gästefundus in den Mittelpunkt rücken; übrigens mit der Maßgabe, die „eigene“ Meinung provozierend zuzuspitzen und also geradewegs zu manipulieren. Einen solchen Mist habe ich noch nie mitgemacht.
Haufenweise Pegida-Fans
Doch auch so kamen derart viele Kommentare à la Pegida (avant la lettre) oder AfD, dass man diese Phänomene geradezu hat anrücken sehen können. Abenteuerliche Verschwörungstheorien zuhauf, Misstrauen gegen alle Medien inbegriffen, üble Beschimpfungen von „Gutmenschen“ und Minderheiten als Krönung. Die Mischung also, die man inzwischen bis zum Erbrechen kennt. Echte Diskussionen waren zwecklos. Redaktionell moderiert wurde ohnehin kaum. Lass laufen…
Nun ja. Man kann es sich denken: Spätestens nach drei Jauch-Ausgaben hat sich das Ganze als ernsthaftes Rezensionsthema erledigt, eigentlich auch schon vorher. Daneben durfte ich hin und wieder TV-Nostalgie bedienen, indem ich mir Jahrzehnte alte Sendungen noch einmal zu Gemüte führte. Das hatte ja immerhin noch was und war einigermaßen zielgruppengerecht.
Komplette Konfusion
Doch Sinn und Verstand hatte das konfuse Konzept schon längst nicht mehr. Zu Beginn des neuen Jahres wurden über Nacht sämtliche Film- und Fernsehthemen komplett abgeschafft. Einfach mal so. Es reicht ja auch, wenn man mit den Senioren ein bisschen über Gesundheit, Partnerschaft, Haustiere und Gartenfreuden plaudert. Viel Spaß noch dabei!