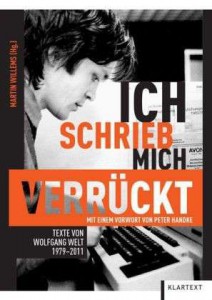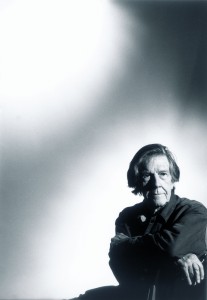Das politische Spiel (WDR-Fernsehen, 20.15 bis 21.45 Uhr) in der „Wahlarena“, übertragen aus Mönchengladbach, hat 90 Minuten gedauert. Und was ist da rund gewesen?
Das Publikum ist von infratest/dimap nach repräsentativen Gesichtspunkten ausgewählt worden. Immer wieder werden Befragungsergebnisse eingeblendet. Volkes Stimme. Pflichtschuldigst zelebriert und rasch abgehakt.
Einstiegsfrage nach dem Umgang mit den Benzinpreisen.
„Wir müssen weg vom Öl“, sagt Sylvia Löhrmann (Grüne). Ein schöner Satz. Sagt sich schnell.
Arena = Gladiatoren? Ach was! Es bleibt so zahm.
Mal wieder ein grausliches Studiodesign. Und eine wahrhaft fahrige Kameraführung. Bloß nirgendwo verweilen.
Norbert Röttgen (CDU): „Unsere Antwort heißt Elektro-Mobilität.“ Folgt eine kleine Fensterrede gegen die Ölkonzerne. Den kleinen Pendler dürfe man nicht – na? na? – „im Regen stehen lassen“.
Hannelore Kraft (SPD): „Ölkonzerne in den Griff bekommen.“ Auch das sagt sich flott. Wie denn überhaupt in dieser Sechserrunde (Arena) noch ungleich holzschnittartiger argumentiert wird als bei einem Duell. Doch früher hat es noch mehr gestanzte Sätze und betonierte Meinungen gegeben.
Joachim Paul (Piraten): Zur Pendlerpauschale wird eine Position „noch entwickelt…“ – „Wir Piraten kopieren gerne“ (z. B. Ideen aus anderen Ländern). Ein wohlfeiler Lacher.
Mehr oder weniger sprechen sich alle für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs aus, die Piraten wollen auf Fahrscheine verzichten. Und wer bezahlt’s?

Freie Farbenwahl (Foto: Bernd Berke)
Thema Haushalt/Schulden
Christian Lindner (FDP): „Der Staat soll bescheiden sein.“ Die Wirtschaft muss schneller wachsen als der Staat. Ach, es gibt sie noch, die alte Tante FDP.
Kraft: Nicht zu Lasten der Kommunen sparen. Nicht zu Lasten der Kinder sparen. Und bloß nicht sagen, auf wessen Kosten man sparen will (gilt für alle).
Hier reden, so könnte man meinen, wandelnde Wahlplakate. Talking Heads.
Röttgen (CDU): Sparen mit uns ginge weitgehend schmerzlos. 2 Prozent der Subventionen einsparen, das täte nicht weh. Rotgrün geht euphorisch mit Steuereinnahmen um = verprasst das Geld. Vier Ausnahmen beim sparen: Familie, Schule, Kultur… (juchhu! Es hat einer Kultur erwähnt). Da vergisst man glatt die vierte Option. Röttgens traditionelle Suggestion: Sozis können mit Geld nicht umgehen.
Schwabedissen (Linke): Privaten Reichtum abschöpfen. Keine Kürzungsorgien im Haushalt.
Paul (Piraten): Bedingungsloses Grundeinkommen prüfen (auch fahrscheinfreies Fahren sollte just „mal ausprobiert“ werden). „Es gibt Überlegungen in Richtung Vermögenssteuer“… Aha. Und wohin führen die wohl eines fernen Tages?
Lindner: Rotgrüne Verschuldungspolitik wird zur Staatsphilosophie erklärt. „Legende der guten Schulden“ beenden…
Thema Arbeit/Löhne
Lindner (FDP): Bloß keinen Überbietungswettbewerb in Sachen Mindestlohn, etwa zwischen Gabriel und Gysi. Das führt nur zur höheren Arbeitslosigkeit.
Löhrmann (Grüne): Unterste Linie 8,50 Euro pro Stunde.
Kraft (SPD): „Auch da gilt es, klare Kante zu zeigen.“ (SPD-Wahlplakat „Klare Kante Kraft“)
Röttgen (CDU): Tarifparteien haben Vorrang.
Schwabedissen (Linke): 10 Euro Mindestlohn. Gewonnen! Ihr Lieblingswort: „absurd“.
Paul (Piraten): Für bedingungsloses Grundeinkommen. Kostet den Staat keinen Euro mehr = Nullsummenspiel. Es sollte wenigstens „mal untersucht“ werden. Dann übt mal schön.
Kraft (SPD): Arbeit ist wichtig für die Würde des Menschen. Wer könnte da widersprechen?
Der unvermeidliche Moderator Jörg Schönenborn würgt die laufende Debatte nach Minutenschema ab.
Thema Bildung/Kinder
Löhrmann (Grüne): Für Ausbau der Kitas und Verbesserung der Kitas. Das unsägliche „Betreuungsgeld“ einsparen und in Kitas stecken. Gegen aufgezwungene Kita-Pflicht. Doch wenn die Kitas gut sind, wären die Eltern schlecht beraten, wollten sie ihre Kinder nicht hinschicken. Statements wie aus dem Wahlomaten.
Lindner (FDP): Gegen Betreuungsgeld (hat aber im Bundestag dafür gestimmt).
Schwabedissen (Linke, zweifache Mutter): Für 150 Euro „Herdprämie“ lässt sich kein Kind erziehen. Kita sollte generell gebührenfrei sein. Auch für Millionäre?
Röttgen: 60-70% der Eltern lassen ihre Kinder in den ersten zwei Jahren ohnehin zu Hause. Die sollten gefördert werden – bei völliger Wahlfreiheit zwischen den Lebensmodellen. Ansonsten ist alles „in der Diskussion“ (hört sich in der faserigen Offenheit fast nach Piraten an).
Kraft (SPD): Wer Betreuungsgeld zahlt, glaubt wohl, er müsse keine weiteren Kita-Plätze schaffen…
Lindner (FDP): Erhalten Leute, die nicht in die Oper gehen, dann auch einen Scheck? (Juchhu, noch einer hat Kultur erwähnt – wie grinsbereit auch immer)
Paul (Piraten): Wir müssen erst mal kompetente Menschen befragen… Wir haben nicht auf alles eine Antwort, stellen aber die richtigen Fragen.
Lindner: Rotgrün trocknet Gymnasien in punkto Ganztagsbetreuung und Klassengrößen aus.
Löhrmann, Kraft & Röttgen (!) widersprechen gemeinsam. Oh, einsame FDP.
Schwabedissen (Linke): „Eine Schule für alle“ statt dieser chaotischen Schullandschaft.
Paul (Piraten): „Wir sind keine Linke mit Internet-Anschluss.“ Ein bis zwei Dutzend Schulen sollen neue Modelle erproben… Verwaltungskräfte einstellen, um Lehrer zu entlasten. Alle Lerninhalte digital vorhalten.
Schlussrunde/Koalitionsaussagen
Lindner (FDP): Wahrscheinlich ist eine große Koalition. Wir sind dann Opposition. Prinzip Hoffnung.
Kraft (SPD): Es wird wohl für Rotgrün reichen. Kann trotz vieler Nachfragen die Piraten nicht so recht einschätzen.
Paul (Piraten): Wir würden gern auf der Oppositionsbank lernen. Darüber hinaus jetzt keine Aussage.
Röttgen (CDU): Dies ist kein Lagerwahlkampf. Auch überraschende Koalitionen sind denkbar. Die Demokratie wird bunter.
Löhrmann (Grüne): Rotgrün bevorzugt.
Schwabedissen: Wer will, dass die SPD sozialdemokratisch ist und die Grünen ökologisch sind, muss die Linke wählen. Gut auswendig gelernt.
Und das Fazit? Diffus. Um das Mindeste zu sagen. Röttgen und Lindner rhetorisch gar nicht mal übel, aber mit ihren Positionen z. T. auf verlorenem Posten. Auch die Vertreterin der Linken gewandter als so manche ihrer NRW-Kollegen. Piraten bitte ein paar Jahre lang hinten anstellen und erst mal Positionen klären. Themen, bei denen die Grünen gern volkserzieherisch werden (Ökologie, Rauchverbot etc.), kamen kaum zur Sprache. Ich persönlich weiß immer noch nicht recht, was und wen ich am 13. Mai wählen soll. Zwischenzeitlich hatte ich schon erwogen, dem Wahllokal erstmals gänzlich fernzubleiben. Aber das darf ja wohl nicht wahr sein.