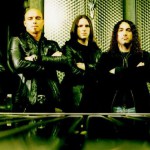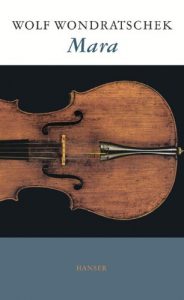Davon weiß man als Hörer und Konzertbesucher nichts: Viele, sehr viele Musiker spielen sich krank. Und: Häufig kommt im Klassik-Bereich der Missbrauch von Tabletten oder Alkohol vor. Solche dringlichen Probleme behandelt die Musikmedizin, die als eigenständige Disziplin noch recht jung ist. Nachgefragt beim Berliner Professor Helmut Möller, einem führenden Vertreter dieser Fachrichtung.
Musikalische Talente und Routiniers so etwa zwischen 12 und 60 kommen in Möllers Sprechstunde. Erst kürzlich saß ein junger Freund und Kollege des chinesischen „Wunderpianisten” Lang Lang dort; völlig verzweifelt, weil er den eigenen Ansprüchen nicht mehr zu genügen glaubte. Die psychosomatischen (leiblich-seelischen) Symptome dürften auch daher rühren, dass dieser Mann sich ständig am weltweiten Erfolg seines Freundes misst.
Damit sind wir schon bei einem Kernpunkt. In kaum einem Beruf ist die Konkurrenz so unerbittlich und täglich spürbar wie in der so genannten E-Musik. Prof. Möller über den Dauerstress: „Die meisten beginnen ungefähr im sechsten Lebensjahr mit dem regelmäßigen Üben. Es folgen immer neue Prüfungen im direkten Vergleich mit anderen. Nach vielen Jahren harter Arbeit dürfen diese Musiker dann ein paar Minuten vorspielen, falls eine Orchesterstelle frei ist – und da heißt es fast immer: ,Nein, danke. Der Nächste bitte!’”
Etliche Orchester sind eingespart oder verkleinert worden. Folge: Auf eine Stelle bewerben sich heute etwa 50 bis 70 Musiker. Zusätzliche Konkurrenz kommt aus Osteuropa und Ostasien – Musiker, die noch härter gedrillt worden sind und oft den Vorzug erhalten. Der Verdrängungswettbewerb ist gnadenlos wie nie – und macht zahlreiche Bewerber krank. Rund 25 bis 30 Prozent, so wird geschätzt, greifen zu Tabletten oder Alkohol. Tendenz offenbar steigend.
Im Tourneefilm „Trip to Asia” der Berliner Philharmoniker geschah das Ungeahnte: Ein Soloklarinettist sprach freimütig über berufsbedingte Ängste und sein Alkoholproblem. Seitdem ist das bisher strenge Tabu (Möller: „Musiker reden sonst nicht darüber – auch nicht untereinander”) ein wenig porös geworden.
Nicht gegen gewöhnliches „Lampenfieber” („Das gehört unbedingt dazu”), wohl aber gegen leistungsmindernde Formen der Auftrittsangst verschreibt Möller gelegentlich Beta-Blocker, die Herz und Kreislauf beruhigen. Allerdings nicht jahrelang, sondern für eine gewisse Zeit. Möller: „Dazu stehe ich.”
Manchmal möchte der Experte am liebsten frühzeitig von einer Musikerlaufbahn abraten. Dann sucht er das Gespräch mit Eltern und Musiklehrern. Doch einige Eltern seien im Namen ihrer Kinder so verbissen ehrgeizig, dass selbst das behutsamste Zureden fruchtlos bleibe. Der Professor: „In solchen Fällen muss ich äußerst vorsichtig sein, sonst wird mir ein Prozess angehängt – weil ich den Kindern angeblich seelische Schäden zugefügt habe.” Dabei könnte ein Abschied von überzogenen Karriereträumen wohl oft lebenslange Leiden verhindern.
Unverkennbar sind jedenfalls gewisse Parallelen zum Hochleistungssport. Musik- und Sportmedizin arbeiten denn auch eng zusammen. Lehre von der Skischanze: Wer einmal böse gestürzt ist, soll nicht gleich wieder auf den Turm steigen. Desgleichen ein Musiker, der beim Konzert „versagt” hat. Bloß nicht schon in ein paar Tagen den nächsten Auftritt riskieren!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FRAGE UND ANTWORT:
Welches sind die häufigsten Krankheiten bei Musikern?
– Akute Auftrittsangst, die sich leistungsmindernd auswirkt und damit einen „Teufelskreis” auslöst.
– Gehörschäden (für deren Abwehr es inzwischen strikte Orchester-Richtlinien gibt).
– Schädigungen des Muskel-Skelett-Systems: vor allem Schultergürtel, Hände, Hals.
– Spezielle Leiden wie Stimmbandentzündung (Sänger), Kieferprobleme (Bläser).
Wodurch werden Muskeln und Skelett geschädigt?
Von Musikern wird eine äußerst feine Motorik verlangt. Bereits eine geringfügig falsche Haltung kann zu bleibenden, schmerzhaften Verspannungen führen.
Welchen Fehler sollte man möglichst vermeiden?
Prof. Möller warnt prinzipiell davor, täglich mehr als vier Stunden zu üben. „Alles, was darüber hinausgeht, hat keinen vernünftigen Effekt mehr – ganz im Gegenteil.”
Sind Medikamente gegen die Auftrittsangst ratsam?
Gegen bestimmte Formen der Angst und nach eingehender ärztlicher Beratung: eventuell ja. Allerdings nur für einen kurzen Zeitraum.
Was tun berühmte Spitzenmusiker, um etwa ihren Tourneestress zu mildern?
Einige treiben zwischendurch maßvoll Sport, andere schwören auf Yoga und ähnliche Entspannungstechniken. Außerdem zeichnen sich viele Stars dadurch aus, dass sie ohnehin eine günstige Disposition (Veranlagung) haben und Stress besser „wegstecken”.
Was ist sonst noch wichtig beim Vorbeugen?
Unverzichtbar ist Regelmäßigkeit. Mediziner empfehlen, Teile des Tagesablaufs zu „ritualisieren”. Also: Stets zur gleichen Zeit ein wenig Sport oder Meditation, nicht nur ab und zu.
Betreffen Probleme und Ratschläge nur Profi-Musiker?
Keineswegs. Sie gelten auch für mehr oder minder ambitionierte Amateurmusiker, also für Zigtausende (mit Einschränkungen auch schon für Kinder).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
WEITERE INFOS:
- Nächster Kongress zur Musikermedizin: 10. und 11. Oktober an der Musikhochschule Köln. Das Tagungsmotto lautet: „Was hält Musiker gesund?”
- Weiterführende Informationen gibt es vor allem bei der 1994 gegründeten Deutschen Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin. Auf deren Internet-Seite finden sich auch Literaturlisten und etliche Link-Verknüpfungen zum Thema:
http://www.dgfmm-online.de/