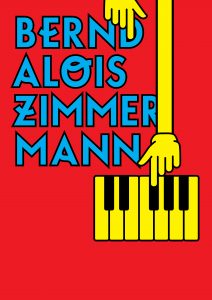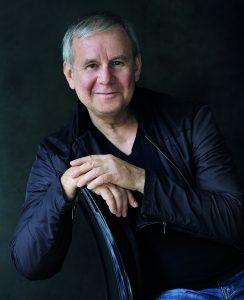Jacques Offenbach um das Jahr 1870, Reproduktion Rheinisches Bildarchiv Köln
Jacques Offenbach ist kein Unbekannter: Wer jemals die Barcarole aus „Hoffmanns Erzählungen“ gehört hat – und sei es nur als Werbe-Untermalung – wird die träumerisch-irisierende Melodie nie mehr vergessen. Wer nur einmal den Sog des Cancan aus „Orpheus in der Unterwelt“ gespürt hat, wird die Beine nie mehr ruhig bekommen.
Und dennoch: In seinem 200. Geburtsjahr 2019 ist der Kölner „Judenpursch“, der in Paris eine märchenhafte Karriere gemacht hat und nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 unter vielen Anfeindungen einen Absturz erleiden musste, als Komponist immer noch lückenhaft erschlossen, als Mensch oft nur als Klischeefigur präsent und in seiner Wirkungsgeschichte in längst nicht allen Aspekten beleuchtet. Von seinen zwischen gut 100 bis 140 geschätzten Werken für die Bühne sind höchstens zehn Prozent hin und wieder präsent, für viele gäbe es nicht einmal Noten- oder gar Aufführungsmaterial.
Motto des Festjahres in Köln: „Yes, we cancan“
Mit einem groß angelegten Festjahr will die Stadt Köln ihren wohl bedeutendsten musikalischen Sohn neu ins Bewusstsein rücken. Zahlreiche Partner bringen Mittel und Know-how ein, allen voran die Kölner Offenbach-Gesellschaft, das Land Nordrhein-Westfalen, Förderer aus der Wirtschaft, den Medien und der Kultur – und auch die Katholische Kirche. „Yes, we cancan“, ist das Motto des Jahres, das den „Erfinder der Operette“ endlich als einen der großen Komponisten des 19. Jahrhunderts öffentlich wirksam machen will.
 Das tut not: Denn während etwa Richard Wagner omnipräsent auf der Bühne und in der Literatur ist, Werk und Person in nahezu allen Details ausgeleuchtet und kontrovers diskutiert sind, während sich Gioachino Rossini weltweit und immer mehr auch im deutschen Sprachraum steigenden Interesses erfreuen kann, während Giacomo Meyerbeers epochemachende Opern gerade in aufregenden Inszenierungen neu entdeckt werden, steckt eine umfassende Offenbach-Rezeption noch in den Anfängen.
Das tut not: Denn während etwa Richard Wagner omnipräsent auf der Bühne und in der Literatur ist, Werk und Person in nahezu allen Details ausgeleuchtet und kontrovers diskutiert sind, während sich Gioachino Rossini weltweit und immer mehr auch im deutschen Sprachraum steigenden Interesses erfreuen kann, während Giacomo Meyerbeers epochemachende Opern gerade in aufregenden Inszenierungen neu entdeckt werden, steckt eine umfassende Offenbach-Rezeption noch in den Anfängen.
Auch die seit 20 Jahren beim Verlag Boosey & Hawkes laufende monumentale Offenbach- Edition Jean-Christophe Kecks änderte das nur zeitweise und in einigen prominenten Fällen. Noch bis vor kurzem gab es Theater, die selbst Offenbachs Hauptwerk „Les Contes d’Hoffmann“ und seine bahnbrechenden Operetten nach altem, heutigen kritischen Standards nicht genügendem Material spielten.
Sein Musiktheater war für das Hier und Jetzt gedacht
Das hat vielfältige Gründe: Offenbach verstand sich nicht, wie Wagner, als Schöpfer überzeitlich gültiger Werke, sondern produzierte für sein Hier und Jetzt, für die Gesellschaft des französischen Zweiten Kaiserreichs. Sein Stern sank nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71, nach dem er in Frankreich wie in seinem Heimatland Deutschland gesellschaftlich angefeindet wurde und den zunehmenden Antisemitismus zu spüren bekam.
Offenbach konzipierte sein Musiktheater neu, setzte auf märchenhafte, opulent ausgestattete Féerien. Seine zeitaktuellen, satirischen Werke hatten ihre große Zeit hinter sich. Spätere Generationen konnten nichts mehr damit anfangen. Die Kritik konzentrierte sich im Schatten Wagners auf die angeblich „seichte“ Musik und übte sich in moralischer Empörung.
Die großen Erfolgsoperetten degenerierten zu harmlos-heiteren Vergnügungen. Nationalismus und Antisemitismus als treibende Kräfte sorgten dafür, dass gerade die politisch-satirische Seite seines Œuvres, die schon zu seinen Lebzeiten von der Zensur klein gehalten wurde, auf den Bühnen kaum eine Chance mehr hatte.
In alle Winde verstreutes Material
Dass „Orpheus in der Unterwelt“ oder „Pariser Leben“ als relativ viel gespielte Werke nicht nur burleske Parodien der versunkenen Antike oder einer historisch gewordenen Gesellschaft sind, sondern aufmüpfiges Potenzial haben, wurde zwar seit den siebziger Jahren wieder entdeckt. Aber die Nach-68er-Kultur suchte sich andere Ausdruckswege als ausgerechnet Operetten.
So erfreute sich Offenbach zwar eines gewissen Respekts, der sich aber – so jedenfalls in der Erinnerung – nicht in Zahl und Qualität der Aufführungen niederschlug. Dazu kommt die Abwertung der Gattung Operette in den letzten Jahrzehnten, die zwar vor allem dem – seit der Nazizeit geförderten – sentimentalen Genre galt, aber dafür sorgte, dass die Sparte des unterhaltsamen Musiktheaters an den meisten Theatern auf eine oder zwei Produktionen pro Spielzeit schrumpfte, wenn sie nicht ganz aufgegeben wurde, und die spezialisierten Ensembles verschwanden. Und ein Problem ist auch die archivalische Überlieferung: Das Material ist in alle Winde verstreut, nicht zugänglich oder überhaupt nicht bekannt.
Das Problem mit der Aktualisierung
Zu ihrer Zeit waren Jacques Offenbachs Operetten – präziser ist der Begriff der opéra bouffe – topaktuell. Deswegen klappt es mit der Modernisierung meistens nicht. Zwischen laschem Historismus und bemühter Zeitgenossenschaft führt eine tückische Straße geradewegs in Belanglosigkeit, glitschig gepflastert mit groben Gags oder völlig überdreht in den Klamauk abdriftend. Offenbach zu inszenieren gehört in die Königsklasse des Regiehandwerks, und an Figuren wie der Großherzogin von Gerolstein mit ihrer zweifelhaften Entourage oder König Bobèche („Barbe-bleue“) in den Gedärmen seiner Macht scheitern Regisseure unter Umständen erbärmlicher als an Parsifal oder Elektra.

Derzeit in Hagen im Spielplan: Jacques Offenbachs „Pariser Leben“. Die Regie von Holger Potocki lässt das nostalgische Paris nur noch als Zitat zu. Veronika Haller und Kenneth Mattice als Ehepaar Gondremarck in der Aufführung in Hagen. Foto: Klaus Lefebvre
Christoph Marthaler hat in Basel an „La Grande-Duchesse de Gérolstein“ vorgeführt, was es heißt, die Figuren Offenbachs in ihren ambivalenten Charakteren ernst zu nehmen, ohne Humor, Ironie und Parodie zu verraten. Und auch an kleineren Theater gelingt der eine oder andere Offenbach-Abend, etwa jüngst in Hagen, wo Holger Potocki in „Pariser Leben“ jede Form von Historismus meidet und das damals aktuelle, heute historisch-nostalgisch verklärte Paris nur als sanft ironisches Zitat zulässt.
Der „Sittenverderber“ aus dem frivolen Paris
Inzwischen passé sind die Argumente gegen den Meister des satirischen Humors, wie sie nicht zuletzt in kirchlichen Kreisen lange vorgebracht wurden: Offenbach als „Sittenverderber“ stand für ruchloses Treiben auf (und wie geargwöhnt hinter) der Bühne, für verdammenswerte sexuelle Freizügigkeit, für das Verderben einer für unschuldig gehaltenen Jugend. Dazu hat Manuela Jahrmärker unter dem Titel „Vom Sittenverderber zum ewig klassischen Komponisten“ in einem lesenswerten Band von Rainer Franke über „Offenbach und die Schauplätze seines Musiktheaters“ zahlreiche Quellen gesammelt, die nicht nur das christliche Milieu betreffen.
Offenbach ist in seinem völlig säkularen Musiktheater in der Tat ein Komponist der Moderne. Aber über allen moralischen Verdikten wurde übersehen, wofür seine beißende Kritik steht: Er entlarvt die moralische Heuchelei, das Bemänteln von Machtwille, Gier, narzisstischer Egozentrik oder eiskaltem ökonomischem oder politischem Kalkül mit „höheren“ Werten. Er führt Machthaber und ihre subalternen Schmarotzer vor, die Staat und Gesellschaft, Regeln und Gesetze nur als Mittel verstehen, mit denen sie sich Macht oder Lust verschaffen. Der Jupiter in „Orphée aux Ènfers“ ist eben kein drollig parodierter antiker Gott, sondern ein Scheusal, das selbst die – moralisch nicht weniger fragwürdigen – Stützen seiner Macht gegen sich aufbringt.
Dass Offenbach in den wenigen stillen, sentimentalen Momenten die Sehnsucht seiner Figuren nach einer wahrhaftigen, menschlichen Welt durchschimmern lässt, in der vielleicht sogar echte Liebe möglich sei, gibt seinen Operetten einen zutiefst humanen Zug und lässt, was seine Kritiker meist übersehen haben, in der Verderbtheit seiner Welten die „Sehnsucht nach dem Heil“ durchscheinen – nur eben viel menschlicher als bei Wagner.
Entdeckungen auf den Spielplänen der Opernhäuser
Der Blick auf die Spielpläne der Opernhäuser bis Juli 2019 zeigt noch wenig von dem innovativen Impuls, den sich Kenner und Liebhaber Offenbachs vom Jubiläumsjahr erhoffen. Der Opern-Klassiker „Les Contes d’Hoffmann“ steht sowieso im internationalen Repertoire – so von Buenos Aires über Peking, Moskau und Wrocław bis Neapel, in Deutschland in Gera und Karlsruhe. Aber seine erst in jüngerer Zeit wiederentdeckte Oper „Les Fées du Rhin“ („Die Rheinnixen“) wird derzeit lediglich in Biel-Solothurn, sein „Fantasio“ nur in Montpellier und Eindhoven (ab Mai 2019, geplant ist auch ein Gastspiel in Köln) gespielt.
Die nie veröffentlichte, erst jüngst von Jean-Christophe Keck wiederentdeckte und publizierte köstliche Polit-Satire „Barkouf“ – ein Hund regiert als Vizekönig im indischen Lahore – erlebte im Dezember 2018 Strasbourg ihre moderne Erstaufführung und wird 2019/20 in Köln zu sehen sein. Und in Hannover treibt in einer weiteren bissigen Satire auf unfähige Herrscher und korrupte Cliquen „Le Roi Carotte“ sein Unwesen.
Seltenes kündigen auch die Pariser Bühnen an: das Théâtre des Champs-Elysées „Maître Peronilla“ und die Opéra Comique „Madame Favart“. Und mit Hilfe des Palazzetto Bru Zane, einem Zentrum für die Erforschung und Wiederentdeckung der romantischen französischen Oper, führt das Théâtre Marigny unter dem Titel „Bouffes Bru Zane“ von Januar bis Juni eine Serie von einaktigen Werken der opéra-bouffe auf.
Von der „Prinzessin von Trapezunt“ bis zum regierenden Hund „Barkouf“

Nur in Würzburg bis April und ab Mai 2019 in Hamburg wird im deutschsprachigen Raum derzeit Offenbachs Erfolgsoperette „La Belle Hélène“ gespielt. In Alexandra Burgstallers Ausstattung ist die fern gerückte Antike nur noch dekorative Assoziation. Foto: Nik Schölzel
In Deutschland zeigt das rührige Theater Hildesheim ab 3. März 2019 „Die Prinzessin von Trapezunt“. Andere beschränken sich bisher auf das, was von Offenbach in den Spielplänen überlebt hat: „Die Großherzogin von Gerolstein“ (Aachen, Halle, Köln), „Die schöne Helena“ (Hamburg, Würzburg), „Pariser Leben“ (Hagen, Trier) und „Orpheus in der Unterwelt“ (Bielefeld, Krefeld-Mönchengladbach, Mannheim, Oldenburg).
In Köln umfasst die Liste der Veranstaltungen in nächster Zeit eine Podiumsdiskussion am 22. Januar im Domforum mit dem Kölner PresseClub und dem Katholischen Bildungswerk, bei der das deutsch-französische Verhältnis im europäischen Kontext thematisiert wird. Das Institut Français in Köln eröffnet am 25. Januar eine Veranstaltungsreihe zum Offenbach-Jahr mit dem jungen Kölner Ensemble VivazzA. Das Konzert stellt Offenbach in den Kontext der Musik seiner Zeit.
„Divertissementchen“ zur Karnevalszeit
Ein Riesenspaß dürfte ab 2. Februar „Offenbach – ein Divertissementchen“ der Oper Köln werden, das die Karnevalszeit bis 5. März mit schmissiger Musik und Ballett-Choreografien auf die übliche Kölner Weise ausfüllen wird. Am 16. März nimmt die Kammeroper Köln ihre Produktion von „Orpheus in der Unterwelt“ wieder auf. Am 9. Juni feiert dann „La Grande-Duchesse de Gérolstein“ ihre Premiere in der Oper Köln. Ab 17. Juni zeigt die Volksbühne am Rudolfplatz in Köln zwei der hintersinnig-amüsanten Einakter: „Die Insel Tulipatan“ und „Salon Pitzelberger“. Und ab 19. Juni stehen Leben und Werk Offenbachs im Zentrum eines Symposions der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.
Info: https://www.yeswecancan.koeln/veranstaltungen





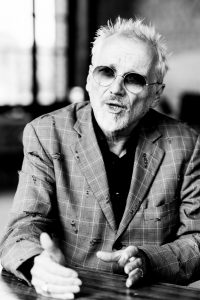


















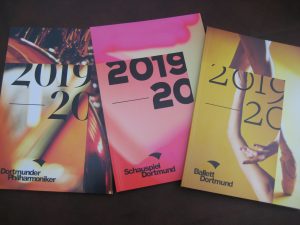


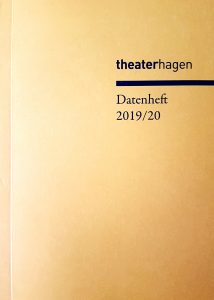

















































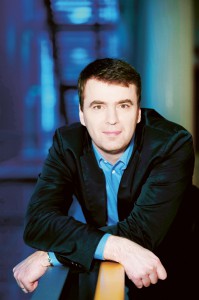


 Das tut not: Denn während etwa Richard Wagner omnipräsent auf der Bühne und in der Literatur ist, Werk und Person in nahezu allen Details ausgeleuchtet und kontrovers diskutiert sind, während sich Gioachino Rossini weltweit und immer mehr auch im deutschen Sprachraum steigenden Interesses erfreuen kann, während Giacomo Meyerbeers epochemachende Opern gerade in aufregenden Inszenierungen neu entdeckt werden, steckt eine umfassende Offenbach-Rezeption noch in den Anfängen.
Das tut not: Denn während etwa Richard Wagner omnipräsent auf der Bühne und in der Literatur ist, Werk und Person in nahezu allen Details ausgeleuchtet und kontrovers diskutiert sind, während sich Gioachino Rossini weltweit und immer mehr auch im deutschen Sprachraum steigenden Interesses erfreuen kann, während Giacomo Meyerbeers epochemachende Opern gerade in aufregenden Inszenierungen neu entdeckt werden, steckt eine umfassende Offenbach-Rezeption noch in den Anfängen.