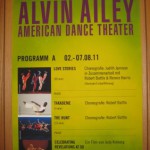Sommerfestival in Köln: Alvin Ailey American Dance Theater
„Rock my soul in the bosom of Abraham…“ – genau dies bot das Alvin Ailey American Dance Theater bei der Premiere des neuen Programms im Rahmen des Kölner Sommerfestivals. Sie rockten die Kölner Philharmonie, enthusiastisch gefeiert vom Publikum. Sechs lange Jahre ist es her, dass die Company zuletzt in Deutschland gastierte.
Viel hat sich seitdem getan. Judith Jamison, die langjährige, direkte Nachfolgerin Alvin Aileys, welche die Company zu weltweitem Ruhm führte, ist emeritiert, in einer persönlichen Wahl ernannte sie Robert Battle im Juni zum neuen Artistic Director, die Foundation bezog in New York ein neues, festes Zuhause und die Company wurde zum „Cultural Ambassador to the world“ ernannt. Spannend die Frage für langjährige Fans dieser einzigartigen Truppe: „Was hat sich getan, sich geändert?“ Die Antwort : Vieles und doch auch wieder nichts. Nichts – weil sie immer noch die Besten sind. Im Modern Dance war und ist das Alvin Ailey American Dance Theater das Maß aller Dinge. Technisch brillant, künstlerisch tief berührend. Vieles – weil sie Neues wagen und der Einfluss Robert Battles das Repertoire um aktuelle Einflüsse erweitert…
Das Alvin Ailey American Dance Theater tanzt vielschichtige Geschichten von Tragik und Freude, von menschlicher Leidenschaft. Getrieben von der Frage „Wo stehe ich und wohin gehe ich ?“ erreichen sie die Herzen der Menschen, durchdrungen vom Willen, für Verständigung und Brüderlichkeit über alle Grenzen hinweg einzutreten. Man vergißt es leicht und zeiht Amerika, kulturlos und oberflächlich zu sein, aber ein wesentlicher Bestandteil amerikanischer Kultur ist der Tanz. Amerika ist nicht nur die Wiege des Modern Dance, sondern auch das Land, in welchem der Tanz wie in kaum einem anderen westlichen Land gefördert und weiterentwickelt wird. Wegweisend seit über 50 Jahren ist das Alvin Ailey American Dance Theater. Nur folgerichtig, dass der US-Kongress dies 2008 würdigte und die Company offiziell zum „für die Welt lebendigen amerikanischen Kultur Botschafter der Vereinigten Staaten“ ernannte. Verbunden mit dem Auftrag, das Erbe der afroamerikanischen Kultur sowie des amerikanischen Modern Dance zu bewahren und weiterzuentwickeln.
Das Kölner Premierenprogramm eröffnete mit Love Letters. Eine von Judith Jamisons bedeutendsten Arbeiten, die sie zusammen mit dem HipHop-Pionier Rennie Harris und dem neuen Artistic Director Robert Battle neu choreographiert und überarbeitet hat. Die einzigartigen Stile der Choreographen verschmelzen nahtlos und vermitteln eine neue Botschaft, die den Bogen spannt vom dramatisch hingegebenen Modern Dance à la Martha Graham bis hin zu gewandelten heutigen Einflüssen afroamerikanischer Tänze.
Teil zwei des Programms gehört ganz dem Neuen. Robert Battle, dessen Neu-Einstudierungen mit Spannung erwartet und kritisch betrachtet wurden, enttäuscht nicht. In Takademie abstrahiert er die komplexen Formen des indischen Kathak Tanzes temporeich und verblüffend. In Hunt interpretieren sechs männliche Tänzer zur treibenden Trommelmusik der Les Tamours du Bronx ein archaisches Jagdzeremoniell. Bewusst durchbricht Battle die bisherige Linie des Alvin Ailey Repertoires und beschwört eine ganz neue Aggressivität im Tanz herauf. Der Zuschauer erlebt eine sehr maskuline, harte, aber auch kraftvolle Seite der Tänzer, die den Atem stocken lässt.
Im dritten Teil die Offenbarung. „Revelations“. Das Meisterwerk Alvin Aileys. Der Inbegriff des amerikanischen Modern Dance. Ein Klassiker, der bis heute von mehr Menschen in aller Welt gesehen wurde, als jedes andere Tanzstück des 20 Jahrhunderts. 50 Jahre alt sind sie geworden. Robert Battle hat bewusst entschieden, diesen Geburtstag zu zelebrieren und zu zeigen, dass man den grundlegenden Prinzipien Alvin Aileys weiterhin verpflichtet sein wird. So gehören die Offenbarungen zum Repertoire einer jeden Aufführung in diesem Sommer. Vorher wird dem Publikum ein eigens produzierter fünfminütiger Film der Emmy-preisgekrönten Regisseurin Judy Kinberg gezeigt, welcher die Entstehungsgeschichte und die Intention des Stückes beleuchtet.
Man kann die Revelations noch so oft gesehen haben, sie bleiben auch beim wiederholten Male eine Offenbarung. Universell gültig, heute so berührend und aktuell wie vor 50 Jahren, gewinnt es mit jedem neuen Tänzer, mit jeder neuen Aufführung an Kraft. Aileys „Geschenk an die Menschheit“ ist eine dreiteilige Reise auf den Spuren der Gospels und Spirituals seiner Heimat. Tänzerisch verschmelzen hier die Freiheiten des Modern Dance mit der Horton-Technik zu einer bis heute unerreichten Einheit, lebendig, mitreißend, anrührend und überschäumend zugleich. Dieses Stück hat etwas so Besonderes, so Einzigartiges, dass es den Zuschauer immer wieder neu tief im Herzen berührt.
Das von der ersten Minute an von der Mischung aus Altbewährtem und Neuem mitgerissene Publikum feierte die Tänzer am Ende so frenetisch, dass wir noch in den Genuss der Zugabe-Choreographie von „Rock my Soul“ kamen. Ich für meinen Teil habe sowohl die Company als auch die Revelations nicht zum ersten, aber ganz sicher auch nicht zum letzten Mal gesehen, übrigens zu gerne auch wieder mal im Rahmen der Ruhrfestspiele.
Für Alvin Ailey war Tanz „ein Medium, dass die Vergangenheit ehrt, die Gegenwart würdigt und der Zukunft mit Zuversicht begegnet.“ Ich bin sicher, er wäre stolz auf die Tänzer, die heute unter seinem Namen diese Botschaft in die Welt tragen. Sie ehren und wahren sein Erbe, sie würdigen gegenwärtige Strömungen und sie verströmen Zuversicht für eine spannungsgeladene Zukunft des modernen Tanzes.
(Zitate aus dem Begleitheft zu den Kölner Sommerfestspielen)